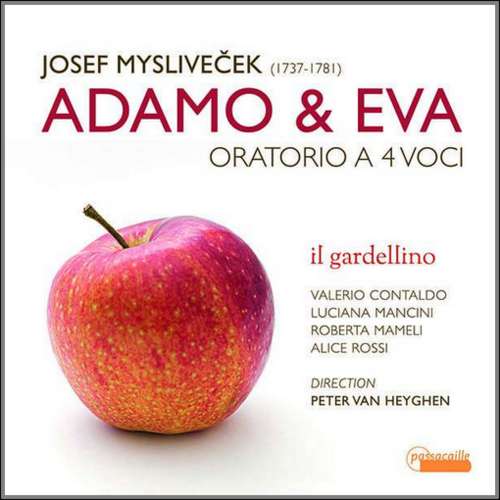.
Das Berlioz-Jahr 2019 bringt nicht nur einige Neuaufnahmen und mehr oder weniger zusammengefasste Gesamtausgaben der bisher aufgenommenen Werke (so bei Warner mit ihren Ex-EMI-Einspielungen, einigem anderen aus ihren eigenen Beständen sowie die neuen Troyens aus Strassburg), sonder hält uns dazu an – mehr noch als sonst vielleicht – einen näheren Blick auf sein Ouevre zu werfen, namentlich auf sein opus summum, Les Troyens, die zuletzt in Paris, Wien und Dresden wiederbelebt wurden. Die Dokumentation der Strassburger Aufführungen von 2018 in der Warner-.Ausgabe unter John Nelson ist bislang (März 2019) die jüngste CD-Aufnahme und nimmt für sich in Anspruch, die vollständige zu sein (was angesichts der barbarisch gestrichenen Serie an der Pariser Bastille 2019 den Berlioz-Fan wieder ins Gleichgewicht bringt).

Hector Berlioz/ Photographie von Nadar/ Wiki
Aber gemach, gemach – ein Kommentar zur neuen Warner-Version bei Amazon brachte uns (i. e. unseren Leser Eberhard Mattes) auf die Spur des wenig Bekannten: The promotional “Editorial Reviews” blurb is incorrect, describing this recording of LES TROYENS as being “absolutely complete” and “uncut.” It is not. At the end of his note on page 33 of the libretto booklet, conductor John Nelson writes that he dropped a scene in Act One and chose the “compressed ending of Act Five over the lengthy and superfluous Epilogue that Berlioz originally conceived”.
Und da fing die Suche an. So vollständig wie erklärt ist der Mittschnitt unter John Nelson also auch wieder nicht. Zum einen gibt er im Vorwort zu, die noch bei Charles Dutoit in seiner mehr als konkurrenzfähigen Decca-Ausgabe enthaltene Szene des trojanischen Spions Sinon im ersten Akt gestrichen zu haben, und er verwendet vor allem das nachkomponierte zweite kurze Finale der Oper ohne Apotheose und Nebenfiguren, das das Werk zwar moderner, konziser enden lässt, aber es auch aus einem bestimmten gluckianischen und zeitverhafteten Kontext herausnimmt. Eben dieses Kennenlernen des Unbekannten wäre ja in einem Konzert wie in Strassburg möglich gewesen, schon weil fast alle anderen Dokumente eben das zuerst intendierte Finale von 1858 nicht bieten („fast“ heisst, dass sich rudimentäre Reste eben dieses ersten Finales auf der Chatelet-DVD-Aufnahmne von John Gardiner von 2004/Erscheinungsdatum bei opus arte finden, zwar eben stark verstümmelt, aber doch mit erweitertem Chor und evozierender Bühnenmusik). Im Grunde sind dies zwei ganz unterschiedliche Welten, die sich bei Berlioz auftun, der selber diese epische Ausuferung erkannte, sein Finale bearbeitete und auf die heute übliche Fassung kürzte. In einem assoziativen Quergedanken erinnert mich die nachstehende Beschreibung der szenischen Ereignisse während der letzten Momente der Troyens, wie sie Berlioz im Detail darlegt, an Richard Wagners Vorgaben für seinen Venusberg im Tannhäuser… („C´est la reine d´amour“…)

Berlioz: „Les Troyens“ am Nationaltheater Mannheim 2003/ Szene/ Foto Jörg Michel/ in der Inszenierung von Sebastian Baumgarten und unter der Leitung von Axel Kober sangen in den Hauptrollen Susan Maclean, Kathleen Broderick, Michail Agafonov, Thomas Berau, Tomasz Konieczny, Ceri Williams und andere
Meines Wissens ist bis heute die hochdiskutierte Aufführung der Troyens 2003 in Mannheim die einzige, die den langen, ersten Schluss und die Sinon-Szene bot; und zu dieser Produktion schrieb der Berlioz-Fachmann Hugh McDonald im Programmheft für das Staatstheater Mannheim einen Beitrag über das erste Finale der Oper, den wir mit sehr liebenswürdiger Genehmigung des Autors und des Staatstheaters hier wiedergeben. Wir danken beiden und sind stolz, eine Korrektur/ Bereicherung zur Wahrnehmung der wunderbaren Trojaner von Hector Berlioz in seinem Jubiläumsjahr 2019 bieten zu können. G. H.
Hugh McDonald schreibt: Hector Berlioz begann im April 1856 mit der Arbeit an der Oper Les Troyens und vollendete das Werk zwei Jahre später, im April 1858. Natürlich hatte er sich bereits lange vor dieser Zeit gedanklich mit dem Sujet beschäftigt und überarbeitete seine Komposition auch später noch. Die grundlegende Arbeit war jedoch nach diesen 24 Monaten abgeschlossen, in denen er sehr konzentriert arbeitete, nur sehr sporadisch Konzerte dirigierte und so wenige Zeitungsartikel wie möglich schrieb.
Die erste Beschäftigung mit dem Sujet geht bis in Berlioz‘ Kindertage zurück, als sein Vater ihm die Leidenschaft für den römischen Dichter Vergil vermittelte. Louis Berlioz lehrte seinen Sohn Latein und ließ ihn viele Passagen Vergils auswendig lernen. Die Szene aus Berlioz‘ Memoiren, in der er berichtet, wie ihn die Geschichte von Didos Schmerz und Tod zu Tränen rührte, ist hinreichend bekannt.

Berlioz: „Les Troyens“/ Finale der Oper 1863 an der Oéra-Comique in der Zeitschriften-Illustration von Tinayre nach den Bühnenbildern von Gérardin/ BNF Galllica
Nach der Fertigstellung des Tedeum von 1849 hatte Berlioz das Komponieren fast ganz aufgegeben, entmutigt von dem geringen Interesse,das das Pariser Publikum seiner Musik entgegenbrachte, und von der Schwierigkeit, auch nur eines seiner größeren Werke zur Aufführung zu bringen. 1850 schrieb er zwar noch La fuite en Egypte, dabei handelte es sich jedoch um ein überschaubares Werk, das zudem nicht als Teil einer größeren Arbeit gedacht war. Drei Jahre lang komponierte Berlioz also praktisch gar nicht, eine interessante Parallele zu Richard Wagners gleichzeitigem kompositorischen Rückzug. 1853 trat eine Wende ein – ebenso wie bei Wagner -, als Berlioz auf Drängen seiner Freunde in Leipzig beschloss, La fuite en Egypte zu einem größeren Werk zu erweitern, woraus schließlich eine Trilogie, das Oratorium L‚enfance du Christ werden sollte.
Der unerwartete Erfolg dieses Werks bei der Pariser Uraufführung im Dezember 1854 ließ in Berlioz erneut den Wunsch aufkeimen, eine große Oper nach Vergil zu schreiben. Einen Wunsch, den er bisher ganz bewusst unterdrückt hatte – aus Angst vor der unglaublichen Anstrengung, den Kosten und der Frustration, die damit verbunden sein würden. Als er im Februar 1855 Weimar besuchte, vertraute er der Fürstin Carolyne Sayn Wittgenstein, der Lebensgefährtin Franz Liszts, seine Gedanken über eine große Oper an. Sie antwortete ihm ohne Umschweife, dass er dieses Werk einfach komponieren müsse; das sei er sich und seiner lebenslangen Leidenschaft für Vergil schuldig.
Ein Jahr lang zögerte Berlioz und versuchte, dem inneren Drang zu widerstehen, wieder als Komponist tätig zu werden. Aber während seines zweiten Besuchs in Weimar im Februar 1856 ließ er sich von der Prinzessin überzeugen: Er kehrte nach Paris zurück und begann bald darauf mit der Arbeit an seiner Oper.

Berlioz: „Les Troyens“ Stéphane Fafarge und Nina Bonnefoy als Enée und Ascanio in Paris 1892/ Foto Nadar/ BNF Gallica
Die letzte Seite des Autographs von Les Troyens ist auf den 12. April 1858 datiert und mit einem Zitat von Vergil versehen: .,Quidquid erit, su peranda omnis fortuna ferendo est“ (,,Was immer auch sein wird, jedwedes Geschick gilt es dadurch zu überwinden, dass man es erträgt“). Diese Zeile spiegelt Berlioz‘ bittere Befürchtung, dass die Schwierigkeiten, die mit einer Aufführung seiner Oper verbunden wären, ihm nichts als Enttäuschung und Ärger bringen würden, was sich in der Realität auch tatsächlich bewahrheiten sollte. Berlioz starb 1869, ohne sein Werk jemals vollständig auf der Bühne erlebt zu haben. Zu seinen Lebzeiten sah er nur die letzten drei Akte seines Werkes, die 1863 unter dem Titel Les Troyens á Carthage mit erheblichen Strichen uraufgeführt wurden, nicht in der großen Pariser Opera, für die das Werk eigentlich konzipiert worden war, sondern nur im bescheideneren Pariser Theätre-Lyrique.
Zu den wichtigsten Änderungen, die Berlioz nach 1858 vornahm, zählen die Streichung der Sinon-Szene und die Komposition eines neuen Finales für den letzten Akt. Die Sinon-Szene führte im ersten Akt die Person des Sinon ein, einen griechischen Spion. Er überzeugt die Trojaner davon, dass das hölzerne Pferd ein Geschenk für Pallas Athene sei und daher in die Stadt gebracht werden sollte. Diese Szene wurde in zahlreichen Aufführungen der letzten Jahre wieder aufgenommen (und findet sich auch in der Aufnahme bei Decca unter Charles Dutoit, hingegen nicht in der neuen Warner-Einspielung unter Nelson/ G. H.).
Das ursprüngliche Finale hingegen wurde bisher noch nie vollständig aufgeführt (und eben 2003 dann in Mannheim/ G. H.). Seine Betonung des Visionären und Epischen entspricht Berlioz‘ Leidenschaft für Vergil und der Vorstellung des Schicksalsgedankens, der eine Linie von den Trojanern zu den Römern zieht. Mit seiner großen Versdichtung Aeneis beabsichtigte Vergil, das Rom des Kaisers Augustus als wahren Erben einer großen Dynastie zu zeigen, die bis in das antike Troja zurückreicht. Er weitete Homers Erzählung vom Trojanischen Krieg aus, um die Geschichte von Aeneas‘ Reisen weiter auszuführen, die schicksalhafte Begegnung mit Dido in Karthago einzuflechten und die Macht des Schicksals zu verdeutlichen, die Aeneas nach Italien treibt, wo er dazu bestimmt war, die Stadt und das Kaiserreich Rom zu gründen. Er wusste, dass Didos Geschichte ein Anachronismus war, da ihr Reich bekanntermaßen erst Jahrhunderte nach dem Fall Trojas erblühte, aber die dramatische Kraft dieser Erzählung sowie ihre ausdrucksstarke poetische Phantasie verliehen der Aeneis eine Faszination, der Berlioz wie Tausende anderer Leser mit leidenschaftlicher Begeisterung erlagen.

Berlioz: „Les Troyens“/ Plakat für die Aufführungen in Paris 1892 mit Marie Delna/ Wikipedia
Zu einem frühen Zeitpunkt der Komposition dachte Berlioz daran, die sterbende Dido eine Bemerkung zur französischen Herrschaft in Nordafrika aussprechen zu lassen, eine Bemerkung, die Kaiser Napoleon III. geschmeichelt haben könnte. Die ,,Anspielung der sterbenden Dido auf die spätere Herrschaft Frankreichs in Afrika“ schien ihm aber später doch, wie er schrieb „nichts als kindlicher Chauvinismus“ zu sein. Es wäre viel „würdiger und größer(…), bei der Idee zu bleiben, die Vergil selbst andeutet. Da her lasse ich die Königin, was mir überdies viel logischer erscheint, folgen de Worte sprechen.“ {An Carolyne Sayn-Wittgenstein , 25. Dezember 1856) Dann zitiert er aus seiner neuen Fassung, in der Hannibals Name genannt wird. Didos Beschwörung Hannibals, den verletzten Stolz der Karthager sowie ihren Selbstmord zu rächen, bildeten vermutlich den allerersten Entwurf des Finales der Troyens.
Doch zwei Jahre später schrieb er an Hans von Bülow: ,,Ich habe jetzt dem Drama einen Abschluss gegeben, der grandioser und folgerichtiger ist als der, mit dem ich mich bisher begnügt hatte. Der Zuschauer wird den glücklichen Ausgang des von Aeneas begonnenen Unternehmens erfahren. Clio ruft in der letzten Szene , während in der Feme das Kapitol von Rom im Strahlenkranze am Horizonte erscheint: ,Fuit Troja! Stat Roma!“‚ (20. Januar 1858)
Diese letzte Szene entwickelt sich wie folgt: Dido beschwört den Namen Hannibals, bevor sie sich ersticht. Als sie sterbend in den Armen ihrer Schwester Anna liegt, beginnt ein Regenbogen über dem Scheiterhaufen sichtbar zu werden und ein siebenfarbiges Strahlenspektrum fällt auf ihren Körper. Die Göttin Iris erscheint am Himmel, schwebt über den Scheiterhaufen und streut Mohnblumen über die sterbende Königin, während Plutos Hohepriester verkündet, dass die Götter Mitleid haben und Iris aussandten, um Didos Leid zu beenden. Der Regenbogen verschwindet mit der Göttin, das Farbspektrum bleibt. Dann tritt der Hohepriester hervor und stimmt einen Totengesang an, der von den Karthagern wiederholt wird: ,,Ame souffrante exhale-toi / Au nom des dieux de ton corps delivree.“ (,,Leidende Seele, steig hinauf / Befreit vom Leibe im Namen der Götter.“) Das Farbspektrum verschwindet. Dido stirbt. Die karthagische Flagge wird über ihren Körper gelegt. Alle erheben sich, schreiten vorwärts und stoßen mit erhobenen Armen einen Fluch auf das Geschlecht des Aeneas aus (Allegro con fuoco, D-Dur).

Berlioz: „Les Troyens“/ Bühnenbild von Chaperon zum vierten Akt für Paris 1863/ BNF Galica
Dieser Szene folgt ein längerer Epilog. Ein Vorhang fällt, der die „Zeit“ darstellt, gefolgt von einer Prozession der „Stunden“, von denen zwölf in weiße und rosafarbene Tuniken sowie zwölf in schwarze Tuniken mit Sternen gekleidet sind. ,,Man hört ein geheimnisvolles Raunen des Orchesters, durchbrochen von majestätischen Klänge .“ Dieses geheimnisvolle Raunen besteht aus einer Folge von fünf Takten, die vier Mal wiederhol t werden. Sie bewegt sich schrittweise von B über C, D und E nach Fis und mit einem Bogen zurück nach B. Die „Jahrhunderte“ sind symbolisch vorbeigezogen und der Vorhang hebt sich nun zum Ruhm des römischen Kaiserreiches. Das Kapitol zeigt sich in seinem Glanz. Auf der einen Seite ist Clio zu sehen, die Muse der Geschichte, mit Fama, der Allegorie des Ruhmes. Der trojanische Marsch ist zu hören, nun transformiert in einen römischen Marsch, und eine Prozession passiert das Kapitol: zunächst ein Krieger in einer strahlende n Rüstung an der Spitze der römischen Legionen. Clio ruft aus ,,Scipioni africano gloria!“ An zweiter Stelle erscheint ein weiterer, mit Lorbeeren bekrönter Krieger, eben falls gefolgt von Legionen: ,Julio Caesari gloria!“ Als drittes tritt ein Herrscher mit einem Gefolge von Poeten und Künstlern auf: ,,lmperatori Augusto et divo Virgilio gloria! Gloria! Fuit Troja… Stat Roma!“, beantwortet von einem entfernten Echo „Stat Roma!“ Die letzten Klänge des trojanischen bzw. römischen Marsches hallen nach.
Dieses großartige, idealistische Plateau rückt den Blick des Zuschauers von der Geschichte Didos und Aeneas‘ etwas ab und bezieht die gesamte Geschichte der Antike mit ein. Keine Oper hat jemals einen derartig weit gefassten Blick gewagt (obwohl La mort d’Adam von Berlioz‘ Lehrer Jean Franois Le Sueur gleichermaßen apokalyptisch war). Die Erhabenheit dieses Schlusses ist dem Poeten, dem diese Oper gewidmet ist, zweifellos würdig: ,,Diva Virgilio“, dem „göttlichen Vergil“.

Berlioz: „Les Troyens – die Garcia Tochter und Lehrerin/Schülerin Pauline Viardot inspirierte Berlioz zu Änderungen und war sein Orphée in der von ihm eingerichteten Fassung/OBA
Dieses Finale blieb nahezu zwei Jahre unberührt. Im Winter 1859/ 60 arbeitete Berlioz eng mit Pauline Viardot, die mit ihm befreundete Sängerin, an einer Wiederbelebung von Willibald Glucks Oper Orphee am Theätre-Lyrique Paris und zeigte ihr im Zuge dessen auch die Partitur von Les Troyens mit der Bitte um eine kritische Stellungnahme. Am 25. Januar 1860 schrieb er der Freundin: „Gestern habe ich hart gearbeitet. Ich musste mit Feuer und Kriegsbeil das Finale angehen, das dich so kalt gelassen hat. Ich denke, dass es jetzt sehr gut ist. Wie muss ich dir danken, dass Du mich auf so viele schwere Fehler aufmerksam gemacht hast!“
Der neue Schluss, den Berlioz nun als definitiv ansah, als er im folgenden Jahr die Partitur drucken ließ, versucht Anfang und Ende des originalen Schlusses miteinander zu verschmelzen und in einem einzigen kurzen Satz zu bündeln. Sicherlich hat er gespürt, dass die frühere Version zu lang war. Indem er jedoch das Finale derartig verkürzt hatte, verwässerte er die Klarheit seiner Aussage und opferte damit auch die vollständige Erhabenheit seiner epischen Vision.
In der neuen Fassung treten weder Iris, noch Clio, Scipio oder Caesar auf. Ebenso entfernte Berlioz den Gesang des Hohepriesters im Epilog. Wenn Dido stirbt, hat sie, trotz ihrer gerade verklungenen Anrufung Hannibals, eine Vision von Roms ewigem Ruhm. Das römische Kapitol erscheint, mit den Legionen und einem „Imperator“ mit seinem Gefolge von Poeten und Künstlern, die zu den Klängen des Marsches vorüberziehen. Zur gleichen Zeit stößt das karthagische Volk einen Fluch aus, den Schrei des Ersten Punischen Krieges, der in seiner Wut einen Kontrast zur Feierlichkeit des Triumphmarsches bildet.“
Die Problematik der letztgültigen Fassung liegt darin, dass Berlioz versuchte, zwei unterschiedliche, dramatische Bilder in einem darzustellen, was allerdings nicht zu stören schien. Für einen Augenblick wird mit einem großen Bühnenspektakel der Triumph des römischen Imperiums sowie ein Abbild Roms heraufbeschworen. Während der Marsch als eine musikalische Darstellung der Wandlung von Trojanern in Römer gehört werden kann, repräsentiert der Chor immer noch die Karthager und ihren Fluch „Haine eternel/e a la race d’Enee“, der gegen die Marschmelodie gesungen wird, als ob der Sieg verleugnet werden sollte. Um dies musikalisch zu erreichen, setzt der Chor auf einem As im Fortissimo gegen das vorherrschende B-Dur des Marsches ein. Die sich daraus ergebende Dissonanz reicht jedoch nicht aus, die bittere Botschaft des ewigen Hasses der Karthager auf Rom wiederzugeben.
Die ursprüngliche Fassung der Oper mit dem Finale von 1858 ist zwar etwas länger als die spätere Version. Allerdings findet sie dadurch auch eine entsprechende Form, um Vielfalt und Größe der Antike zu vermitteln. Das erste Finale zieht Götter und Göttinnen hinzu, die eine große Rolle im Schicksal der Menschen gespielt haben, und eröffnet einen Einblick in das Epos – im Sinne eines Vergil oder sogar Homer. Zweifellos versinnbildlichen die Schlussworte der Oper in der originalen Version, ,,Fuit Troja, stat Roma! „, diese Vision stärker als der hasserfüllte Ausruf der Karthager, der keinen wirklichen Widerspruch zum römischen Marsch eröffnet.

Berlioz: „Les Troyens – Stéphane Lafarge sang den Enée in Paris 1892/ Foto Nadar/ OBA
Dazu als Einschub die Regieanweisungen des Finales von 1858: Über den Scheiterhaufen spannt sich ein Regenbogen, und auf Didos Leichnam fällt ein in sieben Grundfarben zerlegte Sonnenstrahl. ris erscheint in der Luft, schwebt über den Scheiterhaufen hinweg und streut Mohnblumen über die sterbende Königin. Alle werfen sich vor Iris‘ göttlicher Erscheinung nieder. Der Strahl verschwindet. Dido stirbt. Anna fällt neben ihr ohnmächtig zu Boden. Die karthagische Fahne wird auf dem Scheiterhaufen aufgepflanzt, so dass ihre Falten Didos Leichnam bedecken. Männer des Volkes gruppieren sich um den Scheiterhaufen und auf ihm. Der gesamte Chor geht zwei Schritte in Richtung Vorderbühne und streckt dabei den rechten Arm aus. Ein Vorderbühnenprospekt geht herunter, der die Zeit mit dem Gefolge der Stunde darstellt. Zwölf tragen Gewänder in Weiß und Rosa und zwölf tragen schwarze Gewänder mit goldenen Sternen. Man hört ein geheimnisvolles Raunen des Orchesters, durchbrochen von majestätischen Klängen…. Der Vorderbühnenprospekt geht wieder hoch, man sieht in einer Gloriole das römische Kapitol. Die Bühne ist leer. Auf einer Seite steht lediglich Clio, die Muse der Geschichte, begleitet von Fama. Es ertönt die Triumphversion des Trojanermarsches, der von der Tradition weitergetragen und zum Triumphgesang der Römer geworden ist) … Man sieht einen Krieger vor dem Kapitol vorüberziehen. Er trägt eine stählerne Rüstung und führt römische Legionen… Man sieht einen anderen Krieger vorüberziehen. Er ist lorbeergekrönt und führt andere Legionen. Man sieht einen Kaiser vorüberziehen, umgeben von einem Hofstaat von Dichtern und Künstlern. Imperatori Augusto et Divo Virgilio Gloria! Gloria! Fuit Troja, Stat Roma! SOPRAN (aus dem Hintergrund) Stat Roma! EIN TENOR (noch weiter entfernt) Stat Roma! (aus dem Programmheft des Staatstheaters Mannheim 2003; die Übersetzung des Librettos folgt in weiten Teilen der wörtlichen Übertragung von Krista Thiele, mit Dank.)

Hector Berlioz: „Les troyens“/ der Autor und Musikwissenschaftler Hugh McDonald/ Hector Berlioz website
Als sich im Februar/ März 1858 die Fertigstellung seines Werkes abzeichnete, schrieb Berlioz über seine Komposition mit heroischen Worten an Adolphe Samuel: ,,Es ist fast gleichgültig, was mit dem Werk passiert, ob es jemals aufgeführt wird oder nicht. Meine Begeisterung für die Musik und Virgil wird erfreuen und ich werde zumindest gezeigt haben, was meiner Meinung nach mit einem klassischen Thema großen Umfangs zu tun möglich ist.“ (26. Februar 1858) Und in einem Brief an seine Schwester Adele, den er kurz danach verfasste: ,,Ich versichere dir, liebe kleine Schwester, dass die Musik von Les Troyens etwas Prächtiges und Großes hat,‘ darüber hinaus besitzt sie eine ergreifende Wahrhaftigkeit, und sie enthält Erfindungen, die, wenn ich mich nicht fürchterlich täusche, den Musikern in ganz Europa die Ohren durchblasen und vielleicht ihre Haare zu Berge stehen lassen werden. Ich glaube, wenn Gluck auf die Erde zurückkäme und diese Musik hörte, würde er zu mir sagen: ,Wahrhaftig, dies ist mein Sohn.‘ Das ist nicht besonders bescheiden von mir, oder? Aber schließlich habe ich die Bescheidenheit zuzugeben, dass ein Mangel an Bescheidenheit zu meinen Fehlern gehört.“ (11. März 1858) Hugh Macdonald (mit Dank!)
Noch ein kurzes Wort aus Wikipedia zu den originalen Besetzungen: Zunächst wurde am 4. November 1863 in Paris am Théâtre Lyrique nur der zweite Teil, Les Troyens à Carthage, gespielt. Die musikalische Leitung hatten Adolphe Deloffre und der Komponist. Regie führte Léon Carvalho. Es sangen Jules-Sébastien Monjauze (Énée), Estagel (Ascagne), Péront (Panthée) Anne-Arsène Charton-Demeur (Didon), M. Dubois (Anna), Jules-Émile „Giulio“ Petit (Narbal), De Quercy [Dequercy] (Iopas) und Édouard [Cabel] Dreulette (Hylas). Die Uraufführung des ersten Teils La prise de Troie erfolgte erst 1879, also zehn Jahre nach Berlioz’ Tod. Erst 1890 erreichten Les Troyens die Pariser Oper mit Maria Delna und Jean Laforge in den Haupotrollen

Berlioz: „Les Troyens“ – Marie Delna sang die Didon in Paris 1892/ Foto Nadar/ Wiki
Und weiter bei der englischen Wikipedia: After the premiere of the second part at the Théâtre Lyrique, portions of the opera were next presented in concert form. Two performances of La prise de Troie were given in Paris on the same day, 7 December 1879: one by the Concerts Pasdeloup at the Cirque d’Hiver with Anne Charton-Demeur as Cassandra, Stéphani as Aeneas, conducted by Ernest Reyer; and another by the Concerts Colonne at the Théâtre du Châtelet with Leslino as Cassandra, Piroia as Aeneas, conducted by Edouard Colonne. (…)
The first staged performance of the whole opera only took place in 1890, 21 years after Berlioz’s death. The first and second parts, in Berlioz’s revised versions of three and five acts, were sung on two successive evenings, 6 and 7 December, in German at Karlsruhe (Die deutsche Übersetzung des Texts stammte von Otto Neitzel. In den drei Hauptrollen sangen Alfred Oberländer (Aeneas), Elise Harlacher-Rupp (Ascanius) und Carl Nebe (Pantheus). Hinzu kamen Luise Reuss-Belce (Kassandra), Marcel Cordes (Chorebus), Pauline Mailhac (Hekuba und Dido), Hermann Rosenberg (Helenus und Iopas), Annetta Heller (Polyxene), Christine Friedlein (Anna), Fritz Plank (Narbal) und Wilhelm Guggenbühler (Hylas). This production was frequently revived over the succeeding eleven years and was sometimes given on a single day. The conductor, Felix Mottl, took his production to Mannheim in 1899 and conducted another production in Munich in 1908, which was revived in 1909. He rearranged some of the music for the Munich production, placing the „Royal Hunt and Storm“ after the love duet, a change that „was to prove sadly influential.“ A production of both parts, with cuts, was mounted in Nice in 1891.
On 9 June 1892 the Paris Opéra-Comique staged Les Troyens à Carthage (in the same theatre as its premiere) and witnessed a triumphant début for the 17-year-old Marie Delna as Didon (Foto oben Marie Delna als Didon 1892/ Foto Nadar/Wikipedia), with Stéphane Lafarge as Enée, conducted by Jules Danbé; these staged performances of Part 2 continued into the next year. In December 1906 the Théâtre de la Monnaie in Brussels commenced a run of performances with the two halves on successive nights.

Berlioz: „Les Troyens“ – Finale der Oper in der Zeitschriften-Illustration 1863/ BNF Gallica
The Opéra in Paris presented a production of La prise de Troie in 1899, and in 1919 mounted a production of Les Troyens à Carthage in Nîmes. Both parts were staged at the Opéra in one evening on 10 June 1921, with mise-en-scène by Merle-Forest, sets by René Piot and costumes by Dethomas. The cast included Marguerite Gonzategui (Didon), Lucy Isnardon (Cassandre), Jeanne Laval (Anna), Paul Franz (Énée), Édouard Rouard (Chorèbe), and Armand Narçon (Narbal), with Philippe Gaubert conducting. Marisa Ferrer, who later sang the part under Sir Thomas Beecham in London, sang Didon in the 1929 revival, with Germaine Lubin as Cassandre and Franz again as Énée. Georges Thill sang Énée in 1930. Lucienne Anduran was Didon in 1939, with Ferrer as Cassandre this time, José de Trévi as Énée, and Martial Singher as Chorèbe. Gaubert conducted all performances in Paris before the Second World War.
The Paris Opéra gave a new production of a condensed version of Les Troyens on March 17, 1961, directed by Margherita Wallmann, with sets and costumes by Piero Zuffi. Pierre Dervaux was the conductor, with Régine Crespin as Didon, Geneviève Serrès as Cassandre, Jacqueline Broudeur as Anna, Guy Chauvet as Énée, Robert Massard as Chorèbe and Georges Vaillant as Narbal; performances by this cast were broadcast on French radio. Several of these artists, in particular Crespin and Chauvet, participated in a set of extended highlights commercially recorded by EMI in 1965, Georges Prêtre conducting. 1989 eröffnete die Pariser Bastille mit Les Troyens, in den Hauptrollen Grace Bumbry , Shirley Verrett und Georges Gray unter Myung Whun Chung in Pizzis problematischer, kalter Produktion (dazu den amüsanten Bericht in der New York Times). Redaktion G. H. (Foto oben: Berlioz: „Les Troyens“/ Giovanni_Battista_Tiepolo „Aeneas
Introducing Cupid Dressed as Ascanius to Dido/ Wikipedia WGA22337)
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.


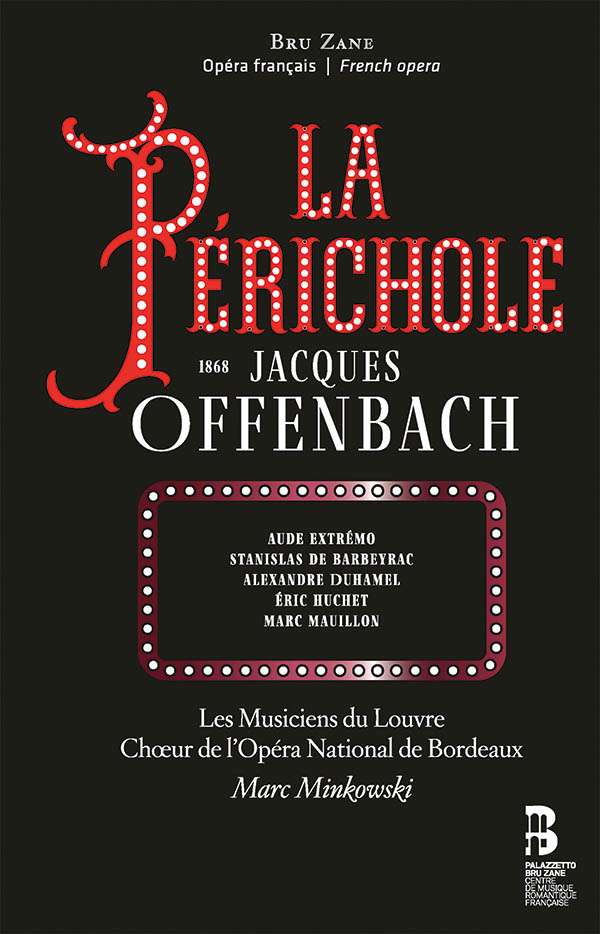











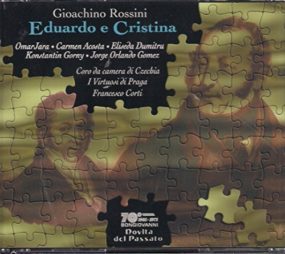
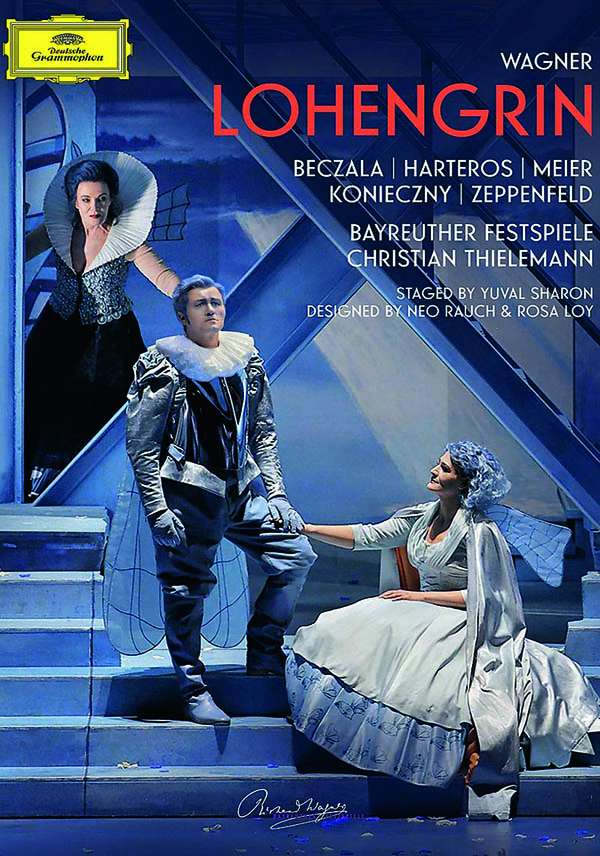






















 Was für ein Glück, dass die
Was für ein Glück, dass die