Das Cover täuscht. Es sieht eindeutig nach einer Kinder-CD à la Klassik für Kinder aus. Mit einem dirigierenden Väterchen Moniuszko, einer lachenden Sonne, einem spitzbübischen Mond, einem Fiedler, einem Fischer, einem Kosaken und anderen Figuren, die offenbar Stanislaw Moniuszkos zwölfbändiger Liedsammlung Śpiewnik domowy entsprungen sind, was so viel heißt wie Lieder für den Hausgebrauch. Es handelt sich um Klassik mit Kindern, die im Juni 2018 und Juni 2019 zu Moniuszkos 200. Geburtstag in der Philharmonie von Wroclav versammelten. Selten hat man in einem Beiheft NFM 63 ACD 265 2) so viele singende Mädchen abgebildet gesehen: die zopfigen Mädchen in blauen und roten Röcken und weißen Blusen des Clave de Sol Chores, die Mädchen in dunkelblauen Kleidchen und lilafarbenen Schleifen des Gaudeamus Chores, die sehr zahlreichen Mädchen in bodenlangen blauen Kleidern und weißer Gürtelschleife des Chors der Marschall Jozef Pilsudski Mittelschule in Rzekuń, die jüngeren Mädchen in rotkarierten Röcken und dunklem Oberteil des Kamerton Chores und schließlich die Mädchen in etwas dunkel Bodenlangem und pinkfarbenem Schal vom Portamento Kammerchor. Das ist nicht immer kleidsam. Aber die gute Absicht zählt, schließlich versammeln sie sich alle im in der Akademia Chóralna, einer Chorakademie zur Förderung des Gesangs unter Leitung von Agnieszka Franków-Zelazny, deren Biografie uns das Beiheft auf deutsch und polnisch auf vier Seiten erzählt. Gerne hätte man stattdessen etwas über die ausgewählten Lieder erfahren, bei denen es sich um die heute noch volkstümlichsten aus den berühmten Sammlungen Moniuszkos handelt. Alles arrangiert von Roman Drozd. Aufgewertet wird das 54minütige Programm durch die Arie des Jontek und den Chor aus dem vierten Akt der Halka, einem Chor aus Verbum nobile, dem Chor aus dem zweiten Akt, der Arie des Skoluba und schließlich dem Mazurkafinale aus dem Gespensterschloß. Begleitet vom NFM Leopoldinum Orchester singen die Mädchen das so lustvoll, freudig und mit rhythmischem Drive wie es richtige Volkslieder verdienen, eben als Popsongs von gestern, denn Moniuszko hat die Bedürfnisse der damaligen Gesellschaft genau erfasst. Es handelt sich meist um kurze strophische, gelegentlich balladenartige, melodisch elegant und ansprechende Lieder mit nicht zu hohen Ansprüchen. Dazu gehören Der alte Mann und die alte Frau, Die Spinnerin, Der Kosake, Das Teufelchen, Kameraden, die alle Moniuszkos Volkstümlichkeit erklären. Sie wurden nicht nur in den Schlossern des Adels und den großbürgerlichen Häusern, sondern auch in den strohgedeckten Hütten gesungen, wie einer seiner Biografen bemerkte, und prägten das polnische Lebensgefühl. Die Opernchöre verlieren durch die jungen Stimmen leider etwas an Ausdruck und Farbigkeit. Das klingt dann doch sehr nach Abschlussabend in der Schulaula. Mit gutem Willen und viel Gefühl singt der Tenor Sebastian Mach die Arie des Jontek, der offenbar erfahrenere Bassbariton Jerzy Butryn die Arie von der alten Uhr aus dem Gespensterschloss; im Mazurka-Finale vervollständigen eine Sopranistin und Altistin der Solistenquartett. Rolf Fath
 Das wäre damals das passende Mitbringsel gewesen. In der letzten Stunde des Musikkritik-Seminars an der Wiener Uni vor den Ferien brachte jeder etwas möglichst Unbekanntes auf Tonträgern mit. Und alle, inklusive unseres Professors, sollten aus dem knisternden Zeugs Epoche, Komponisten, möglichst auch das Werk erraten. In Zeiten, da nicht nahezu alles auf irgendwelchen Quellen ständig greifbar war, bedeutete das eine nicht geringe Herausforderung. Nun hören wir ein geschmackvolles Preludio. Zwei Krieger unterhalten sich auf Italienisch, einer liebt Neala, die Tochter des der Brahmanen-Kaste zugehörigen Hohepriesters Akebar. Dann folgt der Chor der Krieger. Das ist eine Situation wie aus Norma oder La vestale. Offenbar ein Priesterinnendrama aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, vielleicht aus dem Umkreis von Mercadante oder Pacini.
Das wäre damals das passende Mitbringsel gewesen. In der letzten Stunde des Musikkritik-Seminars an der Wiener Uni vor den Ferien brachte jeder etwas möglichst Unbekanntes auf Tonträgern mit. Und alle, inklusive unseres Professors, sollten aus dem knisternden Zeugs Epoche, Komponisten, möglichst auch das Werk erraten. In Zeiten, da nicht nahezu alles auf irgendwelchen Quellen ständig greifbar war, bedeutete das eine nicht geringe Herausforderung. Nun hören wir ein geschmackvolles Preludio. Zwei Krieger unterhalten sich auf Italienisch, einer liebt Neala, die Tochter des der Brahmanen-Kaste zugehörigen Hohepriesters Akebar. Dann folgt der Chor der Krieger. Das ist eine Situation wie aus Norma oder La vestale. Offenbar ein Priesterinnendrama aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, vielleicht aus dem Umkreis von Mercadante oder Pacini.
Die Sprache führt in die Irre: Stanislav Moniuszkos letzte vollendete Oper, das dreiaktige indische Kasten-Drama Paria wurde 1869 in Warschau uraufgeführt, nach langem Schweigen nach dem zweiten Weltkrieg mehrfach wiederbelebt und zuletzt im Vorjahr zum 200. Geburtstag des 1819 geborenen Vaters der polnischen Nationaloper in Posen/ Poznań zur größeren internationalen Verbreitung des CD-Mitschnitts in einer von Moniuszko offenbar parallel vertonten italienischen Übersetzung gegeben (2 CD Dux 1622 1623). Vermutlich wäre ich nie auf das Werk gestoßen, wenn mir Geerd Heinsen nicht vor mehr als zehn Jahren stolz den Mitschnitt einer Krakauer Aufnahme von 1980 geschickt hätte. Geerd hat sich auch eingehend und umfangreich hier in operalounge.de mit dem Paria beschäftigt, der mich damals keinesfalls beeindruckte:Der DUX-Mitschnitt aus dem Konzertsaal des Philharmonischen Orchesters Poznań vom April 2019 bietet nun einen nicht unwesentlichen klangtechnischen Vorteil.
Kaum sind die Krieger verschwunden, enthüllt Idamor seine Seelenqual: er hat sich zwar als Krieger siegreich geschlagen, ist aber ein Paria und deshalb Nealas unwürdig. Alles Folgende enthüllt sich wenig überraschend und in den Konventionen einer nachgeborenen Seria. Akebar entbindet seine Tochter vom Keuschheitsgelübde und bestimmt ihr Idamor zum Gatten. Neala liebt Idamor und steht auch zu ihm, nachdem sie seine wahre Herkunft erfahren hat. Akebar lässt Idamor töten, Neala sagt sich von den Brahmanen los und zieht mit Idamors Vater Djares von dannen. Den Text schrieb Jan Chęciński, der im Gespensterschloss prall und lebensecht eine Epoche der polnischen Geschichte beschworen hatte und hier nur steifleinene Zeilen lieferte, für die er sich auf ein Stück von Casimir Delavigne, nicht zu verwechseln mit dem Auber- und Meyerbeer-Librettisten Germain Delavigne, von 1821 von stützte. Verblüfft stellt man sofort fest, dass weder der Ort der Handlung, ein heiliger Hain in der Nähe von Benares, die Tempel der Gottheiten, die Säle der Brahmanen, noch ihre kriegerischen oder religiösen Gesänge irgendwelche Folgen für die Musik haben, die auf ernüchternde Art ohne Exotik und Lokalkolorit auskommt. Nach dem Prolog folgt die fast zehnminütige Ouvertüre, die, wie fast immer bei Moniuszko, ausgezeichnet ist, dann arbeitet sich der Komponist brav an den dem ihm bekannten und vertrauten Schemata ab, gibt Idamor und Neala schöne Cavatinen, auch zwei gemessen leidenschaftliche Duette, der Sopranistin noch eine Romanze im zweiten und eine kleine Arie im dritten Akt, Akebar bekommt u.a. eine Invocazione mit anschließender Arie, im dritten Akt noch eine Preghiera, ist aber weit entfernt von der Wucht eines Oroveso, besonders schön sind die Canzone und die Einwürfe des Paria-Vaters Djares, die von einer fast schon kitschig edelmütigen Eingängigkeit sind.
Der noch junge polnische Bariton Szymon Komasa singt den verbotenerweise die heiligen Bezirke eindringenden Djares mit aufregender Pracht und belkantistischer Linienführung. Er und der weißrussische Tenor Yuri Gorodetski, der seinen Sohn Idamor singt, stehen auf der Habenseite dieser Aufnahme. Gorodetski hat einen kleinkalibrigen, hübschen Tenor italienischer Schule, und weiß offenbar auch genau, was er singt, zumindest kann es vermitteln, worin sich die Lektionen durch Raina Kabaivanska bezahlt machen, und man hört ihm und Komasa ausgesprochen gerne zu, weshalb beider Duett am Ende des zweiten Akt das eigentliche Zentrum der Aufführung ist. Die Finali verkleckern ansonsten müde. Es herrscht ein schulmeisterlicher, unspezifischer Ton. Im Beiheft (pol./engl.) heißt es, dass die Musik „Rewarding for performers“ sei, „However ist lacks in originality, there is no unique tone her, both in melancholy and in dramatic guts, there is no panache, sincere emotions and tragedy….“. Dem ist nichts hinzufügen. Katarzyna Holysz hat einen spitzen, nicht durchgebildeten, in den Höhen gespreizten Sopran, dem es für die Neala an Fülle für die emotionalen Szenen, an Durchschlagskraft und Textausdeutung mangelt. Als Hohepriester versieht Robert Jezierski seinen Dienst, dazu gibt es noch den von Tomasz Warmijak gesungenen Ratef und die nicht allzu sehr beschäftigte Priesterin von Justyna Jedynak-Obloza. Die Chöre der Brahmanen und Priester sind zwar häufig und deutlich im Einsatz – Lohengrin warf seinen Schatten bis nach Warschau – können sich aber nicht vermitteln: Warsaw Philharmonic Choir. Lukasz Borowicz hat das Werk mit dem Poznań Philharmnic Orchestra so genau einstudiert, wie man es von ihm mittlerweile kennt. Das Orchester versenkt sich in die instrumentalen Finessen, vor allem die vielen Streichersoli, da aber Moniuszko im Paria seine eigene Sprache aufgegeben hat, bleibt dieser Indien-Ausflug weiterhin eine Fußnote in der Geschichte der polnischen Oper (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei https://www.note1-music.com/shop/.). Rolf Fath
 An den Ufern der Weichsel: Der Flößer Es wirkt wie auf einer Illustration aus dem Warschau des 19. Jahrhunderts. Die Ouvertüre ist eine musikalische Idylle, zeichnet ein Bild vom alten Warschau, wo die frommen Landleute am Ufer der Weichsel nach einem überstandenen Sturm Gott auf Knien danken. Die von dem bedeutenden, durch seinen Dioramenschauen berühmt gewordenen Maler und Bühnenbildner Antonio Sacchetti „nach der Natur“ gemalte Weichsel und die sich in ihrem Wasser spiegelnden Szenen entzückten bei der Uraufführung von Moniuszkos Flis das Publikum. Gefeiert wurde auch der Komponist, der am 24. September 1858 im Teatr Wielki selbst am Pult stand. Es war alles in allem ein großer Abend, bei dem beim Betreten des Theaters auch der russische Zar gefeiert wurde, der sich zwischen dem 25. und 28. September mit seinen Kollegen aus Preußen, Österreich und Bayern zu Manövern traf. Doch Alexander II. sah weder den Flößer, da er die Aufführung während des davor gespielten Balletts Robert und Bertrand verlassen musste, noch besuchte er eine Aufführung der ebenfalls in dieser Zeit angesetzten Halka. Flis, so der originale polnische Titel des Einakters, war sofort erfolgreich, zeigt er doch liebgewonnenes ein Bild aus einem alten Polen, wie es auf romantisch verklärte Weise im Gespensterschloss wiederkehrt. Fabio Biondi und seine Getreuen zoomen – zehn Jahre nach einer Aufnahme aus dem Schloss von Szczecin – dieses historische musikalische Diorama jetzt in die Gegenwart und nahmen den Flößer im August 2019 am Ort der Uraufführung, also im Teatr Wielki in Warschau, auf (F.-Chopin-Institut 1 CD NIFCCD 086, Textheft mit engl./poln. Libretto – Kompliment für die gute Ausstattung).
An den Ufern der Weichsel: Der Flößer Es wirkt wie auf einer Illustration aus dem Warschau des 19. Jahrhunderts. Die Ouvertüre ist eine musikalische Idylle, zeichnet ein Bild vom alten Warschau, wo die frommen Landleute am Ufer der Weichsel nach einem überstandenen Sturm Gott auf Knien danken. Die von dem bedeutenden, durch seinen Dioramenschauen berühmt gewordenen Maler und Bühnenbildner Antonio Sacchetti „nach der Natur“ gemalte Weichsel und die sich in ihrem Wasser spiegelnden Szenen entzückten bei der Uraufführung von Moniuszkos Flis das Publikum. Gefeiert wurde auch der Komponist, der am 24. September 1858 im Teatr Wielki selbst am Pult stand. Es war alles in allem ein großer Abend, bei dem beim Betreten des Theaters auch der russische Zar gefeiert wurde, der sich zwischen dem 25. und 28. September mit seinen Kollegen aus Preußen, Österreich und Bayern zu Manövern traf. Doch Alexander II. sah weder den Flößer, da er die Aufführung während des davor gespielten Balletts Robert und Bertrand verlassen musste, noch besuchte er eine Aufführung der ebenfalls in dieser Zeit angesetzten Halka. Flis, so der originale polnische Titel des Einakters, war sofort erfolgreich, zeigt er doch liebgewonnenes ein Bild aus einem alten Polen, wie es auf romantisch verklärte Weise im Gespensterschloss wiederkehrt. Fabio Biondi und seine Getreuen zoomen – zehn Jahre nach einer Aufnahme aus dem Schloss von Szczecin – dieses historische musikalische Diorama jetzt in die Gegenwart und nahmen den Flößer im August 2019 am Ort der Uraufführung, also im Teatr Wielki in Warschau, auf (F.-Chopin-Institut 1 CD NIFCCD 086, Textheft mit engl./poln. Libretto – Kompliment für die gute Ausstattung).
Wie bei der Halka spielt Europa Galanta, es wirken Sänger mit, die wir von ebendieser Halka oder anderen aktuellen Moniuszko-Aufnahmen kennen. Das Libretto von Stanislaw Boguslawski, war so schlicht wie volkstümlich und effektiv und band ein kleines Familien- bzw. verwandtschaftliches Geheimnis so locker um eine Liebesgeschichte wie Unmengen solcher nach dem Muster von Rossinis Farsen gestrickte Einakter. Da erscheint logisch, wenn man bedenkt, dass große Teile der Oper während Moniuszkos Paris-Aufenthalt entstanden, bei dem er auf Auber und Rossini getroffen war.
Zosia, die Tochter des wohlhabenden Fischers Antoni, liebt den Flößer Franek, soll aber nach dem Wunsch des Vaters den Frisör Jakub heiraten. Vergeblich versucht auch ehemalige Soldat Szóstak den Vater umzustimmen. Also beschließt Franek in die Welt zu ziehen, um seinen vermissten Bruder zu suchen, als welcher sich Jakub herausstellt, der großzügig auf Zosia verzichtet usw. Moniuszko stattet die sechs Personen musikalisch reich aus: gibt der Primadonna eine Dumka, wie er sie schon in der Halka verwendet hatte, ein Duett für sie und den Soldaten, der gleichfalls ein Ariette erhält und damit zu einer zentralen Gestalt neben dem Liebhaber aufgewertet wird, welcher sich in ein Duett mit Zosia teilt. Auffallend für einen sechzigminütigen Einakter ist der mehrfache Einsatz des Chores, vor allem in der eindrucksvollen Eingangsszene. Noch auffallender, die Ouvertüre, die vom Umfang 15 % des Werkes ausmacht und ein bisschen wo wirkt als wolle Moniuszko, der wenige Wochen vor der Uraufführung sein Amt als Chefdirigent der Polnischen Nationaloper am Teatr Wielki angetreten hatte, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Große Worte findet auch Biondi für die Musik des „grande Moniuszko“, der „l’intensia emotiva e la profondità dell’orchestrazione restino sempre al servisio, nel dramatico e nel buffo, al grande tema universale che ci guida, l’amore“. Biondi und das auf Originalinstrumenten spielende Ensemble Europa Galante bringen die Ouvertüre, die in die Eingangsszene leitet, als stimmungsvolles Orchestergemälde zur Geltung, in der sich Moniuszkos Musik volkstümlich locker, allerdings nie im „internationalen“ buffonesken italienisch-französischen Stil entfaltet. Diese Fähigkeit zu farbiger Detailzeichnung und vorwärtstreibender Melodik zeichnen die Aufnahme aus, in der Ewa Tracz eine typgenaue lyrisch pralle Zosia ist und Matheus Pompeu einen agilen, italienisch timbriert eleganten Franek singt. Mit hellem Bass und verschmitzter Lockerheit gibt Wojtek Gierlach den Ex-Soldaten Szóstak, im Duett mit dem kraftstrotzenden Bariton Mariusz Godlewski als Jakub setzen sich die Männerstimmen gut voneinander ab. Aleksander Teligas (Antoni) grober Bass besitzt Wiedererkennungswert, und Pawel Cichoński setzt mit seinem liebeswerten Tenor als Flößer Feliks kleine Akzente (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei https://www.note1-music.com/shop/.). Rolf Fath
„Or che l’alma riscaldata da l’ingarico liquore“ klingt uns doch gleich viel gefälliger als das konsonantenreich sperrige „Niechaj zvje para mloda Przy zareczyn tych obrzedzie!“ mit dem Dziemba, der jetzt Gema heißt, die Ballgäste auf Stolniks Schloss begrüßt. Bei einer Polonaise feiern sie die Verlobung von Stolniks Sohn Janusz mit Zofia bzw. Giannis mit Sofia, derweil die Leibeigene Halka, die vom Adelsspross ein Kind erwartet, ihr Schicksal beklagt. Fabio Biondi, der erst kürzlich seinen in Warschau entstandenen Ur-Macbeth vorlegte, hat es sich in der polnischen Hauptstadt offenbar gemütlich eingerichtet und bei Konzertaufführungen im August 2018 gleich nach den Sternen gegriffen. Sprich nach Polens Nationaloper Halka, die am Teatr Wielki 2011 immerhin auch einen renommierten Kollegen wie Marc Minkowski gereizt hatte.

Eine überraschende Fassung: „Halka“ in Italienisch unter Fabio Biondi
Doch Biondi legt uns quasi eine neue Oper vor: die italienische Fassung der Halka in der Übersetzung des Moniuszko-Freundes Giuseppe Achille Bonoldi (1821-71), über den wir im Text der üppig gestalteten Ausgabe mit dem über 200seitigen Text (pol., engl) und Libretto (poln., ital., engl.) fast nichts erfahren (F.-Chopin-Institut b2 CD NIFCCD 082-083). Immerhin weist der Text ohne Nennung des Übersetzers auf die italienische Erstaufführung 1905 in Mailand hin, wie auch Loewenbergs „Annals of Opera“, die zudem Bonoldi als Übersetzer verzeichnen. Ob die im Text dieser vom Chopin Institut herausgegebenen CD-Ausgabe auch genannte Aufführung 1888 in Ferrara ebenfalls in Bonoldis italienischer bald nach dem enormen Erfolg der Warschauer Aufführung von 1858 erschienenen Übersetzung erklang, bleibt unklar. Warum diese Nationaloper, dieses Monument polnischer Identität, in Italienisch???
Giuseppe Achille Bonoldi, bzw. Józef Achilles Bonoldi (1821-1871), war ein polonisierter Italiener, der sich 1842 in Vilnius niedergelassen hatte, ein Multitalent als Sänger, Autor und Fotograf, dazu politisch aktiv im demokratischen Flügel der Aufständischen, Mitglied im litauischen Provinzkomitee und nach dem zweiten polnisch-litauischen Aufstand 1863 Mitglied in der provisorischen Provinzregierung von Litauen. Zudem engagierte er sich in der Pariser Kommune. Der Fotograf Bonoldi ist im litauischen Nationalmuseum in Vilnius vertreten, wo seine frühen Fotografien, Daguerreotypen und Ambrotypen, zu den wertvollen Dokumenten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehören, darunter das Porträt des Widerstandskämpfers Konstantinas Kalinauskas.

Librettist der „Halka“ Moniuszkos und dessen Freund, , Freiheitskämpfer, Dichter, Sänger, Patriot: G. B. Bonoldi 1863/ Wiki
Bonoldi war der rechte Mann für die Oper, deren politisch patriotische Sprengkraft ihm am Herzen gelegen haben muss und mit der aufs engste durch die erste Privataufführung 1848 in Vilnius vertraut war, bei der er die Baritonpartie des Jontek sang. Später hatte Moniuszko entweder bereits für eine weitere Aufführung in Vilnius 1854 oder für die auf vier Akte umgestaltete Zweitfassung von 1857, die am 1.1.1858 am Teatr Wielki herauskam, die Rolle für Tenor umgeschrieben. Für die heute gespielte Fassung von 1857 entstand auch die Mazurka am Schluss des 1. Akts sowie die Tänze der Goralen im dritten Akt, für den Sänger des Stolnik Wilhelm Troschel die Polonaise-Arie im ersten Akt und für den Tenor Julian Dobrski die Dumka in der zweiten Szene des 4. Aktes; die Sopranistin Paulina Rivoli erhielt, offenbar als Dank dafür, dass sie sich bereitfand, den einfachen Kittel eines Dorfmädchen anstelle der gewohnten Primadonnenrobe überzuziehen, eine zusätzliche Arie zu Beginn des zweiten Aktes.
„Mio caro bene, or son beata“ jubelt Halka, die immer noch an die Liebe Giannis glaubt. Tina Gorina singt das mit einem kindlich harten, fast harsch durchdringenden Sopran und einem klagenden Einheitston, der zunehmend enerviert, so dass Giannis Zögern fast verständlich erscheint. Auch in ihrer Arie am Ende des ersten Aktes, in der sie immer wieder vom „Cielo azzurro“ singt, entwickelt Gorina bei einer gewissen Brillanz in der Höhe keine Wärme. Aber die Verdienste der im Rahmen des Festivals Chopin and his Europa erstellten Ersteinspielung auf historischen Instrumenten liegen ohnehin auf der Fassung, die möglicherweise seinerzeit zu einer gewissen Verbreitung des Werkes in der internationalen Sprache der Oper beitrug und auch heute noch von nicht unwesentlichem Reiz ist. Zusammen mit dem Orchester Europa Galante wirft sich Fabio Biondi mit Feuereifer in die Nationaloper, die nicht nur am Anfang der neueren polnischen Oper steht, sondern mit ihrer Konfrontation höfischer Musik, Polonaise und Mazurka, und der Musik aus dem Karpatenkreis, genauer der Goralen, die hier etwas unpräzise als „Danza di montanari“ bezeichnet werden, auch lokale und gesellschaftliche Gegensätze aufzeigt. Gerade diese tänzerischen Elemente sind von mitreißender Kraft und Lebendigkeit und bilden den dramatisch zugespitzten Hintergrund zu dieser Geschichte einer verführten Unschuld, die Biondi mit geradezu realistischer, veristischer Sogkraft versieht.
Genannt werden muss unter den Sängern unbedingt Matheus Pompeu als Halkas Freund, der seinen Namen Jontek auch in der italienischen Fassung behalten darf. Der brasilianische Tenor singt mit fescher jungmännlicher Emphase und Leidenschaft, schönem Ton, und er ist im Duett mit Robert Gierlachs Gianni diesem an Feuer und Tonschönheit deutlich überlegen. Monika Ledzion-Porczynska als lyrisch-klare Sofia, Rafal Siwek als Alberto/ Stolnik und Karol Kolowskis Giovanotto runden das Ensemble ab, das durch den Podlasie Opera and Philharmonic Choir eine deutliche Aufwertung erfährt. Eine in vokaler Hinsicht unerhebliche, doch musikalisch destotrotz mitreißende neue“ Halka, von der es ohnehin nicht viele Einspielungen gibt.

„Straszny dwor“: der Mitschnitt des Konzertes in 2018 in Danzig bei Dux
Sind die höfischen und Volkstänze in Halka dramaturgisch motiviert, wirken sie in Moniuszkos komischer Oper Das Gespensterschloss/ Straszny dwór wie austauschbare Versatzstücke. Die zur Wiedereröffnung der Nationaloper 1865 entstandene Oper erzählt von den Brüdern Stefan und Zbigniew, die schwören sich als Junggesellen ganz in den Dienst des Vaterlandes zu stellen. Das Gelübde wird hinfällig, als sie zur Eintreibung von Schulden auf das Schloss des Marschalls von Kalinowa geraten und dessen Töchter Hanna und Jadwiga kennenlernen. Das tatsächliche Herrenhaus von Kalinowa gilt heute noch als Inbegriff des alten Polen. Die in Polen auch heute noch unvermindert populäre Oper entwarf ein Idealbild Polens, das mit der Realität wenig zu tun hatte, weshalb sie von der Zensur rasch verboten, aber im 20. Jahrhundert umso stärker als Beschwörung polnischer Kultur und Tugenden gefeiert wurde. Die von Walerian Bierdiajew dirigierte Aufführung 1953 in Posen gilt als erste bedeutende Opernproduktion der Nachkriegszeit. Sie liegt nun wieder auf CD vor (Naxos 8.111391-92) und ergänzt neben dem Konzertmitschnitt aus dem Mai 2018 aus Gdansk/ Danzig unter Zygmunt Rychert (Dux 1500/1501) die vorhandenen Aufnahmen unter Jan Krentz und Jacek Kaspszyk. Kein Libretto bei Naxos (8.111391-92), was man nicht erwartet, aber bedauerlicherweise auch keines bei Dux, stattdessen seitenlange Bios der Sänger. In seinen gemütvollen Szenen und Schilderungen erinnert das Gespensterschloss an Smetanas Das Geheimnis, Der Kuss und Zwei Witwen, und den gleichen Ton aus musikalischer Vertrautheit, gestischer Stimmigkeit und szenischer Lebendigkeit, den wir in älteren tschechischen Aufnahmen unter Kosler und Krombolc – oder im Fall der Verkauften Braut unter Chalabala und Ancerl – antreffen, finden wir auch auf den 1953 und 1954 entstandenen Aufnahmen aus Posen. Hier stimmen die Figuren, sitzen die gemütvolle wie pfiffigen Konversationsszenen wie die Pointen in einer guten Boulevardkomödie. Hier stehen keine Stars an der Rampe, sondern werfen sich Singdarsteller die Bälle zu, agieren mit schauspielerischer Bewegtheit, Natürlichkeit und Lockerheit. Die Figuren erhalten Gesicht, sind, getragen von Bierdiajews Theaterverve und dem füllig mitreißenden Orchesterpart, pralle Figuren und liebenswerte Typen, darunter der gewaltige Bass Zgymunt Marianski als Kammerdiener Macieij und der robuste Marian Woznieczko, welcher als Herr auf Kalinowa den jungen Männern in seiner patriotischen Ansprache das Idealbild eines polnischen Bürgers entwirft. Der bekannteste Name ist Bogdan Paprocki (1919-2010), der ab 1957 drei Jahrzehnte an der Warschauer Nationaloper wirkte, 250 mal als Stefan im Gespensterschloss auf der Bühne stand und in seiner Arie vom Glockenspiel viel Poesie entfaltet, dazu eine französische und italienische Lustspielleichtigkeit à la Auber und Rossini, die in der Arie zu Beginn des vierten Aktes wiederkehrt, wo Barbara Kostrzewska eine geschmackvoll liebenswerte Hanna ist. Als sein Bruder Zbigniew wirkt der ein Jahr jüngere Edmund Kossowski wie sein wesentlich älterer Bruder, Hannas Schwester wird von Felicija Kurowiak aufmüpfig verkörpert; Antonia Kawecka macht aus der Tante eine profunde Nebenfigur. Ab der das Finale einleitenden Mazurka ist kein Halten mehr.

Endlich wieder da: die alte Muza-Aufnahme von 1953 erstmals als CD nun bei Naxos, Danke! Und jetzt noch bitte die alte Halka aus derselben Ecke!!!
Die Sänger in Gdansk, die ihre Aufgaben allesamt ordentlich erfüllen, reichen an diese Leistungen nicht heran. Keinem Vergleich mit Marianski und Henryk Lukaszek, welche die Episode zu Beginn des dritten Aktes zwischen dem Beschließer auf Kalinowa und Maciej bildlich suggestiv gestalten, halten beispielsweise Krzysztof Bobrecki und Piotr Lempa stand. Aber die 75jährige Stefania Toczyska, die in den 1980er und 90er Jahren von Wien bis New York als Amneris, Eboli, Azucena oder Carmen geschätzte Mezzosopranistin, lässt sich ihr Alter nicht anmerken und macht sich ein Vergnügen aus der Partie der alten Truchsessin und Tante, die sie mit Leidenschaft an sich reißt; ein Vergnügen auch für den Hörer. Das Symphony Orchestra der Stanislaw Moniuszko Academy of Music spielt eleganter als die Posener, Rychert verfügt auch über hinreichend Theatererfahrung, um diese polnischste aller polnischen Oper zur melodiensatten Wirkung zu bringen, doch die ältere Aufnahme möchte ich schon jetzt nicht missen (Foto oben: „Straszny Dwór“ in Dąbrowa Górnicza 2015 – Foto Tomasz Zakrzewski) . Rolf Fath
Zum Moniszko-Jahr 2019 passte auch das neue Buch von Rüdiger Ritter, das sich als eines der wenigen in deutscher Sprache mit dem wichtigsten Komponisten unseres Nachbarlandes beschäftigt (als Folge seiner Dissertation im Peter Lang Verlag, 2005, ISBN 3-631-52829-9; s. auch operalounge.de anlässlich der Besprechung von Moniuszkos Oper Paria).
Nicht nur polnische Kulturgeschichte: Nach 1945 war es für ostdeutsche Opernhäuser Ehrensache und selbst- oder fremdauferlegte Pflicht, Stanislav Moniuszkos Oper Halka aufzuführen, im Westen war das Werk so gut wie unbekannt (eine Ehrenposition nimmt die deutschgesungene konzertante Halka beim damaligen SFB Berlin während der Ägide von Einhard Luther 1994 ein). Nach der Wiedervereinigung vergaß man auch in den neuen Bundesländern beinahe seine Existenz. Seine Markenzeichen, sozialkritisch und zugleich Nationaloper des sozialistischen Brudervolks Polen, waren kein Anreiz mehr dafür, Halka auf den Spielplan zu setzen. In Polen aber erfreut sich das Drama um das von einem Adligen betrogene Bauernmädchen weiterhin ungebrochener Beliebtheit, erst 2018 gab es in Breslau wieder eine Premiere, während in Warschau unter Biondi eine italienische Version ausgegraben wurde (s. oben)..
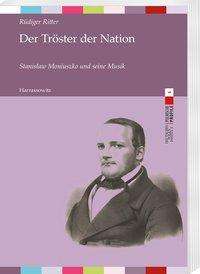
Rüdiger Ritters Buch, „Moniuszko – Tröster der Nation“, im Harassowitz Verlag
Als den Tröster der Nation, so auch der Titel seines Buches, sieht Rüdiger Ritter den Komponisten, den nicht nur die Polen, sondern auch Weißrussen und Litauer als einen der Ihren ansehen. So befasst sich eines der interessantesten Kapitel des Buches mit der oft tragischen Geschichte unseres Nachbarlandes, gekennzeichnet durch mehrfache Teilung unter die angrenzenden Großmächte, durch die gemeinsame Vergangenheit mit Litauen (Moniuszko wurde in der Näher von Minsk geboren, lebte lange Zeit in Wilna) und den verzweifelten Kampf des unter russischer Herrschaft stehenden Teils, seine nationale Identität zu wahren. Halka oder vielmehr die vieraktige, in Warschau uraufgeführte Fassung des vielen Änderungen unterzogenen Werks bezieht daher seine Wertschätzung nicht nur aus der vom Autor immer wieder betonten Schönheit der Musik, sondern auch aus seinem volkstümlichen Charakter, u.a. durch die Präsenz von Mazurka und Polonaise, typisch polnischer Tänze.
Von Anfang bis Schluss und mittendrin als umfangreiches Kapitel ist Halka präsent, ist dem Autor wohl so vertraut, dass er nicht, wie mit anderen Werken wie Das Gespensterschloss mit Gewinn für den Leser eine Inhaltsangabe bietet, sondern voraussetzt, dass man das Werk kennt. Allerdings werden Teile der Handlung innerhalb des Textes erwähnt, so dass man sich aus den Mosaiksteinchen ein Gesamtbild konstruieren kann, auch gibt es sehr viele aufschlussreiche Notenbeispiele und eine Analyse der Musik, die die Vielseitigkeit des Autors unter Beweis stellt.
Ein erheblicher Teil des Buches wird dem Lebensweg des polnischen Komponisten gewidmet, der von Adelsstolz wie Armut gleichermaßen geprägten Familie, dem Studium in Warschau und Berlin, den beiden vergeblichen Reisen nach Paris, wo er wie Wagner nicht recht Fuß fassen konnte. Zwischen den Einflüssen deutscher und russischer Musik weiß er sich als polnischer Komponist zu behaupten, befasst sich fast ausschließlich mit Vokalmusik, besonders Liedern, Kantaten und neben den beiden bekanntesten auch noch weiteren Opern. Der Leser gewinnt einen umfassenden Einblick in das polnische Kulturleben, das eine Art Klammer zwischen den verschiedenen Teilen des unter fremder Herrschaft stehenden Landes darstellt, in den Kampf um den Lebensunterhalt für eine schnell wachsende Familie, sei es als Komponist, Organist, Operndirektor oder Lehrer.
Die Rolle der Salondamen im polnischen oder Pariser Kulturleben wird ebenso beleuchtet wie der Kampf Moniuszkos um die Aufmerksamkeit Rossinis, der Einsatz Smetanas für Halka in Prag, die slawophilen Züge bei Moniuszko, die so ausgeprägt wohl nicht waren, wie sie eine spätere Geschichtsschreibung wahrzunehmen glaubte. So bleibt auch dem polnischen Komponisten nicht erspart, dass die Nachwelt ihm andichtet, was er in dieser Form nicht vertrat.
Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der Halka, ihre Verwandtschaft mit Aubers La Muette de Portici, ein Vergleich der einzelnen Fassungen, der Versuch der Instrumentalisierung zur Schaffung eines nationalen Mythos- das Buch, das das erste deutschsprachige über den Komponisten ist, gewährt einen umfassenden und interessanten, dazu noch gut weil flüssig geschriebenen Einblick in ein Kapitel nicht nur polnischer, sondern europäischer Kulturgeschichte (Harrassowitz Verlag 2019, 256 Seiten, ISBN 978 3 447 11109 6). Ingrid Wanja
Hochromantisch: Passend zum Jubiläumsjahr von Stanislaw Moniuszko (1819 – 1872) gibt es als Weltpremiere eine im Nationale Forum für Musik (NFM) in Breslau entstandene, gelungene Aufnahme der weltlichen Kantate Widma (Die Geister). Diese „Lyrischen Szenen“, komponiert in der Zeit von 1852-1859, stehen wie andere seiner Kantaten im Schatten der bekannten Opern „Halka“ oder Straszny dwór (Das Geisterschloss). Moniuszko hat in der 1865 in Warschau uraufgeführten „Lyrischen Kantate“ für Solostimmen, gemischten Chor und Orchester einen Text des führenden Schriftstellers der polnischen Romantik Adam Mickiewicz aus dessen Dramenzyklus Dziady (Totenfeier) vertont. Dieses umfangreiche Werk, dem nur ein kleiner Teil entnommen ist, gilt als eines seiner bedeutendsten Werke und der polnischen Literatur überhaupt.
Wie in seinen Opern verwendet Moniuszko, der als Polens „Nationalkomponist“ gilt, übrigens auch in „Widma“ polnische Tänze wie Polonaise und Mazurka sowie Melodien der polnischen Folklore. Vielfältige Aufgaben hat bei der „Totenfeier“ der Chor, die der NFM-Chor, einstudiert von Agnieszka Franków-Zelazny, mit Klangpracht und Ausgewogenheit aller Stimmgruppen erfüllt. Mit Prägnanz leitet Andrzej Kosendiak das Wroclaw Baroque Orchestra, das eine gute Grundlage für die durchweg polnischen Sänger und Sängerinnen bildet. Mit farbenreicher, sicher durch alle Lagen geführter Stimme beeindruckt der polnische Bassbariton Jaroslaw Brek in der Hauptpartie des Guslarz, der die Totenfeier in einer Person als Priester und Barde leitet. Einen grimmigen Geist, der gern Kinder erschreckt und seine Höllenqualen bejammert, gibt Jerzy Butryn mit hell timbriertem Bassbariton. Der ausdrucksstark gesungene Chor der nächtlichen Vögel kontrastiert zu den Sprechtexten von Rabe und Eule. Aleksandra Kubas-Kruk als früh verstorbene junge Frau Zosia präsentiert ein hübsches Liedchen mit guter Intonation. Neben einigen Chorsolisten in kleineren Rollen bereichern zwei Knabensoprane als „kleine Engel“ die Klangvielfalt der hochromantischen Komposition (F.-Chopin-Institut NFM 47 – ACD 243-2) (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei https://www.note1-music.com/shop/.). Gerhard Eckels







 Das wäre damals das passende Mitbringsel gewesen. In der letzten Stunde des Musikkritik-Seminars an der Wiener Uni vor den Ferien brachte jeder etwas möglichst Unbekanntes auf Tonträgern mit. Und alle, inklusive unseres Professors, sollten aus dem knisternden Zeugs Epoche, Komponisten, möglichst auch das Werk erraten. In Zeiten, da nicht nahezu alles auf irgendwelchen Quellen ständig greifbar war, bedeutete das eine nicht geringe Herausforderung. Nun hören wir ein geschmackvolles Preludio. Zwei Krieger unterhalten sich auf
Das wäre damals das passende Mitbringsel gewesen. In der letzten Stunde des Musikkritik-Seminars an der Wiener Uni vor den Ferien brachte jeder etwas möglichst Unbekanntes auf Tonträgern mit. Und alle, inklusive unseres Professors, sollten aus dem knisternden Zeugs Epoche, Komponisten, möglichst auch das Werk erraten. In Zeiten, da nicht nahezu alles auf irgendwelchen Quellen ständig greifbar war, bedeutete das eine nicht geringe Herausforderung. Nun hören wir ein geschmackvolles Preludio. Zwei Krieger unterhalten sich auf  An den Ufern der Weichsel: Der
An den Ufern der Weichsel: Der 



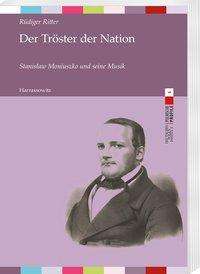







 Zum 90. Geburtstag Christa LKudwigs gab es ein Buch im Wiener Amalthea Verlag:
Zum 90. Geburtstag Christa LKudwigs gab es ein Buch im Wiener Amalthea Verlag:




 Es gab Rollen, die Corelli vor allem deswegen sang, weil sie ihn von ihrem Charakter her ansprachen, zum Beispiel Roméo, dessen romantischer Welt er sich nahe fühlte. Andere haben ihn wegen der vokalen Schwierigkeiten gereizt, aber alle wurden gesungen
Es gab Rollen, die Corelli vor allem deswegen sang, weil sie ihn von ihrem Charakter her ansprachen, zum Beispiel Roméo, dessen romantischer Welt er sich nahe fühlte. Andere haben ihn wegen der vokalen Schwierigkeiten gereizt, aber alle wurden gesungen





 Die Biografie
Die Biografie 







 Und eine
Und eine 