.
Am Theater Zwickau-Plauen gab es Anfang Mai 2004 eine nicht geringe Sensation: eine Nibelungen-Oper aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, noch vor Wagners Ring, dessen Libretto vom Komponisten nur ein Jahr zuvor im Druck erschienen war. Für jeden Freund der deutschen romantischen Oper ein Muss, war diese Ausgrabung wieder einmal dem rührigen Intendanten lngolf Huhn zu verdanken, der bereits in Freiberg-Döbeln mit diesem Genre überregionale Aufmerksamkeit erregt hatte (so der Rattenfänger von Hameln von Nessler) und später in Annaberg-Buchholz mit Opern von Goldmark und anderen überraschte – wir hatten in operalounge.de über Ingolf Huhn und seine hochverdienstvolle Arbeit als Intendant berichtet.

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen“: Gruppenfoto von August Kotsch 1871 mit Heinrich Dorn rechts stehend/ Wiki
Eine Oper wie Heinrich Dorns Nibelungen ist heute absolut vergessen, nur der Titel hat für wenige Kenner überlebt (neben Gades Versuch an diesem Stoff und manchen Balladen der vaterländischen Zeit – 1827 erschien erstmals die neuhochdeutschen Übersetzung von Karl von Simrock des mittelalterlichen Nibelungenliedes von ca. 1200 mit zahlreichen Illustrationen von Julius Schnorr von Carolsfeld und Eugen Neureuther; 1861 kam Hebbels Drama heruas). Nach den Sechzigern des 19. Jahrhunderts hat man keine Note mehr davon gehört, wenngleich zwei Ohrwürmer daraus noch lange in „deutschen Gauen“ von Männer-Chören gesungen wurden. Die Einschätzung der Musik bleibt auch nach dem erneuten Hören schwierig. Gewiss, nicht alles ist große Musik, wenngleich niemand Geringerer als Franz Liszt die Uraufführung in Weimar 1854 betrieb. Manches in dieser Oper ist – wie lngolf Huhn zugab – „nur“ Kapellmeistermusik, zwar professionell orchestriert, aber auch gelegentlich eher Füllmasse. Und nicht immer sind die sehr anspruchsvollen Chöre mehr als große Liedertafelmusik, gerne auch in Parallelführung gehalten.
Aber andere Passagen weisen außerordentlich stimmungsvolle Szenen auf, mit dichter, sowohl erfolgreich martialischer wie auch lyrischer Atmosphäre, z. B. wenn sich die Liebenden (in Akt 3) zu einer sehnsuchtsvoll-zärtlichen Streichermelodie trennen und sich ewige Treue schwören, wenn Siegfried am Bach (dto.) ein liedhaftes Solo schmettert, das unverkennbar auf Schumann und das deutsche Lied hinweist, wenn sich „deutsche“ Schwerter gegen miese Hunnenhorden erheben (Akt 4) oder wenn sich Schwertmaiden empört-frustriert über den Verlust ihrer unbesiegbaren Unabhängigkeit beklagen (Akt 1) – zum Teil in abenteuerlichen Reimen (etwa: „Soweit des Wächters Blicke reichen – der Strand bedeckt mit Trümmern und mit Leichen„, oder auch: „Der Sonne Strahl in Purpur glüht, das Schiff die See durchzieht. Hinab, hinab des Ankers Last, die Ruder fort, das Tau erfasst!“). Dies alles in fünf Akten der Großen Oper á la Meyerbeer mit starken Anklängen an Weber (Euryanthe!), Spohr und Marschner, aber auch an Italiener der Zeit und selbst an Wagner, den man in manchen Moment nicht nur in der Dramaturgie vorweggenommen sieht.

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen“: Szene aus der Plauener Aufführung 2004/ Foto Peter Awtukowitsch
Nicht nur die Orchestrierung und Chorführung sind von einiger Schwierigkeit, auch die Solopartien liegen anspruchsvoll. Die vier Männer-Protagonisten Günther/Tenor, Siegfried/Bariton, Hagen und Etzel/Bässe stammen aus dem üblichen Personal der großen romantischen Oper eines Weber oder Marschner. Die beiden Frauengestalten sind mit Eglantine und Euryanthe verwandt – natürlich auch mit Elsa und Ortrud, zumal die extrem weitreichende Brunhild für Wagners Nichte Johanna konzipiert wurde. In Erinnerung bleiben nach der Aufführung in Plauen die Auftrittsszenen der beiden Frauen, die wunderbaren Duette Brunhild-Chriemhild sowie Siegfried-Hagen und das machtvolle Terzett beim Planen von Siegfrieds Tod. Das Solo Siegfrieds vor seiner Ermordung gehört ebenfalls zu den Höhepunkten der Oper, die es gelegentlich am großen lyrischen Bogen und an erinnerbaren Melodien fehlen lassen mag, die aber als Möglichkeit einer Großen Deutschen Oper dieses Sujets vor Wagner ihre Bedeutung hat. Was aus der deutschen Oper ohne Wagner geworden wäre – hier wird es demonstriert. G. H.
.
.
Heinrich Dorn und Richard Wagner, Leipzig 1830.Man kannte sich aus jungen Jahren. Dorn, Kapellmeister am Leipziger Theater, führte erste Kompositionen des siebzehnjährigen Wagner auf, der ihm als „ein wahrer teutonicus“ erschien und „kraftvolle Schösslinge zu treiben versprach“. Die Uraufführung einer Wagnerschen Ouvertüre in B-Dur am 24. Dezember 1830 zeitigte eine unfreiwillig komische Wirkung. „Sie barg“ zwar, wie Dorn sich später erinnerte,“in sich bereits die Keime all‘ der großen Effekte, welche später die ganze musikalische Welt aufregen sollten, ohne aber selbst irgend einen andern Effekt hervorzubringen als den der absolutesten Verwunderung“. Und Wagner vermutete dann, wohl nicht zu Unrecht, dass Dorn „sich habe einen Spaß machen wollen“; einen „sich alle vier Takte wiederholenden Paukenschlag nämlich“ zog Dorn an das helle Licht und bestand darauf, „dass der Musiker ihn stets mit der vorgeschriebenen Stärke zur Ausführung brächte“, – das Resultat war ein sich stets steigernder Lacherfolg beim Publikum.

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen“: Hans Feodor und Rosa von Milde: die Protagnisten der Weimarer Uraufführung/ Foto OBA
Riga 1837. Man traf sich wieder. Dorn war städtischer Musikdirektor, Wagner wurde Kapellmeister am Theater und studierte ein Jahr später Dorns Oper Der Schöffe von Paris ein. „Wenn er am Pult stand“, schrieb Dorn später, „riss sein feuriges Temperament auch die ältesten Orchestermitglieder unbedingt fort. ‚Immer frisch, immer munter, immer ein bißchen frisch‘, das waren seine Lieblingsrufe“. (…) Auch wenn er Wagners neuen Kompositionen „Beethovensche Durchführung – schöne Gedanken – hochmodernes Außenwerk“ bescheinigt, bleibt doch ironische Distanz. Dass dann Dorn Wagners Flucht aus Riga unterstützt, um – so sah es Wagner – selbst dessen Position einzunehmen, vergiftet beider bis dahin durchaus freundschaftlich-kollegiales Verhältnis. Dennoch war es Dorn, der 1843, nur wenige Monate nach der Dresdner Uraufführung, erstmals Wagners Fliegenden Holländer in Riga einstudierte und der 1856 die Berliner Erstaufführung des Tannhäuser dirigierte.
München 1865. Man begegnet sich nach langen Jahren erneut. Dorn reiste nach München zur denkwürdigen Uraufführung von Wagners Tristan und lsolde. Unbefangen meldet er sich in Wagners Haus zum Besuch an. Wagner ist unangenehm berührt. Über den Tristan hat Dorn dann wenig Rühmenswertes zu berichten. Er apostrophiert die „Ungeheuerlichkeit der Tondichtung“, fragt: „Ist das Poesie? Ist das deutsch? Hat das überhaupt einen Sinn?“, um schließlich zu resümieren: „Das ist die ‚höhere Katzenmusik‘.“

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen“: Szene aus der Plauener Aufführung 2004/ Foto Peter Awtukowitsch
Inzwischen hatte allerdings ein für beide Komponisten entscheidendes künstlerisches Ereignis stattgefunden – die Begegnung mit dem Nibelungen-Stoff, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Philologen, Dichtern, Malern und Musikern für so viel Aufregung gesorgt hatte. Gänzlich unabhängig voneinander und doch fast zeitgleich gestalteten Dorn und Wagner die Nibelungen als Opernstoff. Franz Liszt, der eigentlich Wagners (noch nicht komponierten) Siegfried in Weimar herausbringen wollte, führte statt dessen Dorns Oper Die Nibelungen am 22. Januar 1854 auf (obwohl er das Werk als einer zur „Neige gehenden Stilart“ zugehörig empfand …). Nach Weimar und Berlin kam Dorns Oper noch in Wien, Königsberg, Breslau, Stettin und Sondershausen auf die Bühne. Ein durchaus achtenswerter Zeiterfolg also (wenn auch dann bis auf den heutigen Tag keine weiteren Einstudierungen mehr folgten).
.
Dorn hatte im Nibelungen-Stoff „das interessanteste tragische Opernbuch, welches die deutsche Bühne der Neuzeit aufzuweisen hat“, gesehen und befand sich damit in repräsentativer geistiger Gesellschaft. Er komponierte den Stoff im Rahmen der musikalischen Zeitmode, im Stil der vornehmlich von Meyerbeer geprägten Grand Opéra, zugleich Traditionen der deutschen romantischen Oper aufgreifend. (…)
.
Über Wagners Ring weiß sich Dorn nur ablehnend zu äußern, und darin steckt gewiss auch ein verletztes Konkurrenzempfinden, waren seine eigenen Nibelungen doch bereits seit Anfang der 60er Jahre in Vergessenheit geraten. Dorn moniert beispielsweise ausgesprochen national-konservativ (und erahnt ganz richtig Wagners sozial-anarchistische Grundhaltung), „dass Wagners Tetralogie … nach dem Sagenkreis der isländischen Edda und den Fabeln der nordischen Mythologie, aber ganz ohne Rücksicht auf das altdeutsche Heldengedicht gearbeitet ist“. (…) Er kritisiert den „durchaus fremden Stoff, der schon seiner entsetzlichen Rohheit wegen niemals national werden kann. … Wenn solche Darstellungen vorzugsweise ‚deutsch‘ sein sollen, dann dürfen sie wenigstens keinen Anspruch auf das Prädicat ‚künstlerisch‘ machen, und dann würde es auch besser sein, sie wären nicht deutsch … Der Bayreuther Siegfried ist ein Sohn der wissentlich blutschänderischen Umarmung (und in diesem ‚wissentlich‘ liegt das Scheußliche) Siegmund’s des Wälsung und dessen ehebrecherischer Schwester Sieglinde, geborne Wälsung, verheirathete Hunding. … Im Uebrigen sind Wagner’s Nibelungen ein Nationaldrama für Island, und dort würde auch das Moos nicht fehlen.“

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen: Hagen tötet Siegfried an der Quelle/ Schnorr von Carolsfelds Fresko in der Münchner Residenz/ Wiki
1879 fordert Dorn in einem Aufsatz „Gesetzgebung und Operntext“ gar, Wagners Ring dem soeben von Bismarck erlassenen „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ zu unterwerfen. Verständlich nur, dass auch Wagner gegen Dorn zu Felde zog, wenn auch weit weniger drakonisch. (…) Zwei Musiker – ein Stoff: persönliche Haltungen und künstlerische Ansichten mussten naturgemäß aufeinanderprallen, zumal das Sujet so auffällig ins Zentrum des deutschen Nationalbewusstseins gerückt war. Die Auswirkungen konnten unterschiedlicher nicht sein: Wagners Ring bis heute dominant und allgegenwärtig im Musiktheater, Dorns Nibelungen hingegen seit langem vergessen. Schon darum lohnt eine Wiederbegegnung mit diesem Werk. Eckart Kröplin
.
.
Die Nibelungen: Große Oper in 5 Akten von Heinrich Dorn; Libretto von Eduard Gerber nach der Tragödie „Der Nibelungen-Hort“ (1828) von Ernst Benjamin Salomon Raupach; UA: 22. Januar 1854 am Hoftheater Weimar durch Franz Liszt, Berliner Erstaufführung am 27. März 1854 an der Hofoper, weitere Aufführungen bis in die 60er Jahre in Königsberg, Breslau, Wien , Stettin und Sondershausen. Erstaufführung in moderner Zeit am 8. Mai am Theater Plauen-Zwickau durch lngolf Huhn; Bühne/ Kostüme Marie-Luise Strandt. Zu den Solisten gehörten Judith Schubert, Maria Gessler, Martin Kronthaler, Michael Simmen, Hagen Erkrath, Guido Hackhausen und andere; Georg Christoph Sandmann dirigierte das Philharmonische Orchester Plauen-Zwickau.

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen“: Heinrich Salomon sang den Hagen in der Uraufführung/ Wiki
Personen: Brunhild, Königin von lsenland – Mezzosopran, Chriemhild, Schwester des Burgunderkönigs Günther – Sopran, Günther, König – Tenor, Siegfried, Thronerbe von Niederland und sein Freund – Bariton, Hagen von Tronegge, Vasall Günthers – Baß, Etzel, König der Hunnen – Baß, Herold der Königin – Tenor, Marschall Dankwart – Baß, Volker von Alzei – Tenor, Ein hunnischer Krieger – Tenor; Ritter, Burgunder, Walküren , Hunnen; Ort/Zeit: Europa um 400 n. Chr.
.
Inhalt 1. Akt: Auf lsenland am Hof der Königin Brunhild. Der Burgunderkönig Günther kommt mit Gefolge und seinem Freund Siegfried, um die amazonenhafte Königin Brunhild zu freien. Angesichts ihres Rufes der notorischen Körperstärke, der sich die Freier aussetzen müssen, wird er ängstlich. Da kommt ihm das Angebot seines Freundes, für ihn einzuspringen, gerade recht. Siegfried hat – wie er beiläufig singt – einst einen Drachen erschlagen und ihm einen Tarnhelm abgenommen. Diesen setzt er nun ein, besiegt Brunhild und entwendet ihr einen Ring, den er später seiner Braut Chriemhild schenkt, die er sich als Preis für den Einsatz ausbedungen hatte. Brunhild zieht besiegt mit den Nibelungen ab nach Burgund.
2. Akt: In Worms am Hofe Günthers, zwei Jahre danach. Natürlich kommt es zwischen Chriemhild und der von Liebe nicht gerade erfüllten Brunhild (die ihre Frustration nicht benennen kann) zum Streit, bei dem Chriemhild mit dem Ring des Siegfried (und Brunhilds) prahlt, weil Brunhild sie die Frau eines Vasallen schimpft. Entsetzt erkennt Brunhild die Zusammenhänge und fordert – mit ihrem Mann und Hagen allein – Rache für ihre Schande. Hagen sieht die Ehre des Hauses verletzt und verspricht dessen Tod, zumal Chriemhild ihm die verwundbare Stelle Siegfrieds am Rücken ausgeplaudert hatte. Außerdem soll Hagen den Nibelungenschatz an sich nehmen, den Siegfried verwahrt.
3. Akt. Wenige Tage später. Im ersten Teil nehmen Siegfried und seine Frau zärtlichen Abschied, Chriemhild ist durch einen düsteren Traum verstört und sucht vergebens, ihn von der Jagd abzuhalten. Sie eilt ihm in den Wald nach. Dort (im zweiten Teil) treffen Siegfried und Hagen aufeinander. Hagen spricht von verletzter Ehre und weist Siegfried zur nahen Quelle für einen Trunk. Wie auf den Bildern von Schnorr von Carolsfeld sticht er dem Knieenden den Speer in die Stelle, die das Lindenblatt beim Baden im Blut des Drachens hinterlassen hatte. Siegfrieds Tod rechtfertigt Hagen vor den versammelten Mannen, Chriemhilds Ruf nach Rache wird mit ihrer Verhöhnung durch Günther und Brunhild beantwortet. Da ertönt das Signal des Unterhändlers des Königs der Hunnen, Etzel. Chriemhild wittert ihre Chance zur Rache – Etzel hatte sie schon immer begehrt.

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen“: Illustration zu Simrocks hochdeutscher Erstausgabe 1827 von Schnorr von Carlosfeld/ OBA
4. Akt. Am Hofe Etzels, zehn Jahre später Sie ist die Frau Etzels unter der Bedingung geworden , dass dieser ihr beim Mord an ihrer Familie hilft. Sie hat die Burgunder zu Friedens-Verhandlungen nach Ungarn eingeladen. Alle sind gekommen, auch Brunhild und Hagen.
5. Akt: ebendort, am nächsten Morgen Alle bis auf Hagen sind abgeschlachtet, nur dieser leistet Widerstand und weigert sich, das Versteck des Nibelungenhortes zu verraten – er hat ihn im Rhein versenkt. Rasend erschlägt ihn Chriemhild und setzt die Halle in Brand, um sich anschließend selber zu erstechen. „Enden sollen all‘, bezwungen wie der Stamm der Nibelungen“.
.
.

Der Autor, der Musikwissenschaftler Eckardt Kröplin/EK
Eine Zeittafel: Heinrich Ludwig Egmont Dorn – Daten zu seinem Leben 1804: Am 14. November in Königsberg geboren; 1823 Beginn des Jurastudiums in Königsberg. In der Folgezeit Reisen nach Leipzig, Dresden (Bekanntschaft mit Weber) , Prag, Wien und Berlin. Hier Klavier- und Kompositionsschüler von Ludwig Berger, Carl Friedrich Zelter und Bernhard Klein; 1826 Uraufführung von Dorns Oper Rolands Knappen in Berlin; 1827 Uraufführung von Dorns Oper Der Zauberer und das Ungetüm in Berlin. Dorn geht als Kapellmeister an das Theater in Königsberg Uraufführung von Dorns Oper Die Bettlerin in Königsberg; 1827-1832 Dorn wirkt als Kapellmeister am Leipziger Theater. Robert Schumann ist Schüler von Dorn. Dorn bringt erste Werke des 17jährigen Richard Wagner zur Uraufführung; 1831 Uraufführung von Dorns Oper Abu Kara in Leipzig; 1832 Dorn wird Städtischer Musikdirektor in Riga; 1837 Richard Wagner kommt als Theaterkapellmeister nach Riga; 1838 Am 1. November in Riga Uraufführung von Dorns Oper Der Schöffe von Paris in Wagners Einstudierung und unter dem Dirigat von Dorn 1839 Dorn wird Nachfolger Wagners als Theaterkapellmeister in Riga 1841 Uraufführung von Dorns Oper Das Banner von England in Riga; 1843 Am 3. Juni Erstaufführung von Wagners Oper Der fliegende Holländer durch Dorn in Riga (erste Aufführung nach der Dresdner Uraufführung vom 2.1.1843); Dorn geht in der Nachfolge von Conradin Kreutzer als Theaterkapellmeister nach Köln; 1844 -1847 Dorn leitet die Niederrheinischen Musikfeste; 1845 Gründung der Rheinischen Musikschule in Köln durch Dorn (sie wurde dann unter Dorns Nachfolger Ferdinand Hiller Konservatorium); 1849 Dorn wird zum Königlichen Kapellmeister an der Berliner Hofoper berufen (als Nachfolger von Otto Nicolai); 1854 Am 22. Januar Uraufführung von Dorns Oper Die Nibelungen in Weimar durch Franz Liszt; Am 27. März Erstaufführung der Nibelungen an der Berliner Hofoper 1856 Am 7. Januar dirigiert Dorn die Berliner Erstaufführung von Wagners Tannhäuser; Uraufführung von Dorns Oper Ein Tag in Rußland in Berlin; 1865 Dorn reist nach München und nach Paris zu den Uraufführungen von Wagners Tristan und lsolde und Giacomo Meyerbeers Africaine; Uraufführung von Dorns Oper Der Botenläufer von Pirna in Berlin; 1869 Verleihung des Professorentitels und Pensionierung; 1879 Dorns Schmähschrift gegen Wagner „Gesetzgebung und Operntext“ erscheint 1892; Am 10. Januar stirbt Dorn in Berlin
.
.
Den Artikel von Eckart Kröplin, dem ehemaligen Chefdramaturgen des Theaters Zwickau-Plauen, Hochschul-Professor in Leipzig und renommierten Musikwissenschaftler, sowie die Zeittafel und die Inhaltsangaben entnahmen wir mit großem Dank an Professor Kröplin mit Kürzungen dem Programmheft zur Aufführung in Plauen und Zwickau 2004. Dank an Caroline Eschenbrenner vom Theater Zwickau-Plauen für die Fotos und ebenfalls Dank an Wolfgang Denker für die Archiv-Recherche. Einführung und Redaktion Geerd Heinsen.
.
.

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen“: Vogtlandtheater Plauen/ Theater Plauen
Dazu auch eine Original-Kritik zu der Plauener Aufführung am 8. Mai 2004 – Germanisches vor Wagner: Wie vielleicht die deutsche Opern-Welt ohne Wagner geklungen hätte, zeigte sich in Plauen am 8. 5. lngolf Huhn ist hier der neue (natürlich aus Freiberg-Döbeln bekannte ehemalige) Intendant mit dem besonderen Interesse am früheren neunzehnten Jahrhundert. Er führte, wie bereits u. a. mit Lortzings oder Nesslers Opern, wieder einmal vor, was wir alles nicht kennen. Für diesen erneuten Blick auf unsere eigene opern-kulturelle Vergangenheit kann man ihm nicht genug danken. Danken muss man ihm vor allem für die prächtig besetzte Ausgrabung der Nibelungen von Heinrich Dorn (1854 und damit weit vor Wagners „Ring „). Wer kennt den Namen noch? Nur der Opern-Titel geistert durch die Wagner-Rezeptionsgeschichte, denn Nibelungen vor Bayreuth? Der aus Berlin angereiste Besucher freute sich erst einmal über die hübsche Stadt Plauen mit ihren eindrucksvollen Jahrhundertwende-Häusern und großzügigen Straßen, dann aber auch über das kleine, elegante Opernhaus in Creme, Gold und Rot – ein geschmackvoll renoviertes Theater mit guter Akustik und liebenswürdiger Atmosphäre.
Und der Gast war auf die hohe Qualität der Aufführung von rund drei Stunden nicht vorbereitet – als Hauptstädter neigt man doch leider manchmal zu einer gewissen Hochmütigkeit gegenüber der „Provinz“, zumal in einem kleinen Haus, das sich nun aber als Hochleistungsträger entpuppte und schnöde Gedanken beschämte. Denn sowohl das Philharmonische Orchester unter dem rasanten jungen GMD Georg-Christian Sandmann wie auch der tapfere Chor (Eckehard Rösler) brauchten den Vergleich mit ranghöheren Theatern nicht zu scheuen. Hier wurde mit Liebe, mit Schmiss und mit vollem Einsatz musiziert. Sandmann hielt die Seinen zu brisken Tempi und zu knalligen Tutti an, ließ die meist parallel laufenden Stimmen in Chor und Orchester voll ausspielen und einen sonoren, romantischen Klang hören. Der sinnliche Streicherteppich zu Beginn des dritten Aktes, die martialischen Kampfszenen im vierten oder die schönen Ensembleszenen wie etwa zum Ende des zweiten Aktes evozierten dichte Stimmung und ein typisch „deutsches“ Idiom in der Rückschau auf Weber (Euryanthe) und Marschner (Templer), aber auch im Vorgriff auf Wagner selbst (Lohengrin, Tannhäuser, Holländer). Auch war es ein Gewinn, deutschsprachige Stimmen absolut wortverständlich und idiomatisch zu erleben (und die zwei Ausnahmen fügten sich unmerklich dem hinzu).

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen“: Szene aus der Plauener Aufführung 2004/ Foto Peter Awtukowitsch
Das Ensemble hätte nicht treffender sein können und lässt den Hut tief ziehen vor der sorgfältigen Auswahl und der Qualität! Drei wirklich sensationelle dunkle Männerstimmen und zwei herausragende lyrisch-dramatische Soprane findet man selbst an großen Häusern nicht ohne Schwierigkeit. Hier, in Plauen (und später dann in Zwickau) prunkte das Haus damit. Judith Schubert (zwar Amerikanerin, aber doch ganz unmerklich und mit bester Diktion) durchmaß die für Wagners Nichte Johanna geschriebene mörderische Partie der Brunhild mit fabelhaftem „Peng“ und traumhafter Sicherheit, führte in den Ensembles mit leuchtender Ortrud-Stimme und schöner Präsenz: eine sensationelle Leistung. Ihre „Gegenspielerin“ Chriemhild war mit Maria Gessler interessant und hochaktiv besetzt. Es ist wahr – das Ganze liegt der eher viel lyrischeren Stimme zu hoch und ist ihr natürlich auch viel zu dramatisch (namentlich der Elsa-nahe Schluss), aber sie setzte ihre Mittel professionell ein, und wenn sie nicht zu sehr drückte (wo die sehr helltimbrierte Stimme zum Grellen neigt, namentlich in der hier dann doch knapp werdenden Höhe), hatte sie weite Passagen von lyrischer Innigkeit, zumal sie eine attraktive Frau mit schönen roten Haaren ist (aber man möchte ihr doch lyrischere Partien raten…). Die dunkle Herren-Trias war – schlicht gesagt – ,,eine Wucht“! Der elegante Siegfried des Martin Kronthaler glänzte mit liedhaftem legato, mit schönstem, individuellem Timbre (namentlich in seiner Soloszene zu Beginn des zweiten Teils vom 3. Akt), mit angenehmer, spielfreudiger Erscheinung und natürlich mit bereits erwähnter Textdeutlichkeit. Hier steht ein Wolfram, ein Posa, ein Figaro von Rang! Auch Hagen Erkrath fiel als Namensbruder Hagen mit seinem gutgeführten, markanten und aussagekräftigen Bassbariton auf, auch er ein Gewinn für jedes Haus. Und schließlich gab es mit Hasso Wardeck einen hochpräsenten, sonoren ebenso wie „bedrohlich“ klingenden König Etzel, an dessen Hof sich auf Chriemhilds Betreiben das Schicksal der Nibelungen erfüllt. Dass diese nun von dem stimmlich recht schwachbrüstigen Guido Hackhausen (als König Günther, hier mit mit -ü-) angeführt wurden, ist vielleicht dem Mangel an geeigneten Tenören besonders für kleine Häuser zuzuschreiben, wo man eben alles (oder zumindest vieles) singen und besetzen muss. Aber auch er machte viel aus seinem hierfür begrenzten lyrischen(!) Medium und ließ eine außerordentliche und werkdienliche Textdeutlichkeit hören. Die übrigen Rollen waren mehr als zufriedenstellend verteilt. Werner Rautenstengel, Tara Iva Niv, Michael Simmen und Hasso Wardeck waren Comprimari von Präsenz und Kapazität, mehr als angenehm!

Zu Dorns Oper „Die Nibelungen“: Szene aus der Plauener Aufführung 2004/ Foto Peter Awtukowitsch
Die Inszenierung wurde dem Werk und dem vaterländischen Pathos des Ganzen weniger gerecht. Bei aller Hochachtung vor dem regieführenden Hausherrn Ingolf, aber seine Sicht (optisch ausgeführt von Marie-Luise Strandt, alte Mitkämpferin von Ruth Berghaus und eben deren Ansatz immer noch verpflichtet) schien mir zu sehr in der überdetaillierten, alten und heute wirklich verstaubt-komisch wirkenden DDR Schule eines Herz oder Kupfer verhaftet. Das Geschehen (wieder mal!) in die Entstehungszeit der bösen Junker zu verlegen, die „Herrschenden“ in weiße Bismarck-Militär-Mäntel zu hüllen, die Gibichungenhalle zum Lortzingschen Teekränzchen chez Chriemhild zu denunzieren, Könige durch Kriechen auf dem Bauch zu demütigen – das dient dem Werk nicht, dessen zugegeben angestaubtes vaterländisches Pathos dadurch ziemlich humoristisch wirkte (drastisch darin von den abenteuerlichen Reimen des Librettos unterstützt).

Ausgräber des Seltenen – der Annaberger Intendant Ingolf Huhn/EVWTAB
Da wurde zu vieles zu (klein?)bürgerlich und zu tendenziös-postsozialistisch angegangen. Eine leere Bühne und phantasievollere Kostüme hätten gereicht. Aber im Ganzen waren diese Irritationen eher zu vernachlässigen, denn die Optik störte nicht wirklich (man seufzte nur dann und wann…), und die Personenregie war zumindest plausibel-straightforward wie die Handlung auch. Was bleibt ist der Eindruck von einer Großen Oper, von heroischer Musiksprache, von fabelhafter Orchestrierung. Und wenn vielleicht nicht gerade geniale Erfindung vorherrschte, so hörte man doch ein typisch deutsches Idiom aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, das sich durch reichen Klang, durch gutgestrickte Ensembles und Chorszenen und durch schöne, atmosphärische Momente auszeichnet. Und durch ein prachtvolles Ensemble auf der Bühne wie im Graben. Was will man mehr? Geerd Heinsen
.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.
 Die beiden Autoren sind ausgewiesene Kenner. Haberfeld, zeitweise Mitglied im Verwaltungsrat der Opernhaus Zürich AG, besuchte bereits 1954 erstmals Bayreuth. Der Theaterwissenschaftler Bauer war dort über viele Jahre ein enger Mitarbeiter von Wolfgang Wagner, nach seines Bruders Tod alleiniger Chef der Festspiele. Von 1976 an leitete Bauer das Pressebüro. Sein zweibändiges Werk „Die Geschichte der Bayreuther Festspiele“ ist 2016 auf den Markt gekommen. Mehrheitlich stammen die in dem neuen Buch dokumentierten Arbeiten aus Bayreuth. Wielands Wirken war aber nicht allein auf diesen Ort fixiert. Seine Vielseitigkeit und Umtriebigkeit führte ihn auch an andere Häuser. Resultate dieser ertragreichen Nebenbeschäftigung sind der Glucksche Orpheus in München (1953), Fidelio (1954), Antigonae (1956) und Comedia de Christi Resurrectione (1957) von Orff, Rienzi (1957), Tristan (1958), Elektra und Salome (beide 1962), Lulu (1966) in Stuttgart, Carmen (1958) in Hamburg, Tristan (1959), Aida, Lohengrin (beide 1961), Salome (1961) und Meistersinger (1962) in West-Berlin, Otello (1965) Wozzeck (1966) in Frankfurt. Auch ganz frühe Versuche noch aus den dreißiger Jahren, in denen sich die Begabung etwas unbeholfen ankündigt, sind aus der Versenkung geholt worden.
Die beiden Autoren sind ausgewiesene Kenner. Haberfeld, zeitweise Mitglied im Verwaltungsrat der Opernhaus Zürich AG, besuchte bereits 1954 erstmals Bayreuth. Der Theaterwissenschaftler Bauer war dort über viele Jahre ein enger Mitarbeiter von Wolfgang Wagner, nach seines Bruders Tod alleiniger Chef der Festspiele. Von 1976 an leitete Bauer das Pressebüro. Sein zweibändiges Werk „Die Geschichte der Bayreuther Festspiele“ ist 2016 auf den Markt gekommen. Mehrheitlich stammen die in dem neuen Buch dokumentierten Arbeiten aus Bayreuth. Wielands Wirken war aber nicht allein auf diesen Ort fixiert. Seine Vielseitigkeit und Umtriebigkeit führte ihn auch an andere Häuser. Resultate dieser ertragreichen Nebenbeschäftigung sind der Glucksche Orpheus in München (1953), Fidelio (1954), Antigonae (1956) und Comedia de Christi Resurrectione (1957) von Orff, Rienzi (1957), Tristan (1958), Elektra und Salome (beide 1962), Lulu (1966) in Stuttgart, Carmen (1958) in Hamburg, Tristan (1959), Aida, Lohengrin (beide 1961), Salome (1961) und Meistersinger (1962) in West-Berlin, Otello (1965) Wozzeck (1966) in Frankfurt. Auch ganz frühe Versuche noch aus den dreißiger Jahren, in denen sich die Begabung etwas unbeholfen ankündigt, sind aus der Versenkung geholt worden.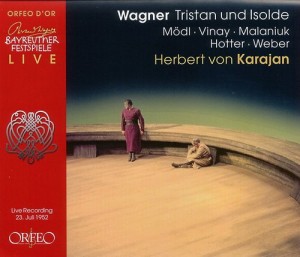


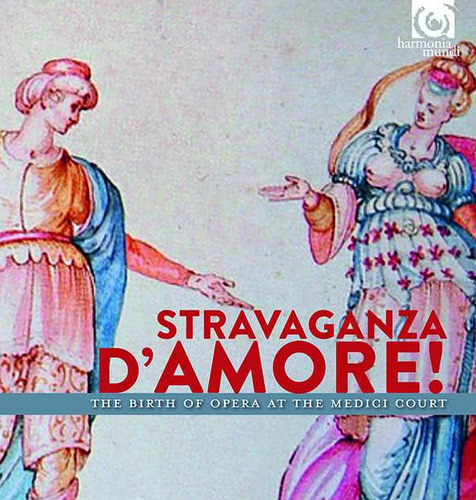























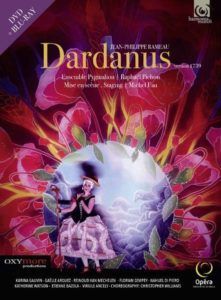 Magische eröffnet die Möglichkeit des Zauberhaften und Phantasievollen, und das steht im Zentrum dieser Aufnahme, die in der Box sowohl auf
Magische eröffnet die Möglichkeit des Zauberhaften und Phantasievollen, und das steht im Zentrum dieser Aufnahme, die in der Box sowohl auf 











 In der Oper treten Sie in einem größeren Rahmen auf. Was empfinden Sie, wenn Sie als Liedsängerin den gesamten Abend über im Mittelpunkt stehen?
In der Oper treten Sie in einem größeren Rahmen auf. Was empfinden Sie, wenn Sie als Liedsängerin den gesamten Abend über im Mittelpunkt stehen? 


 Die „heitere Mythologie“ ist eng mit den
Die „heitere Mythologie“ ist eng mit den 
