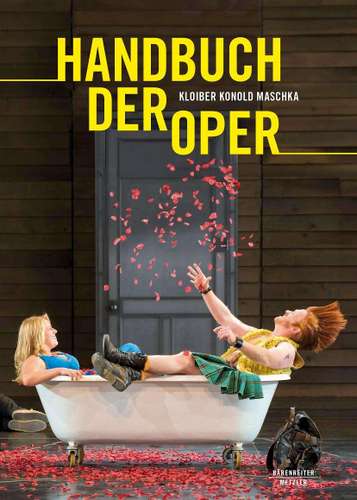.
Zu allgemeinen Überraschung erschien nun bei Orfeo Franz Schmidts Opernschocker Fredigundis in einer Live-Aufnahme des Österreichischen Rundfunks von 1979 mit Dunja Vejzovic, Werner Hollweg und anderen. Die gab es zwar schon immer bei anderen Labels des grauen Marktes, aber nicht in der fabelhaften originalen Bandqualität. Natürlich haben Fans des Genres diese stets gehabt, aber es ist schön, sie nun offiziell sein eigen zu nennen.
.
 Details: Franz Schmidt Fredigundis, Oper in drei Aufzügen nach dem Roman von Felix Dahn (!) mit einem Libretto von Bruno Warden und Ignaz Michael Welleminsky; Besetzung: Fredigundis; Fredigundis Dunja Vejzovic; Chilperich, König der Franken Martin Egel; Landerich, des Herzogs Sohn, später Praetextatus,; Bischof von Rouen Werner Hollweg; Herzog Drakolen Reid Bunger; Rulla Olga Sandu; Drei Bewaffnete Wolfgang Witte Robert Riener; Neven Belamaric; ORF Chor; (Einstudierung | Chorus Master: Gottfried Preinfalk); ORF Vienna Radio Symphony Orchestra; Dirigent Ernst Märzendorfer; Musikverein Wien, Großer Musikvereinssaal, 27.09.1979 live recording; 2 CD Orfeo 4011790380124; dazu ein Einführungsartikel von Hartmut Krones und dankenswert das deutsch-englische Libretto).
Details: Franz Schmidt Fredigundis, Oper in drei Aufzügen nach dem Roman von Felix Dahn (!) mit einem Libretto von Bruno Warden und Ignaz Michael Welleminsky; Besetzung: Fredigundis; Fredigundis Dunja Vejzovic; Chilperich, König der Franken Martin Egel; Landerich, des Herzogs Sohn, später Praetextatus,; Bischof von Rouen Werner Hollweg; Herzog Drakolen Reid Bunger; Rulla Olga Sandu; Drei Bewaffnete Wolfgang Witte Robert Riener; Neven Belamaric; ORF Chor; (Einstudierung | Chorus Master: Gottfried Preinfalk); ORF Vienna Radio Symphony Orchestra; Dirigent Ernst Märzendorfer; Musikverein Wien, Großer Musikvereinssaal, 27.09.1979 live recording; 2 CD Orfeo 4011790380124; dazu ein Einführungsartikel von Hartmut Krones und dankenswert das deutsch-englische Libretto).
.
.

Franz Schmidt: „Fredigundis“ /Theaterzettel der Uraufführung/ Theatermuseum Wien
Franz Schmidt war zu drei Vierteln Ungar und wurde im heutigen Bratislava in der Slowakei geboren. Fredigundis war seine zweite Oper (von zweien, die andere und bis heute berühmtere, wenngleich auch selten aufgeführte ist Notre Dame nach Victor Hugos Roman von 1914. Fredigundis gilt manchen als die bessere der beiden Opern, obwohl die Uraufführung auch die letzte auf der Bühne war (offenbar ein missverstandenes Desaster). Meine Einführung basiert auf der 1979 entstandenen OR-Konzertaufnahme, die anscheinend die einzige Wiederaufführung bis heute bleibt.
Dann wollen wir mal einen Blick auf diese ungewöhnliche Oper werfen, die Handlung zuerst.
Der Schauplatz ist Neustrien (das heutige Nordmittelfrankreich), zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts. Fredigundis (Sopran) ist dieselbe wie die Fredegonde in Guirauds Oper, die von Saint-Saens fünfundzwanzig Jahre früher vollendet wurde. Hier erfahren wir jedoch nichts von ihrem blutigen Konflikt mit Schwägerin Brunhilde, sondern viel von ihrer verrückten Ehe mit Chilperich I. (Bariton). In Schmidts Version ist Fredigundis eine verrückte Heidin, die Chilperich trotz der Warnungen seines Vaters Drakolen (Bass) und der romantischen Annäherungsversuche von Landerich (Tenor, der zum Erzbischof von Rouen wird, nachdem er von Fredegundis verschmäht wurde) verführt. Fredigundis ermordet Chilperichs stumme Frau Galswintha, heiratet ihn und bringt ein kränkliches Kind zur Welt (das kurz nach dem Tod seines Vaters stirbt, weil es versehentlich von Fredigundis vergiftet wurde!) Ich werde den Kontext dieses Teils (und des Finales) für später aufheben, weil das jetzt gerade selbst für ausgebuffte Opernfans zu bizarr wird!
.

Felix Dahns gleichnamiger Roman war die Vorlage zu „Fredigundis“ von Schmidt, berühmt wurde Dahn durch sein Epos „Ein Kampof um Rom“/ Wikipedia
Und jetzt geht´s los – Akt für Akt. 1. AKT: Klippen (?) über den Ufern der Seine. Die Ouvertüre ist eine überraschende und etwas zurückhaltende Komposition. Man soll sich nicht von ihrer Subtilität täuschen, sie ist in Wirklichkeit ein sehr komplexes Stück mit mittelalterlicher Blechbläserfanfare (die sehr oft wiederholt wird und mehr nach Renaissance als nach Mittelalter klingt, als gehöre sie in eine Oper über die Tudors oder so). Das schwebt auf musikalischem Schaum (wie ein Großteil der Partitur) und hat zwei Momente von echter Kraft (Gongs!). Außerdem ist sie durchkomponiert und mündet direkt in die erste Szene der Oper. Die Eröffnung besteht aus einem langen Dialog zwischen Fredigundis und Landerich, in dem sie das ätherischste Gespräch über Sex führen, das man sich vorstellen kann. Diese weist seine Annäherungsversuche wegen ihrer Liebe zu Chilperich zurück. Die königliche Hochzeitsbarke gleitet den Fluss (die Seine, wir sind immer noch in Paris) herunter (noch mehr Fanfarenmaterial aus der Ouvertüre), hauptsächlich zu Landerichs Erzählung. Es folgt ein weiterer Dialog zwischen Fredigundis und Landerich, der in einen Monolog für Fredigundis übergeht. Und dann singt endlich mal jemand anderes als die beiden, weil nun Chilperich auftaucht und nach der feurig-langhaarigen Fredigundis sucht! Sie hat auch etwas zu sagen (es gibt dann einige chromatische Einlagen des Orchesters), was uns den Kontext vermittelt, dass sie eine Zofe im königlichen Haushalt ist, aber davon träumt, selbst Königin zu werden! Das nennt man Ehrgeiz. Die Musik geht melodisch weiter, obwohl es keine Höhepunkte gibt, außer dass alles weiterhin sehr nach guter Richard-Strauss-Musik klingt, als Chilperich Vater Drakolen begegnet, der ihn vor Fredies Machenschaften warnt und versucht, ihn zum Eintritt in ein Kloster zu zwingen. Nach einem leichten Sturm bekommt Fredigundis eine weitere Solopassage, als sie den Wilden Jäger anruft, zu ihr zu kommen. Die Natur gurrt orchestral, sehr wirkungsvoll. Chilperich trifft ein und umarmt Fredigundis leidenschaftlich. Ein Großteil des restlichen Aktes besteht aus ihrem Liebesduett, bis Landerich (am Ende des Aktes wieder auftretend) beschließt, Priester zu werden, nachdem seine Verlobung mit Fredigundis gescheitert ist (sehr dramatisch).

Mangels weiterer Bilddokumente (die infamer Weise auch von der Bilderkrake Getty belegt sind) hier zur Oper „Fredigundis“ in freier Aossoziation zur Titelfigur die große Sarah Bernhardt als Lady Macbeth auf dem Gemälde von Franz von Lehnbach/ Wikipedia
2. AKT: Vor dem Schlafgemach von Galswintha, einige Monate später. Gruseliges Präludium, meist auf Ganztönen. Fredigundis lauert in den Schatten herum, während Chilperich die stumme Galswintha in ihr Schlafgemach begleitet. Eine stark chromatische Passage, die etwa sechs volle Minuten dauert. Dann wird es unruhiger, als Fredie Galswintha ermorden will. Sie ist eben nicht nur ehrgeizig sondern auch ruchlos. Landerich tritt auf (jetzt Bischof, das nennt man Karriere) mit Drakolen (der es geschafft hat, eine Locke von Fredigundis‘ Haar an sich zu bringen, nachdem sie die Königin erstochen hatte). Landerich verbrennt die Haarlocke. Chilperich trifft ein, und es herrscht allgemeine Verwirrung (abgesehen von dem seltsam besonnenen, wenn auch liebes-vernarrten Landerich: Verdis Macbeth-Finale A1 grüßt). Ein Frauenchor (der erste in der Oper) tritt auf, und es kommt zu einem Tumult über den Mord an der Königin, der in ein Intermezzo übergeht. Szene 2: Das Hochzeitsbankett. Der Chor der Hochzeitsgesellschaft verwendet das Fanfarenmaterial aus der Ouvertüre als Grundlage. Dies beginnt Wagners Musik für Siegfried zu ähneln (das heroische Material, nicht die Oper). Landerich hat ernsthafte Probleme mit der Krokodil-Tränen weinenden Fredigundis (da er weiß, dass sie ihren Vorgänger ermordet hat, um dorthin zu gelangen, wo sie nun ist). Es folgen weitere triumphale Krönungsgesänge zu Wagnerscher Musik (sehr dramatisch, wie immer). Drakolen kommt herein (wie immer schimpft er, zu Recht, über Fredigundis). Das ist nicht so von dramatischer Wirkung, wie es sein sollte, also er denunziert sie vor dem gesamten Hofstaat als Mörderin. Zur Strafe dafür lässt Chilperich seinen eigenen Vater vor aller Augen blenden (!). Landerich hat jedoch immer noch Probleme damit, die Königin zu krönen. Chilperich nimmt die Krone selbst und setzt sie Fredigundis auf den Kopf. Das Volk jubelt ihr als neue Königin zu.
3. AKT: Ein Zimmer im Palast, eine Wiege sichtbar, mindestens ein Jahr später. Ein weiteres Präludium, diesmal etwas tonaler, wenn auch immer noch auf einer Ganztonleiter. Fredigundis ist über ihr sterbendes Kind gebeugt. Chilperich ist ihr immer noch treu ergeben, aber Fredigundis denkt, dass all das Schlimme, was sie getan hat, in Wirklichkeit eine göttliche Strafe für ihre Sünden ist. Die Musik wandert hier meist etwas amorph umher. Landerich tritt auf, aber erst als Drakolen draußen zu hören ist, nimmt die Handlung richtig Fahrt auf. Fredigundis bittet ihn, für ihr sterbendes Kind zu beten. Landerich versucht, Fredigundis dazu zu bringen, ihre Vergangenheit zu beichten, und sie beschließt mal wieder sehr entschlossen, die Dinge in die Hand zu nehmen und ihn zu vergiften. Er gesteht ihr, dass er sie immer noch liebt, obwohl er weiß, was sie für eiun gemeines Teil ist. Es folgt ein weiterer Mono-Gesang für Fredigundis mit einer üppigen orchestralen Untermalung, diesmal chromatisch. Und es folgt die Fortsetzung des Dialogs mit Landerich. Chilperich kehrt zurück und trinkt schließlich den Giftkelch, den Fredigundis für Landerich bestimmt hatte! Fredigundis flippt aus, und Chilperich beginnt langsam an den Folgen des Giftes zu sterben. Schließlich stirbt er wirklich, mit viel zarter Celesta-Musik im Hintergrund. Dazu hört man Drakolen im Hintergrund, bevor die Szene wechselt..

Die Darstellung Elle Terrys als Lady Macbeth (Gemälde von Sargent/Wikipedia) könnte der Oper Schmidts entnommen sein.
Szene 2: Das Innere der Kathedrale von Rouen, der Sarg von Chilperich in der Mitte. Der Trauermarsch dazu ist das bekannte Intermezzo. Drakolen trauert um seinen Sohn an dessen Sarg. Er geht weg. Fredigundis trifft ein und betet zu ihren heidnischen Göttern, um Chilperich von den Toten auferstehen zu lassen. Sie beginnt, einen heidnischen Ritualtanz aufzuführen (mitten in der Kirche, was für Nerven, aber vielleicht ist ihr jetzt alles egal. Der Deckel des Sarges stürzt auf sie herab und hält sie an ihren langen Haaren am Boden fest. Drakolen kehrt zurück, nachdem er Fredigundis Schreie gehört hat, aber da er blind ist, weiß er nicht genau, wer da in Not ist. Schließlich merkt er, dass es Fredigundis ist, und in dem Glauben, sie sei bereits tot, beginnt er zu jubeln. Aber so weit sind wir noch nicht. Landerich kommt hinzu und ist schockiert, Fredigundis in diesem Zustand zu sehen. Die am Boden eingeklemmte Fredigundis beichtet ihre Sünden und beginnt, während sie stirbt, Visionen von ihrem Mann und ihrem Kind im Jenseits zu sehen. Vorhang mit einem schockierend ruhigen Akkord.
.
Das Libretto: Die Schwächen liegen im Libretto, nicht unbedingt in der Partitur. Die Musik ist üppig, manchmal sogar zu melodiös für das ziemlich brutale Thema, bei dem es um Mord, öffentliche Verblendung, Vergiftung und Tod durch Erdolchen und Erschlagen geht. Der Plot ist einfach: Die Sopranistin wird von den drei männlichen Stimmen umkreist, die jeweils verschiedene Beziehungen zu ihr darstellen: der Tenor steht ihr nahe, kommt aber nicht weiter; der Bariton ist ihr zugetan; der Bass hasst und verabscheut sie wie sie ihn. Das Problem, wenn es denn eines gibt, besteht darin, dass die Sopranistin wild, amoralisch und selbst für Opernverhältnisse bizarr gezeichnet ist. Obwohl die historische Fredegonde selbst ziemlich rücksichtslos war, wird in der Oper eine Frau dargestellt, die an Verrücktheit über die historische Figur hinausgeht. Die bizarre Darstellung der Titelfigur ist eigentlich der Hauptmangel des Werks.
Die Musik klingt sehr nach Richard Strauss (der die Partitur sehr bewunderte), mit ein wenig mehr Chromatik, und Elemente der Handlung scheinen den Schockwert von Salome und Elektra heraufbeschwören zu wollen. Für all dieses Chaos ist Schmidts Musik überwiegend entweder sanft oder stattlich, und beides passt nicht wirklich gut zur Handlung, obwohl alles toll klingt. Hier herrscht „gothischer“ Horror, und manchmal auch grausamer. Aber die Musik ist ein starkes Argument dafür, dass diese Oper Besseres verdient. G. H.
.
.

Und noch einmal Sarah Bernhardt als Lady Macbeth/Atelier Nadar 1895/ Ipernity
Zur Musik selbst schreibt der österreichische Musikwissenschaftler Hartmut Krones im Beiheft zur neuen Ausgabe der Aufnahme bei Orfeo: Dass sich die Musik Franz Schmidts in ihrer Qualität weit über das Textbuch hinaushob, stellte man zwar allgemein fest, doch konnte diese Tatsache das Werk auch nicht wirklich retten. Dies umso weniger, als auch die Tonsprache in ihrer Dichtheit, ihrer kunstvollen Faktur, eher schwer verständlich war und es bis heute blieb. Und wenn Max Springer sie als „ununterbrochenen, nur spärlich durch Gliederungen und Kontraste eingedämmten Fluß“ charakterisierte, so drückte er damit sicher die Meinung vieler aus. Noch prägnanter formulierte es Julius Korngold: „Schwer hängt die kontrapunktische Rüstung an den Schönheiten der Musik“. Die Worte von Richard Strauss, „So schwer muß man es sich doch nicht machen. Ihre Musik erdrückt alles wie ein Lavastrom; ich hätte daraus vier Opern gemacht“, zeigen schließlich genau den Unterschied zwischen den beiden Zeitgenossen. Hier der Erfolgskomponist, der mit sicherem Gespür für den Publikumsgeschmack Oper um Oper verfertigte, dort der schwer um Vollendung ringende, immer höchste Maßstäbe anlegende Meister der Satzkunst, der im Bestreben, keine Musik ohne handwerkliche Vollkommenheit aus der Hand zu geben, vielleicht manchmal wirklich des Guten zuviel tat.
Franz Schmidts Musik zu „Fredigundis“ steht gleichsam am Endpunkt der Entwicklung, welche die sogenannte „klassisch-romantische“ Periode durchzieht. Auf dem Gebiet der Harmonik macht sich das in erster Linie durch zahlreiche Chromatismen und eine bis an die Grenzen der Tonalität vorstoßende Ausweitung des Dur-Moll- Systems bemerkbar. Der Bezug zum Zentrum, zum Grundton, ist zwar immer vorhanden, bisweilen aber derart verschleiert, dass er nur mehr mit der Partitur in der Hand wahrgenommen werden kann. Dissonanzauflösungen sind dabei durch das Einführen neuer akkordfremder Töne oft nur für den wirklichen Kenner hörbar. Und auch die Melodik weist durch chromatische und dissonante Führungen ähnliche Merkmale auf, was vor allem die Realisation der Gesangspartien vor überaus große Schwierigkeiten stellt. Dichte Kontrapunktik, perfekte Satzkunst und konsequente Notierung im Tonsystem (was zu extrem vielen Vorzeichen führt) sind weitere Charakteristika (und Probleme) des Werkes.

Der Autor, em. o. Univ.-Prof. MMag. Dr. Hartmut Krones, ist Emeritierter Universitätsprofessor des Instituts für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung Wien und renommierter Musikwissenschaftler/Foto Schertberger
Dennoch muss gesagt werden, dass die Oper „Fredigundis“, was die Musik betrifft, ein überzeugendes Beispiel für jenen spätromantischen Standpunkt darstellt, wie ihn Franz Schmidt wie wohl kein zweiter im frühen 20. Jahrhundert einnahm. Die Befassung der Gegenwart mit durchaus schwerer verständlichen Werken der Moderne sollte aber auch dem Verständnis für diese Schöpfung förderlich werden. Hartmut Krones/Orfeo (mit Dank an den Autor!)
.
.
Die Handlung der Oper ist derart bizarr, dass ich die Gelegenheit nutzte eine (stark bedankte) Anleihe bei philsoperaworld zu machen. Das ist die erfrischend respektlose website eines Amerikaners namens Phil, der eine lange Reihe von Opernbesprechungen (in Englisch) veröffentlicht hat, die in ihrer bodenständigen Direktheit nicht nur Einsichten vermitteln sondern auch das Zwerchfell reizen. Wie nun auch hier bei Schmidts zweiter Oper (zu eben diesem s. auch Wikipedia, da ist das meiste gesagt; auch unser Korrespondent Daniel Hauser hat sich zu Franz Schmidt als sinfonischem Komponisten in operalounge.de geäußert). Phils Artikel beruht auf der genannten Ton-Aufnahme und auf zwei Videos (?), die der kompletten Orchesterpartitur von Fredigundis folgen. Abbildung oben: die Schauspielerin Sarah Bernhardt als Lady Macbeth in einem Gemälde von Franz von Lenbach 1892/ Ausschnitt/Wikipedia)
.
.
.Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie Die vergessene Oper hier.
.




 Ein paar Jahre jünger als die Grigorian ist die bei Erato stark vertretene französische Sopranistin
Ein paar Jahre jünger als die Grigorian ist die bei Erato stark vertretene französische Sopranistin 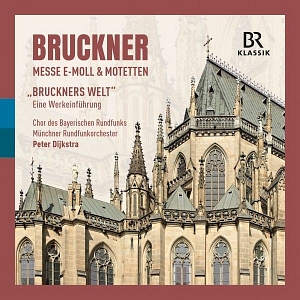






 Etwas unglücklich ist seine Optik zumindest im ersten Akt, wenn er wie ein in Paketband eingewickeltes Möbelstück wirkt. Bleichgesichtig verfolgt
Etwas unglücklich ist seine Optik zumindest im ersten Akt, wenn er wie ein in Paketband eingewickeltes Möbelstück wirkt. Bleichgesichtig verfolgt 
 Details:
Details: