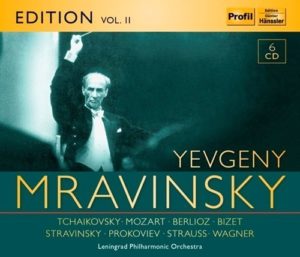Wer sich seinen nächsten Besuch einer Wagner-Oper, speziell den der Meistersinger gründlich verderben will, der lese zuvor Hans Rudolf Vagets neues Buch Wehvolles Erbe im Fischer Verlag, womit das des Komponisten aus Bayreuth gemeint ist. Während man beim Lesen der ersten 150 Seiten dem Autor noch in vielem folgen konnte, wohl manchmal die Augenbrauen hochzog, aber doch nachvollziehbar war, was er über den Wagner Hitlers schrieb, ist einem das verwehrt, wenn man glauben soll, dass man auf der Bühne die „protofaschistische Volksgemeinschaft von Wagners Nürnberg“, die „Verherrlichung der charismatischen Autorität“ und den Sieg „des gesunden Volksempfindens“ sowie die „Ausgrenzung“ Beckmessers als Analogie zu der der Juden in Nazideutschland verfolgen kann. Es gibt also nach Vaget „viele naziaffine Aspekte“ in den Meistersingern. Kann man angesichts des Inhalts solcher Abschnitte nur den Kopf schütteln, so wundert man sich nicht minder über das große Missverständnis, von dem der Titel zeugt, denn mit dem „wehvollen Erbe“ kann nur das des Komponisten gemeint sein, die drei Hauptkapitel, das vom Autoren sogenannte Triptychon von Hitler, Knappertsbusch und Thomas Mann, aber sind eine Art Rezeptionsgeschichte, werfen ein Licht eher auf diese drei und darauf, wie sie Wagner und sein Werk, das gar nicht wehvoll ist, sahen und wie sie es eventuell entstellten. Dabei scheint der Verfasser einem Zwang zu unterliegen, in allem und jedem Beziehungen zwischen Wagner und seinem Werk und zum Beispiel Hitler zu sehen. Wobei nicht geleugnet werden soll, dass dieser ein glühender Verehrer Wagners war. Aber sowohl im wahrscheinlich von den Wagnerenkeln erfundenen „Onkel Wolf“ wie in der „Wolfsschanze“ (gleich Walhall!) eine Beziehung zum „Wolfe“ der Walküre als sicher anzusehen, ist reichlich verwegen. Nur als Frage, aber immerhin als Möglichkeit taucht der Gedanke auf, der Tod im Führerbunker sei eine Nachahmung des Endes des Volkstribunen Rienzi. Die arme, unschuldige Oper trägt auch den Makel in sich, dass Mussolini sie mochte, und „so hat Hitler diesem Werk seine Identifikation mit Wagners römischem Tribunen einen nachhaltig faschistischen Stempel aufgedrückt.“
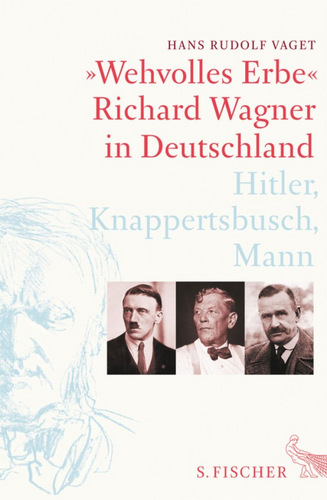 Dem Buch vorangestellt sind sechs Zitate bekannter Persönlichkeiten über Wagner und Hitler, was von vornherein die Nähe zwischen beiden suggerieren soll. Eine mehr als sechzig Seiten umfassende Einleitung befasst sich unter anderem mit der Frage, ob Wagner „ein Teil unseres Selbsts“ sei, wobei man sich fragt, wie vielen Prozenten der Bevölkerung Wagner überhaupt ein Begriff ist, ob die angenommene „kollektiv geistig-seelische Prägung“ bei vermutlich doch geringem Kenntnisstand überhaupt stattfinden kann. Versöhnlich stimmt dabei den Leser, dass es der Verfasser ablehnt, aus heutiger Sicht über die Vergangenheit zu urteilen.
Dem Buch vorangestellt sind sechs Zitate bekannter Persönlichkeiten über Wagner und Hitler, was von vornherein die Nähe zwischen beiden suggerieren soll. Eine mehr als sechzig Seiten umfassende Einleitung befasst sich unter anderem mit der Frage, ob Wagner „ein Teil unseres Selbsts“ sei, wobei man sich fragt, wie vielen Prozenten der Bevölkerung Wagner überhaupt ein Begriff ist, ob die angenommene „kollektiv geistig-seelische Prägung“ bei vermutlich doch geringem Kenntnisstand überhaupt stattfinden kann. Versöhnlich stimmt dabei den Leser, dass es der Verfasser ablehnt, aus heutiger Sicht über die Vergangenheit zu urteilen.
Hat sich der Leser damit abgefunden, dass nicht über Wagners Opern, sondern über Hitlers, Knappertsbuschs und Manns Wagner gehandelt wird, und im Fall Hitler der Einfluss des Hitlerschen Wagner auf die deutsche Politik, dann kann man mit Interesse lesen, dass es nicht die Judenfeindschaft, sondern der Genieglauben war, der den späteren Diktator prägte, dass der „Wagner-Kult die ästhetische Einleitung einer verbrecherischen und barbarischen Politik“ war. Dabei erkennt der Autor, dass Hitler mit dieser Verehrung in der Partei, die eher kleinbürgerlich orientiert war, ziemlich allein stand, er andererseits das Bildungsbürgertum, das dem „Führer“ eher fern stand, durch die Gemeinsamkeit der Wagner-Verehrung für seine Ziele gewinnen konnte, was so pauschal wohl auch nicht zutrifft, so wie auch der Vergleich mit einem Wagner damals und einem Rockkonzert heute hinkt, allein schon wegen nicht vergleichbarer Teilnahmerzahlen. Wenn Vaget nahelegt, dass der Wagner-Freund zwangsläufig auch der Annahme ist, die deutsche Kultur sei anderen Kulturen überlegen, ist das wohl zu pauschal gesehen. Oder ist es schon verwerflich, Goethe auf eine Stufe mit Dante und Shakespeare zu stellen? Ist es nicht anders denkbar, als dass aus der Wagner-Stadt München die „Hauptstadt der Bewegung“ wurde? Und wurde Wagner durch die Verehrung Hitlers für uns interessanter? Da dürfte selbst nach peinlichster Befragung seines Gewissens so mancher ein entschiedenes Nein sagen. Nicht immer kann man den Verfasser von dem Vorwurf freisprechen, er begründe Behauptungen mit anderen Behauptungen, die nicht bewiesen sind (S. 42/43) und verallgemeinere allzu unbekümmert, so mit „Die Wagnergemeinde feierte Hochzeit mit Hitler“. Wenn bereits in der Einleitung behauptet wird, nicht Wieland Wagner, sondern Thomas Mann sei das Verdienst zuzuschreiben, dass Wagner wieder akzeptiert werde, erwartet man mit Spannung die kaum mögliche Beweisführung.
Insgesamt kann man feststellen, dass Vaget der allzu bekannten Faschismustheorie zuneigt, nach der der Faschismus in die deutsche Geistes- und Mentalitätsgeschichte eingebettet sei und verweist dabei auch auf Schriften aus der Zeit des Imperialismus, ohne zu berücksichtigen, dass u.a. von französischer und britischer Seite eher noch krassere Zeugnisse eines Überlegenheitsgefühls zugänglich sind.
Ob ein Witz von Woody Allen, nachdem er „bei Wagner-Musik am liebsten in Polen einfallen“ würde, bei dieser Diskussion hilfreich ist, darf bezweifelt werden. Wenn Hitler als Produkt des Ästhetizismus in der besonderen Form des Wagnerkults gesehen wird, der in Verbindung mit seinem künstlerischen Dilettantismus und seiner besonderen Begabung zur Selbstdarstellung, seines self-fashioning, geradezu charismatisch zu wirken vermag, wird, dann ist das eine extrem idealistische Auffassung, die alle anderen Faktoren wie Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Verarmung der Mittelschicht, verlorener Krieg, Reparationen usw. draußen vorlässt und eigentlich nur den Schluss zulässt, dass Wagner Schuld an der Nazidiktatur ist, denn nach Vaget wäre Hitler ohne Wagner nicht Hitler geworden. Allerdings bemerkt er an anderer Stelle, dass die in Israel herrschende Auffassung, Hitler sei der Vollstrecker Wagners gewesen, nicht zutrifft.
Sprechen Tatsachen wie das Fehlen Wagners in Hitlers Mein Kampf, gegen die These vom übergroßen Einfluss des Komponisten auf Hitler, dann wird geschickt argumentiert, Hitler habe seinen Lesern suggerieren wollen, er sei aus sich selbst zur erreichten Größe gewachsen.
Immer dann liest man das Buch mit weniger Vorbehalten, wenn es um Tatsachen geht, so die Spielplangestaltung mit Rücksicht auf den Krieg und als Wehrertüchtigung, über die 1939 eingerichtete Wagner-Forschungs-Stätte, die Ausführungen darüber, wie Hitler Wagner und Bayreuth sah. Immer wieder aber wird man verstört durch Behauptungen wie die, Hitler habe sich selbst am Blutbad in der „Nacht der langen Messer“ beteiligt (S. 234 „zum Teil auch selbst ausgeführten Blutbad“), oder durch die Verwendung von Opernzitaten wie „Um neu zu schaffen seine Wunderkraft“: die des germanischen Volkskörpers durch das Rassereinheitsgebot.
Ein Triptychon stellt ein dreiteiliges Gemälde dar, dessen Mittelteil meistens doppelt so groß ist wie die beiden Flügelteile. Hans Rudolf Vaget will sein Buch als ein Triptychon gesehen haben, stellt in die Mitte desselben aber die im Vergleich zu den Brocken Hitler und Thomas Mann und ihrem Wagnerbild den von Hans Knappertsbusch 1933 initiierten Protestbrief Münchens gegen eine auf Wagner gehaltene Rede des deutschen Dichters und geht dabei nicht über das bereits Bekannte hinaus. Vielleicht um dem auch rein quantitativ schmalen Mittelteil mehr Gewicht zu verleihen, weitet er das Thema am Anfang und am Schluss des Kapitels auf eine allgemeine Verdammung der mangelhaften Entnazifizierungsarbeit der Bundesrepublik und die Verdammung der „Künstler, die dem Naziregime gedient hatten“ aus und zählt zu diesen pauschal alle, die Deutschland nach der Machtergreifung nicht verließen. Knappertsbusch hat es ihm dabei besonders angetan, weil „der Dirigent sich das Ansehen… eines Unbelasteten zu geben wusste“. Obwohl bei der Beweisführung für oder gegen einen Künstler Angaben von Nazis zu Recht streng hinterfragt, ja in Frage gestellt werden, übernimmt Vaget in diesem Fall kritiklos die Aussagen des 1936 amtierenden Münchner Generalintendanten und SS-Manns, der den Dirigenten wegen angeblicher fachlicher Mängel seines Postens enthob, und schenkt dem Geschassten, der mehrfach mit abfälligen Äußerungen über Hitler viel riskiert hatte, in seiner Beteuerung, es habe sich um eine politische Reglementierung gehalten, keinen Glauben. Unkritisch in seiner Interpretation eines Telegramms, das vielleicht nie abgeschickt wurde und in dem Knappertsbusch um eine Audienz bei Hitler nachsucht, ist er ebenfalls, denn er spekuliert lediglich darüber, warum Knappertsbusch den „Führer“ habe sprechen wollen. Belegt allerdings und damit zu Recht erwähnungswürdig ist die Vokabel „Judengesindel“ in einem Brief des Dirigenten.
Anlass für den Protestbrief ist ein Vortrag Thomas Manns in der Münchner Universität, in dem er Wagner unter anderem „Dilettantismus“ vorwirft, allerdings in einem Zusammenhang und in einer Bedeutung, dass darin keine Verunglimpfung zu sehen ist. Knappertsbusch und mit ihm viele andere Musiker wie Pfitzner und andere Intellektuelle sahen das anders und schrieben besagten Protestbrief, nicht ohne auf ein den Nazis verwandtes Vokabular zu verzichten. Vaget steht nun einer Zustimmung des Lesers zu seiner Verdammung des Vorhabens selbst im Wege, indem er maßlos übertreibt, wenn er vor einer „Denunziation“ spricht ( der Text der Rede war allgemein bekannt), indem er behauptet, damit habe Knappertsbusch den Dichter aus Deutschland vertrieben (dieser selbst sah sich dadurch in seinem Plan einer Emigration nur „befestigt“, erst später änderte er seine Meinung), und indem er schreibt: „Unbeabsichtigt, aber nicht ganz ungewollt“ (Unterschied?) „machte sich Knappertsbusch somit zum Handlanger des Vernichtungswillens der Nazis“ (S.300). Thomas Mann bezeichnete den Dirigenten mehrfach als „Esel“, so macht er sich selbst zum Zeugen dafür, dass dieser so naiv sein konnte, in der Rede über Wagner tatsächlich eine Verunglimpfung des von ihm hoch verehrten Genies zu sehen , dass er sie sogar als solche ansehen musste. Das Kapitel wird mit vielen mehr oder weniger aufschlussreichen Stellungnahmen aus der damaligen Zeit aufgefüllt, bleibt aber doch eher ein Beitrag zu einem Spezialthema für eine Fachzeitschrift als ein gleichwertiger Teil des Buches, gar der Mittelteil eines literarischen Triptychons. Dazu wird es auch nicht durch den Untertitel „Eine deutsche Karriere“, der nahelegt, „deutsche Karrieren“ ließen sich nur durch Denunziation bewerkstelligen, was selbst durch ein schwülstig klingendes „signalhaftes Ereignis von mentalitätsgeschichtlicher Bedeutung“ wie den Protestbrief nicht bewiesen wird. Übrigens hat München, wie der Verfasser meint, nichts aus der Vergangenheit gelernt, sonst hätten nicht 2 (in Worten zwei) ablehnende Leserbriefe zu einem ähnlich gearteten Artikel in der SZ noch in jüngerer Zeit von der verdächtigen Unbelehrbarkeit der Bewohner dieser Stadt gezeugt.
Der dritte Teil des Triptychons ist Thomas Mann und seinem Verhältnis zu Wagner gewidmet, wobei zunächst auf die fiktionale Literatur, danach auf theoretische Schriften des deutschen Dichters eingegangen wird. Natürlich bleibt auch hier Hitler nicht unberücksichtigt, so wenn der Verfasser feststellt, dass dieser Wagner verfallen war, während Mann, da im Unterschied zum Diktator aus gefestigten großbürgerlichen Kreisen stammend, seinem Zauber widerstehen konnte, Hitler der „gewissenlose Ästhet“ blieb, während Mann zum Kritiker wurde.
Es bedarf fundierter Kenntnisse, um nachprüfen zu können, ob die Behauptungen über Der kleine Herr Friedemann, Tristan, Wälsungenblut und Dr. Faustus zutreffend sind, aber zumindest in Bezug auf die Buddenbrooks irrt der Autor, wenn er meint, der Letzte der Familie , Hanno, wäre durch Wagners Musik zum lebensuntüchtigen Schwächling geworden. Er wird bereits als solcher geboren und flüchtet sich deswegen in die Welt von Wagners Musik. Das wird im Roman sehr klar herausgearbeitet, wenn bereits das Neugeborene als kaum lebensfähig erscheint und bei der Taufe über das schlechte Aussehen des Täuflings spekuliert wird. Abgesehen von diesem Irrtum oder dem, König Heinrich I. den Kaisertitel zu verleihen, erfreut dieser Teil des Buches durch eine ausgewogenere Darstellung, wird auch besonders interessant durch den Konflikt mit dem Schwiegervater Pringsheim wegen der Novelle Wälsungenblut und darüber ob diese antisemitisch sei oder nicht. Stellenweise gibt es aber auch hier Zeichen der Verbitterung des Autors über eine mangelnde Aufarbeitung der Nazizeit durch die Bundesrepublik, wenn dieser in der Umwandlung der typisch jüdischen Namen in „arische“ bei der Verfilmung von Wälsungenblut 1965 durch Rolf Thiele einen Beweis dafür sehen will, während eher die Angst vor dem Vorwurf des Antisemitismus bei Beibehaltung der Namen zu erwarten gewesen wäre. Vaget hingegen sieht darin einen Akt der „Arisierung“ und den „Geist einer kompromisslerischen und vertuschenden Vergangenheitspolitik…in der bundesrepublikanischen Gesellschaft im Ganzen“.
Bitterböse war Thomas Mann wohl über seinen Bruder Heinrich wegen dessen Beschreibung eines Lohengrin-Besuchs von Diederich Heßling im Untertan. Vaget zieht daraus den Schluss: „Damit wird dem Leser suggeriert, dass in dem Deutschland Wilhelms II. dieselbe politische Misere und Zurückgebliebenheit herrscht wie in Wagners Oper über den tragisch-glücklosen Gralsritter“. Naheliegender dürfte sein, dass Heinrich Mann damit den wilhelminischen Untertanen bloßstellen wollte, der auf Lohengrin nur seine eigenen primitiven Machtphantasien projiziert und damit das Werk gründlich missversteht.
Nach den Romanen und Novellen, die sich mehr oder weniger mit Wagner befassen, betrachtet Vaget die theoretischen Schriften Thomas Manns über Richard Wagner, angefangen vom Vortrag „Leiden und Größe Richard Wagners“ vom Februar 1933, über die Rede zur Aufführung des Ring in Zürich, den Artikel „Bruder Hitler“ von 1938, in dem Hitler als letzte Figur der Ur-Renitenz, die die Geschichte der Deutschen, Luther wie die Befreiungskriege gegen Napoleon umfassend, beschrieben und ganz nebenbei den Deutschen auch die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg zugeordnet wird.
Unversöhnlich geht Vaget auch mit den Wagnerenkeln („die auf Hitlers Schoß gesessen haben“) um, und unterstellt Wieland, er habe Bloch und Adorno nur als Aushängeschild eines angeblich neuen Bayreuth benutzt. Den Abschluss des Buches bilden Kapitel über das Wagnerbild von Peter Viereck und das Wirken des Bühnenbildners Preetorius in Bayreuth. Als Voraussetzung für ein Leben mit Wagner stellt der Verfasser schließlich die Bedingung, dass Hitler nicht aus der Wirkungsgeschichte Wagners in Deutschland ausgeklammert wird.
Das Buch ist eine bewundernswerte Fleißarbeit, der man gewünscht hätte, dass sie zu einem ausgewogeneren Ergebnis geführt hätte. So aber kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass am Anfang die vorgefasste Meinung stand und danach mit Akribie nach allem gesucht wurde, was einmal aufgestellte Thesen unterstützt.
Übrigens: Gibt es auch einen positiven Rassismus? Und könnte ein Ausspruch wie der von den Juden als der „vermutlich genieträchtigsten Rasse“ (S. 241) einen solchen offenbaren (Fischer Verlag 2017/ 560 S./ ISBN 278 3 10 397244 3)? Ingrid Wanja

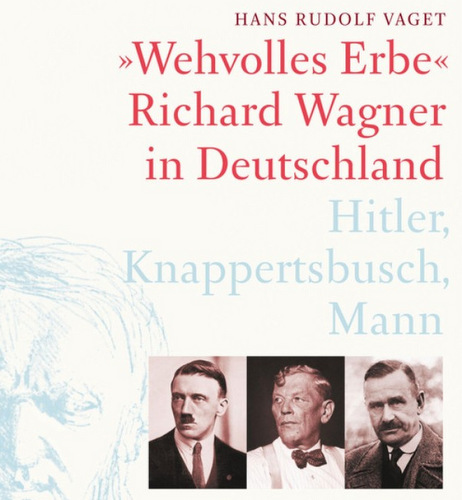













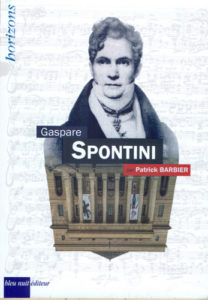 Verehrung und Bewunderung für Musiker sind nicht Qualitäten, die man eigentlich mit der Gestalt des Gaspare Spontini (1774–1851) verbindet. Ganz im Gegenteil: Vielen galt er als hochmütig und selbstsüchtig. Seine Eitelkeit war sprichwörtlich, und er hielt sich oft mit Häme und Verachtung für die Mitmenschen nicht zurück (noch 1844 meinte er, die Italiener seien alle cochons, die Franzosen deren Nachahmer, und die Deutschen kämen nie „aus ihren Kindereien zurück“). Er konnte sich seine unausstehliche Arroganz leisten, denn in seiner Zeit galt er als der erfolgreichste und einflussreichste Opernkomponist überhaupt (noch vor Cherubini). Sein Ruhm verblasste jedoch um die Mitte des 19. Jahrhunderts schnell, und heutzutage werden seine Opern nur selten aufgeführt.
Verehrung und Bewunderung für Musiker sind nicht Qualitäten, die man eigentlich mit der Gestalt des Gaspare Spontini (1774–1851) verbindet. Ganz im Gegenteil: Vielen galt er als hochmütig und selbstsüchtig. Seine Eitelkeit war sprichwörtlich, und er hielt sich oft mit Häme und Verachtung für die Mitmenschen nicht zurück (noch 1844 meinte er, die Italiener seien alle cochons, die Franzosen deren Nachahmer, und die Deutschen kämen nie „aus ihren Kindereien zurück“). Er konnte sich seine unausstehliche Arroganz leisten, denn in seiner Zeit galt er als der erfolgreichste und einflussreichste Opernkomponist überhaupt (noch vor Cherubini). Sein Ruhm verblasste jedoch um die Mitte des 19. Jahrhunderts schnell, und heutzutage werden seine Opern nur selten aufgeführt.
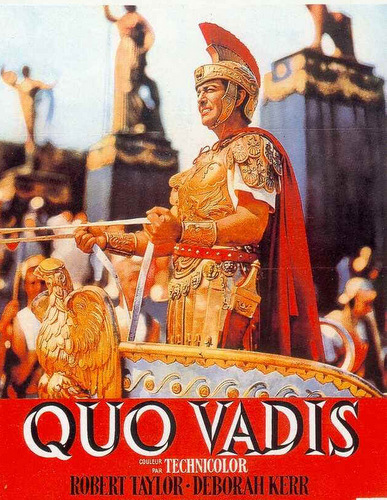














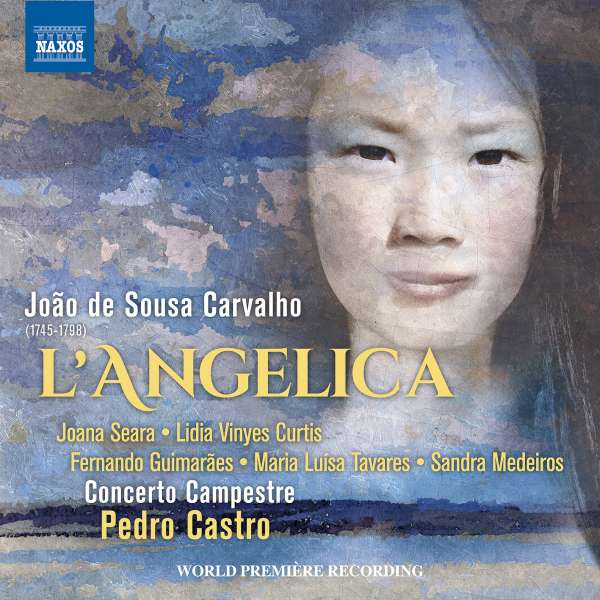

 Verschiedene Musikwissenschaftler (Sampayo Ribeiro 1938, Santos Luís 1999, Stevenson/Brito 2012) stimmen darin überein, dass Carvalho der wichtigste portugiesische Komponist seiner Generation war. Vier der zehn Opern, die von portugiesischen Komponisten während seiner aktiven Zeit geschrieben wurden, stammen von ihm selbst; zehn der 36 Serenaden, die unter Maria I. entstanden, stammen ebenfalls aus seiner Feder.
Verschiedene Musikwissenschaftler (Sampayo Ribeiro 1938, Santos Luís 1999, Stevenson/Brito 2012) stimmen darin überein, dass Carvalho der wichtigste portugiesische Komponist seiner Generation war. Vier der zehn Opern, die von portugiesischen Komponisten während seiner aktiven Zeit geschrieben wurden, stammen von ihm selbst; zehn der 36 Serenaden, die unter Maria I. entstanden, stammen ebenfalls aus seiner Feder.



 Diesen Stil konnte anscheinend 1957 niemand singen. Schmerzlich daneben liegt Tenor
Diesen Stil konnte anscheinend 1957 niemand singen. Schmerzlich daneben liegt Tenor 











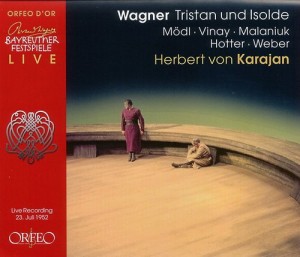


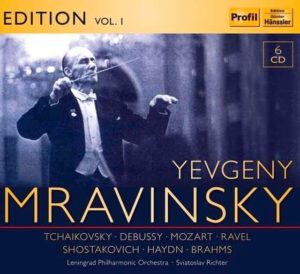 Enthalten sind zwischen 1940 und 1962 entstandene Aufnahmen, also aus der ersten Hälfte seiner Amtszeit als Chefdirigent in Leningrad. Daraus resultiert freilich, dass ein Gros der Tondokumente lediglich in Mono vorliegt – nichts für Hi-Fi-Enthusiasten. Der Klang war, wie der Kenner weiß, ohnehin immer das Hauptproblem bei den meisten seiner Aufnahmen. Selbst seine letzten Tondokumente aus den 1980er Jahren klingen allenfalls durchschnittlich. Die besten Klangresultate wurden in der Tat auf Auslandstourneen erzielt. Hieran lässt sich erahnen, dass Leningrad in der UdSSR technisch deutlich hinter Moskau zurücklag, klingen die zeitgleich entstandenen Melodija-Einspielungen Jewgeni Swetlanows doch bei weitem besser. Mrawinski machte, seinem Naturell entsprechend, übrigens seit Anfang der 1960er Jahre ohnehin keine Studioeinspielungen mehr, sondern bevorzugte das unmittelbare Live-Erlebnis.
Enthalten sind zwischen 1940 und 1962 entstandene Aufnahmen, also aus der ersten Hälfte seiner Amtszeit als Chefdirigent in Leningrad. Daraus resultiert freilich, dass ein Gros der Tondokumente lediglich in Mono vorliegt – nichts für Hi-Fi-Enthusiasten. Der Klang war, wie der Kenner weiß, ohnehin immer das Hauptproblem bei den meisten seiner Aufnahmen. Selbst seine letzten Tondokumente aus den 1980er Jahren klingen allenfalls durchschnittlich. Die besten Klangresultate wurden in der Tat auf Auslandstourneen erzielt. Hieran lässt sich erahnen, dass Leningrad in der UdSSR technisch deutlich hinter Moskau zurücklag, klingen die zeitgleich entstandenen Melodija-Einspielungen Jewgeni Swetlanows doch bei weitem besser. Mrawinski machte, seinem Naturell entsprechend, übrigens seit Anfang der 1960er Jahre ohnehin keine Studioeinspielungen mehr, sondern bevorzugte das unmittelbare Live-Erlebnis.