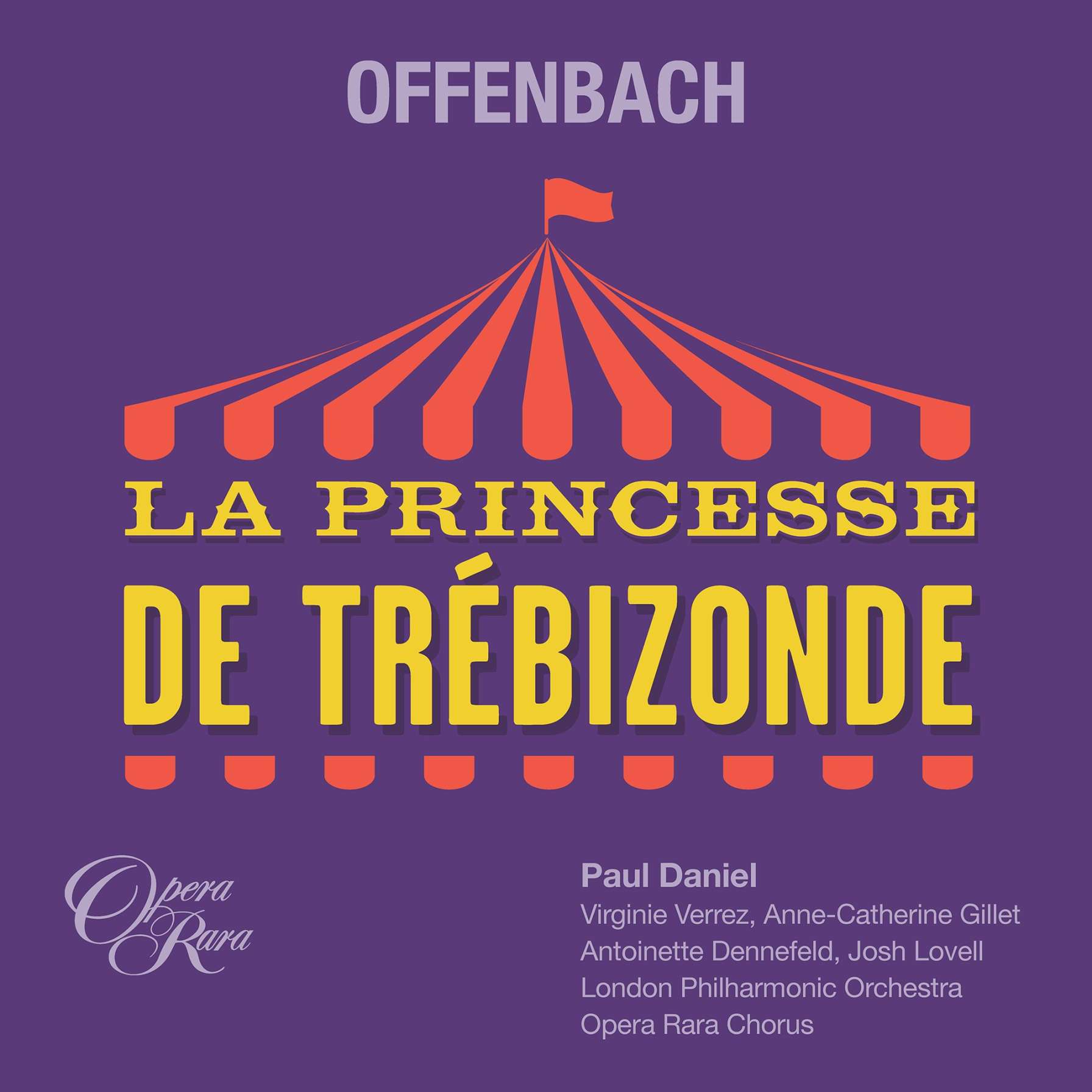.
Ferenc Fricsay brannte für die Musik und verbrannte vielleicht an ihr. Fricsay war, wie Peter Sühring in einer neu erschienenen Monographie über den Dirigenten schreibt „als musikalischer Künstler ein Besessener, dessen Drang zu musizieren, Musik unter seinen Händen entstehen zu lassen, unersättlich war.“ Das berichten auch die ihn kannten und Musiker, die mit ihm arbeiteten. In den penibel vorbereiteten Proben rasch und zielstrebig voranschreitend, unerbittlich in seinen Forderungen –dabei gelegentlich auch ungerecht und unangenehm gegenüber den Musikern. Er war aber alles Andere als ein eitler Musik- oder gar Selbstdarsteller. „Er hatte die Vorstellung, dass man die Musik erschaffe, indem man als Dirigent – wie ein werkbezogener Doppelgänger des Komponisten – die Musiker des Orchesters dazu inspiriert, ihre jeweilige Stimme im Sinne der Partitur und des in ihr vorgestellten Gesamtklangs zu spielen, sofern dieser aus den Noten erkennbar sei“ (Sühring, S. 21, dazu die Besprechung des Buches s. unten)
 Fricsay selbst betonte, dem Dirigenten stünden im Konzert „sein Gesichtsausdruck, seine Hände, sein Dirigentenstab, außerdem die mit diesen Mitteln ausgeführten Bewegungen und schließlich die Fähigkeit zum Führen … kurz Suggestion“ zur Verfügung. Und weiter: „Das Hauptziel ist, dass der Dirigent die in den Proben gegebenen Anweisungen bei den Musikern wieder wachruft und diese noch womöglich mit neuen Gedanken erweitert, ohne dass er damit den musikalischen Ablauf mit unpassenden Bemerkungen stört oder die Leitung des Orchesters hemmt.“ Fricsay war sogar der Auffassung, ein guter Dirigent spiele „das ganze Werk als Pantomime dem Orchester und auch dem Publikum vor, doch ständig etwas früher, als das Orchester es zum Klingen bringt, denn die Verzögerung zwischen der Wahrnehmung und der Ausführung darf nicht außer Acht gelassen werden“ (zit. nach Sühring, S. 21 f.). Wie er selbst dieses Ideal umsetzte, kann man anhand von Probenausschnitten auf einer CD und einer DVD verfolgen. Wie minuziös und detailliert Fricsay probte, verrät der (akustische) Mitschnitt einer Probe von Smetanas Moldau mit dem Symphonieorchester des Süddeutschen Rundfunks. Allerdings zeigt die anschließende Aufführung doch, dass die Musiker eher über ein Kurzzeitgedächtnis verfügen. Denn manches klingt eben nicht ganz so, wie vorher geprobt und wie der Dirigent es eigentlich wollte.
Fricsay selbst betonte, dem Dirigenten stünden im Konzert „sein Gesichtsausdruck, seine Hände, sein Dirigentenstab, außerdem die mit diesen Mitteln ausgeführten Bewegungen und schließlich die Fähigkeit zum Führen … kurz Suggestion“ zur Verfügung. Und weiter: „Das Hauptziel ist, dass der Dirigent die in den Proben gegebenen Anweisungen bei den Musikern wieder wachruft und diese noch womöglich mit neuen Gedanken erweitert, ohne dass er damit den musikalischen Ablauf mit unpassenden Bemerkungen stört oder die Leitung des Orchesters hemmt.“ Fricsay war sogar der Auffassung, ein guter Dirigent spiele „das ganze Werk als Pantomime dem Orchester und auch dem Publikum vor, doch ständig etwas früher, als das Orchester es zum Klingen bringt, denn die Verzögerung zwischen der Wahrnehmung und der Ausführung darf nicht außer Acht gelassen werden“ (zit. nach Sühring, S. 21 f.). Wie er selbst dieses Ideal umsetzte, kann man anhand von Probenausschnitten auf einer CD und einer DVD verfolgen. Wie minuziös und detailliert Fricsay probte, verrät der (akustische) Mitschnitt einer Probe von Smetanas Moldau mit dem Symphonieorchester des Süddeutschen Rundfunks. Allerdings zeigt die anschließende Aufführung doch, dass die Musiker eher über ein Kurzzeitgedächtnis verfügen. Denn manches klingt eben nicht ganz so, wie vorher geprobt und wie der Dirigent es eigentlich wollte.
Fricsay mag dem heutigen Musikpublikum nur noch bedingt in Erinnerung sein. Bis zu seinem frühen Tod war er vor allem in Berlin zu erleben. Hier hatte er mit dem RIAS- und späteren Radio-Symphonie-Orchester (heute Deutsches Symphonie-Orchester) seine wohl künstlerisch bedeutendste Heimat gefunden. Die Deutsche Grammophon-Gesellschaft versicherte sich schon 1949 des jungen, talentierten Dirigenten, der nicht nur als Chefdirigent des RSO Berlin sondern auch als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin das Musikleben der Stadt stark prägte. Die meisten Aufnahmen dieser 86-CD-Box entstanden mit dem RSO Berlin. Außerdem ging Fricsay mit den Berliner Philharmonikern, den Wiener Philharmonikern, dem Bayerischen Staatsorchester sowie dem Pariser Lamoureux-Orchester ins Aufnahmestudio.
 Wenn der Name Fricsay fällt, dann denken viele gleich an ungarische Musik. Fricsays Repertoire war freilich breit und vielseitig. In der vorliegenden Box sind 60 Komponisten vertreten – von Bartók, Beethoven, Brahms, Mozart bis zu Verdi, Wagner und Weber. Außerdem enthält die Sammlung allein acht Operneinspielungen von Gewicht.
Wenn der Name Fricsay fällt, dann denken viele gleich an ungarische Musik. Fricsays Repertoire war freilich breit und vielseitig. In der vorliegenden Box sind 60 Komponisten vertreten – von Bartók, Beethoven, Brahms, Mozart bis zu Verdi, Wagner und Weber. Außerdem enthält die Sammlung allein acht Operneinspielungen von Gewicht.
,
Mozart war ein, wenn nicht der Schwerpunkt von Fricsays Arbeit. Das belegen allein knapp 50 Aufnahmen mit Symphonien, Klavierkonzerten, Opern, geistlichen Werken und unterschiedlich besetzter Orchestermusik. Bleibende Highlights sind dabei die Klavierkonzerte Nr. 19, 20 und 27 mit Clara Haskil und Symphonien mit dem RIAS-Orchester und den Wiener Symphonikern, wobei die Wiener Aufnahme gelungener erscheint. Neben Mozart war Bartók der wichtigste Komponist in Fricsays Repertoire, hier hat er exemplarische Einspielungen hinterlassen – man denke nur an die auch heute noch faszinierende Gesamtaufnahme der Klavierkonzerte und der Klavierrhapsodie mit seinem Landsmann Géza Anda, die durch ihre Luzidität sowie ein faszinierendes, fabelhaftes Zusammenspiel aller Beteiligten imponiert. Weitere Bartók-Höhepunkte sind das zweite Violinkonzert mit Tibor Varga, das Klavierkonzert Nr. 3 mit Monique Haas und der Operneinakter Herzog Blaubarts Burg mit Dietrich Fischer-Dieskau und Hertha Töpper. Auch die Musik des anderen großen ungarischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, Zoltán Kodály, ist bei Fricsay in besten Händen, wie anhand der Maroszeker Tänze, der Tänze aus Galánta, der Háry-János-Suite oder des Psalmus Hungaricus erfahrbar ist.
.
 Beim klassischen und romantischen Repertoire ging es Fricsay mehr um die Vielfalt denn um vermeintliche Vollständigkeit. Mit den Berliner Philharmonikern entstand ein fast kompletter Zyklus der Beethoven–Symphonien (mit Ausnahme der Nr. 2, 4, 6): stellenweise etwas konventionell in Ton und Gangart, aber immer deutlich, sehr artikuliert, spannend, nie falsch heroisch, manchmal unerwartet drängend im Tempo. Sehr ausgewogen und zugleich voller Überraschungen spielt Annie Fischer das Dritte Klavierkonzert. Zu bewundern ist, wie Géza Anda, Wolfgang Schneiderhan und Pierre Fournier das Tripelkonzert musizieren, wie hier die Solisten miteinander und mit dem Orchester konzertieren. Symphonien von Haydn werden animiert, spannungsreich, nie behäbig oder gar zopfig musiziert. Brahms ist u. a. mit dem Zweiten Klavierkonzert (G. Anda), dem Konzert für Violine und Violoncello (W. Schneiderhan, Janos Starker) in beseelten und leidenschaftlichen Interpretationen vertreten.
Beim klassischen und romantischen Repertoire ging es Fricsay mehr um die Vielfalt denn um vermeintliche Vollständigkeit. Mit den Berliner Philharmonikern entstand ein fast kompletter Zyklus der Beethoven–Symphonien (mit Ausnahme der Nr. 2, 4, 6): stellenweise etwas konventionell in Ton und Gangart, aber immer deutlich, sehr artikuliert, spannend, nie falsch heroisch, manchmal unerwartet drängend im Tempo. Sehr ausgewogen und zugleich voller Überraschungen spielt Annie Fischer das Dritte Klavierkonzert. Zu bewundern ist, wie Géza Anda, Wolfgang Schneiderhan und Pierre Fournier das Tripelkonzert musizieren, wie hier die Solisten miteinander und mit dem Orchester konzertieren. Symphonien von Haydn werden animiert, spannungsreich, nie behäbig oder gar zopfig musiziert. Brahms ist u. a. mit dem Zweiten Klavierkonzert (G. Anda), dem Konzert für Violine und Violoncello (W. Schneiderhan, Janos Starker) in beseelten und leidenschaftlichen Interpretationen vertreten.
.
 Die wichtigsten Opern-Dokumente sind die Aufnahmen von Mozarts Entführung aus dem Serail, Die Zauberflöte, Don Giovanni, Le nozze di Figaro mit den bedeutenden und bewährten Sängerinnen und Sängern der Zeit (wie Ernst Haefliger, Maria Stader, Josef Greindl, Dietrich Fischer-Dieskau, Sena Jurinac, Irmgard Seefried), dem fabelhaften RIAS-Kammerchor und dem RSO Berlin. Mozarts Idomeneo entstand 1961 mit Waldemar Kmennt, Ernst Haefliger, Elisabeth Grümmer, Pilar Lorengar u.a., dem Chor der Wiener Staatsoper und den Wiener Philharmonikern bei den Salzburger Festspielen. Insbesondere der Berliner Don Giovanni mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelrolle, Karl Christian Kohn als Leporello, Sena Jurinac als Donna Anna und Maria Stader als Donna Elvira ist nach wie vor eine mitreißende Referenzaufnahme. 1956 entstand Glucks Orpheus und Eurydike mit Dietrich Fischer-Dieskau und Maria Stader als Protagonisten, 1952 wurde in Berlin Wagners Der fliegende Holländer mit Josef Metternich, Josef Greindl, Annelies Kupper, Wolfgang Windgassen u. a. eingespielt. Beethovens Fidelio nahm Fricsay 1957 in München mit Leonie Rysanek, Ernst Haefliger, Dietrich Fischer-Dieskau u. a sowie dem Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper auf. Bei den Vokal– bzw. Chorwerken reicht die Spannweite von Mozarts Requiem und Großer Messe c-Moll, Haydns Jahreszeiten über Rossinis Stabat Mater und Verdis Messa da Requiem bis zu Kodálys Psalmus Hungaricus und Strawinskys Oratorium Oedipus Rex.
Die wichtigsten Opern-Dokumente sind die Aufnahmen von Mozarts Entführung aus dem Serail, Die Zauberflöte, Don Giovanni, Le nozze di Figaro mit den bedeutenden und bewährten Sängerinnen und Sängern der Zeit (wie Ernst Haefliger, Maria Stader, Josef Greindl, Dietrich Fischer-Dieskau, Sena Jurinac, Irmgard Seefried), dem fabelhaften RIAS-Kammerchor und dem RSO Berlin. Mozarts Idomeneo entstand 1961 mit Waldemar Kmennt, Ernst Haefliger, Elisabeth Grümmer, Pilar Lorengar u.a., dem Chor der Wiener Staatsoper und den Wiener Philharmonikern bei den Salzburger Festspielen. Insbesondere der Berliner Don Giovanni mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelrolle, Karl Christian Kohn als Leporello, Sena Jurinac als Donna Anna und Maria Stader als Donna Elvira ist nach wie vor eine mitreißende Referenzaufnahme. 1956 entstand Glucks Orpheus und Eurydike mit Dietrich Fischer-Dieskau und Maria Stader als Protagonisten, 1952 wurde in Berlin Wagners Der fliegende Holländer mit Josef Metternich, Josef Greindl, Annelies Kupper, Wolfgang Windgassen u. a. eingespielt. Beethovens Fidelio nahm Fricsay 1957 in München mit Leonie Rysanek, Ernst Haefliger, Dietrich Fischer-Dieskau u. a sowie dem Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper auf. Bei den Vokal– bzw. Chorwerken reicht die Spannweite von Mozarts Requiem und Großer Messe c-Moll, Haydns Jahreszeiten über Rossinis Stabat Mater und Verdis Messa da Requiem bis zu Kodálys Psalmus Hungaricus und Strawinskys Oratorium Oedipus Rex.
:
 Manche Werke sind in zwei Einspielungen vertreten – mit dem gleichen oder verschiedenen Orchester/n. Die Wahl für die eine oder andere Aufnahme ist weitestgehend subjektiv. Auffällig ist indes, dass ein Fortschritt in der Aufnahmetechnik (wie der Wechsel von Mono zu Stereo) kein qualitativer Sprung sein muss. Bedeutender scheint mir, dass Fricsay in seinen frühen Interpretationen vielfach raschere Tempi wählte, mit mehr Temperament und Leidenschaft musizieren ließ. Beispielhaft: Die Aufnahme der Neunten Symphonie von Dvořák mit den Berliner Philharmonikern imponiert auch heute noch, doch ungleich drängender, packender, feuriger und auch (in Mono!) klanglich direkter ist die Einspielung mit dem RIAS-Symphonieorchester. Auch Tschaikowskys Sechste Symphonie wurde zweimal aufgenommen. Die frühere (Mono-) Einspielung mit den Berliner Philharmonikern ist interessanter, zügiger in den Tempi, spannender als die spätere (stereophone) mit dem RIAS-Orchester, die mir konventioneller und spannungsärmer erscheint. Verdis Messa da Requiem (großenteils ähnlich besetzt) ist in der Aufnahme von 1953 drängender, eindringlicher, nicht über-dramatisch, klanglich gelungener als die Produktion von 1960, die stellenweise zu getragen ist und dadurch an Spannung verliert, aber andererseits auch sehr feine pianissimi bietet.
Manche Werke sind in zwei Einspielungen vertreten – mit dem gleichen oder verschiedenen Orchester/n. Die Wahl für die eine oder andere Aufnahme ist weitestgehend subjektiv. Auffällig ist indes, dass ein Fortschritt in der Aufnahmetechnik (wie der Wechsel von Mono zu Stereo) kein qualitativer Sprung sein muss. Bedeutender scheint mir, dass Fricsay in seinen frühen Interpretationen vielfach raschere Tempi wählte, mit mehr Temperament und Leidenschaft musizieren ließ. Beispielhaft: Die Aufnahme der Neunten Symphonie von Dvořák mit den Berliner Philharmonikern imponiert auch heute noch, doch ungleich drängender, packender, feuriger und auch (in Mono!) klanglich direkter ist die Einspielung mit dem RIAS-Symphonieorchester. Auch Tschaikowskys Sechste Symphonie wurde zweimal aufgenommen. Die frühere (Mono-) Einspielung mit den Berliner Philharmonikern ist interessanter, zügiger in den Tempi, spannender als die spätere (stereophone) mit dem RIAS-Orchester, die mir konventioneller und spannungsärmer erscheint. Verdis Messa da Requiem (großenteils ähnlich besetzt) ist in der Aufnahme von 1953 drängender, eindringlicher, nicht über-dramatisch, klanglich gelungener als die Produktion von 1960, die stellenweise zu getragen ist und dadurch an Spannung verliert, aber andererseits auch sehr feine pianissimi bietet.
:
 Die Edition erinnert erfreulicherweise auch an seinerzeit bedeutende Interpretinnen und ihre männlichen Kollegen. An erster Stelle ist die ziemlich in Vergessenheit geratene schweizerische Pianistin Margrit Weber (1924-2001) zu nennen, deren Karriere 1955 begann, als Fricsay sie in Winterthur kennenlernte und gleich von ihrem Klavierspiel beeindruckt war. Er lud sie zu Konzerten ein und nahm mit ihr eine Reihe konzertanter Kompositionen auf: de Fallas „Nächte in spanischen Gärten“, Rachmaninows Paganini-Rhapsodie, seltener gespielte Werke wie die Concertinos von Francaix und Honegger, die reizvollen Bagatellen von Alexander Tscherepnin, nicht zu vergessen die Strauss’sche Burleske und die spröden Mouvements von Strawinsky. Die Geigerinnen Johanna Martzy und Erica Morini sind mit den Konzerten von Dvorák bzw. Bruch und Glasunow zu erleben. Sie spielen diese Werke virtuos, schlank, gefühlvoll, aber nicht sentimental und werden vom RSO subtil begleitet. Mit Wolfgang Schneiderhan erlebt man Mendelssohns Violinkonzert e-Moll ebenfalls schlank, frei von Schnörkeln, ohne jedes Auftrumpfen, immer gut eingebettet in den Orchesterklang.
Die Edition erinnert erfreulicherweise auch an seinerzeit bedeutende Interpretinnen und ihre männlichen Kollegen. An erster Stelle ist die ziemlich in Vergessenheit geratene schweizerische Pianistin Margrit Weber (1924-2001) zu nennen, deren Karriere 1955 begann, als Fricsay sie in Winterthur kennenlernte und gleich von ihrem Klavierspiel beeindruckt war. Er lud sie zu Konzerten ein und nahm mit ihr eine Reihe konzertanter Kompositionen auf: de Fallas „Nächte in spanischen Gärten“, Rachmaninows Paganini-Rhapsodie, seltener gespielte Werke wie die Concertinos von Francaix und Honegger, die reizvollen Bagatellen von Alexander Tscherepnin, nicht zu vergessen die Strauss’sche Burleske und die spröden Mouvements von Strawinsky. Die Geigerinnen Johanna Martzy und Erica Morini sind mit den Konzerten von Dvorák bzw. Bruch und Glasunow zu erleben. Sie spielen diese Werke virtuos, schlank, gefühlvoll, aber nicht sentimental und werden vom RSO subtil begleitet. Mit Wolfgang Schneiderhan erlebt man Mendelssohns Violinkonzert e-Moll ebenfalls schlank, frei von Schnörkeln, ohne jedes Auftrumpfen, immer gut eingebettet in den Orchesterklang.
.
Von den Komponisten des 20. Jahrhunderts lagen Fricsay – wenn man das an seinen Aufnahmen misst – besonders Boris Blacher, Rolf Liebermann, Gottfried von Einem, Werner Egk, aber auch Hans Werner Henze und die schon als Klassiker zählenden Igor Strawinsky, Paul Hindemith, Karl Amadeus Hartmann – außerdem Frank Martin, dessen apart besetzte Petite symphonie concertante schon dank der vortrefflichen Solistinnen Irmgard Helmis (Cembalo), Gerty Herzog (Klavier), Sylvia Kind (Harfe) eine der wertvollsten und schönen Einspielungen mit dem RIAS-Symphonie-Orchester ist.
.
 Fricsay beherrscht als gebürtiger Ungar auch die „leichte“ Musik, war mit dem Idiom Österreich-Ungarns bestens vertraut, konnte den Orchestern, mit denen er arbeitete, sogar eine gewisse Walzerseligkeit abgewinnen. Mit Peter Anders, Anny Schlemm und weiteren Solisten, dem RIAS-Orchester und RIAS-Kammerchor stellte er eine respektable Fledermaus auf die Beine. Lange vor anderen Dirigenten interpretierte er die Symphonien von Tschaikowsky schlank, unsentimental, ohne Pathos, sehr temperamentvoll. Er setzte sich auch für den russischen Komponisten Reinhold Glière ein, dessen Dritte Symphonie „Ilja Murometz“, eher ein grandioses Orchesterpoem denn eine herkömmliche Symphonie ist. Nicht zuletzt nahm er sich auch der „kleineren“ Orchesterwerke der Klassik und Romantik an, widmete diesen die gleiche Sorgfalt in der Aufführung und Inszenierung wie den „großen“ Werken des Repertoires.
Fricsay beherrscht als gebürtiger Ungar auch die „leichte“ Musik, war mit dem Idiom Österreich-Ungarns bestens vertraut, konnte den Orchestern, mit denen er arbeitete, sogar eine gewisse Walzerseligkeit abgewinnen. Mit Peter Anders, Anny Schlemm und weiteren Solisten, dem RIAS-Orchester und RIAS-Kammerchor stellte er eine respektable Fledermaus auf die Beine. Lange vor anderen Dirigenten interpretierte er die Symphonien von Tschaikowsky schlank, unsentimental, ohne Pathos, sehr temperamentvoll. Er setzte sich auch für den russischen Komponisten Reinhold Glière ein, dessen Dritte Symphonie „Ilja Murometz“, eher ein grandioses Orchesterpoem denn eine herkömmliche Symphonie ist. Nicht zuletzt nahm er sich auch der „kleineren“ Orchesterwerke der Klassik und Romantik an, widmete diesen die gleiche Sorgfalt in der Aufführung und Inszenierung wie den „großen“ Werken des Repertoires.
.

Der Autor unseres Artikels zu Ferenc Fricsay, Helge Grünewald: Jahrgang 1947, studierte in Berlin Politikwissenschaft, Soziologie und Musikwissenschaft. Seit 1973 als Musikjournalist tätig. Arbeit für verschiedene Rundfunkanstalten (SFB, DeutschlandRadio), Orchester (Radio-Symphonie-Orchester Berlin, Berliner Philharmoniker), die Berliner Festspiele, Zeitschriften (FONO FORUM, Klassik heute), Zeitungen sowie Schallplattenfirmen. Von 1989 bis 2006 Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Philharmoniker, danach bis 2016 Dramaturg mit Zuständigkeit für Ausstellungen, das Archiv des Orchesters, die Herausgabe historischer Aufnahmen sowie die von ihm initiierte Filmreihe »Musik bewegt Bilder«. Seit 2016 ist er Präsident der Wilhelm-Furtwängler-Gesellschaft, seit 2011 Juror beim PdSK/ Foto Ines Grabner
Zur Edition gibt es ein stattliches, informatives Begleitbuch mit vielen Abbildungen. Ausgesprochen ärgerlich ist allerdings die Gewohnheit, die CDs bei solchen „Complete“-Editionen in den miniaturisierten Hüllen der Originalausgaben zu präsentieren. Doch leider finden sich zu oft gar nicht Werke in der Hülle, die auf dem Cover stehen. So darf die Hörerschaft dann mühsam anhand des Booklets mit seinem Verzeichnis aller CDs die Titel suchen, die sich zwar auf dem Cover, aber nicht auf der enthaltenen CD finden. Das trübt den Genuss!
.
.Eine ideale Ergänzung, informative und anregende Lektüre zu der umfangreichen Edition der DG bietet das fast zeitgleich erschienene Buch von Peter Sühring: „Ferenc Fricsay – der Dirigent als Musiker“ (edition text & kritik im Richard Boorberg Verlag, München 2023). Der Autor versucht in seiner Monographie, „eine neue Sicht auf Leben und Wirken des Dirigenten zu geben“, vor allem „auf Grundlage einer Erschließung seines Nachlasses im Archiv der Akademie der Künste in Berlin“. Der 200 Seiten starke Band ist (zum Glück) keine der Musikerbiographien, wie man sie kennt.
Sühring verfolgt weniger die persönliche Biographie des Dirigenten als dessen künstlerische Entwicklung: von der Kindheit und Jugend und der musikalischen Ausbildung über die Arbeit als Kapellmeister von Militärorchestern (die auch Unterhaltungsmusik und anspruchsvolle symphonische Werke aufführten), als Dirigent des Philharmonischen Orchesters in Szeged (auch Opern) über die Tätigkeit am Budapester Opernhaus bis zum internationalen Debüt in Salzburg (1947) und der Entscheidung für Berlin als künstlerischer Mittelpunkt. Hier dirigierte Fricsay im Herbst 1948 zunächst das Berliner Rundfunk-Sinfonieorchester, reüssierte dann rasch an der Städtischen Oper (später Deutscher Oper Berlin). Erst danach begann seine Arbeit mit dem RIAS-Orchester.
 Das Verdienst von Peter Sühring ist es, auch die Komplikationen bei Fricsays künstlerischer Arbeit in Berlin detailliert aufzuzeigen: die Schwierigkeiten, die das RIAS-Orchester hatte, seine Auflösung und Neugründung als Radio-Symphonie-Orchester Berlin, die Probleme, die Fricsay als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper und auch an der Münchner Oper hatte, weil er sich weigerte, faule Kompromisse einzugehen und seine hochgesteckten künstlerischen Ziele und Forderungen aufzugeben. Das Buch ist zugleich eine Geschichte des Musiklebens in Nachkriegsdeutschland, besonders in Berlin.
Das Verdienst von Peter Sühring ist es, auch die Komplikationen bei Fricsays künstlerischer Arbeit in Berlin detailliert aufzuzeigen: die Schwierigkeiten, die das RIAS-Orchester hatte, seine Auflösung und Neugründung als Radio-Symphonie-Orchester Berlin, die Probleme, die Fricsay als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper und auch an der Münchner Oper hatte, weil er sich weigerte, faule Kompromisse einzugehen und seine hochgesteckten künstlerischen Ziele und Forderungen aufzugeben. Das Buch ist zugleich eine Geschichte des Musiklebens in Nachkriegsdeutschland, besonders in Berlin.
Zum Glück ist die vorliegende Monographie keine „Hagiographie“ Ferenc Fricsays. So bleibt sein persönliches Schicksal, seine Krankheitsgeschichte nicht ausgespart. Auf der einen Seite standen Verausgabung, kräftezehrende Arbeit, auf der anderen Enttäuschung über das Nichterreichen hochgesteckter Ziele. Fricsays Schwachstelle waren sein Magen und Darm, er litt an psychisch bedingten somatischen Störungen und Krankheiten, die letztendlich zu seinem frühen Tod führten. Nach Jahren, in denen die Krankheit immer wieder zuschlug, und mehreren Operationen mit zum Teil folgenden Komplikationen starb Ferenc Fricsay am 20. Februar 1963 im Alter von 48 Jahren in Basel. Die Erinnerung an ihn kommt 60 Jahre nach seinem Tod genau zur richtigen Zeit. Helge Grünewald



 Jahre vor Oehms war – versehen mit einem entsprechenden Hinweis auf dem Cover – die erste Aufnahme des Oratoriums
Jahre vor Oehms war – versehen mit einem entsprechenden Hinweis auf dem Cover – die erste Aufnahme des Oratoriums





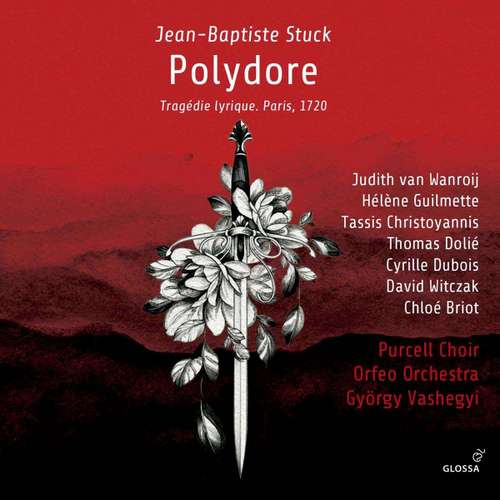




 Ganz anders kommt die CD mit dem Titel
Ganz anders kommt die CD mit dem Titel  Schließlich soll über eine CD mit Spirituals berichtet werden, die der amerikanische Countertenor
Schließlich soll über eine CD mit Spirituals berichtet werden, die der amerikanische Countertenor 
 Fricsay selbst betonte, dem Dirigenten stünden im Konzert „sein
Fricsay selbst betonte, dem Dirigenten stünden im Konzert „sein  Wenn der Name Fricsay fällt, dann denken viele gleich an ungarische Musik.
Wenn der Name Fricsay fällt, dann denken viele gleich an ungarische Musik.  Beim
Beim  Die wichtigsten
Die wichtigsten  Manche Werke sind in zwei Einspielungen vertreten
Manche Werke sind in zwei Einspielungen vertreten Die Edition erinnert erfreulicherweise auch an seinerzeit
Die Edition erinnert erfreulicherweise auch an seinerzeit  Fricsay beherrscht als gebürtiger Ungar auch
Fricsay beherrscht als gebürtiger Ungar auch 
 Das Verdienst von Peter Sühring ist es, auch die Komplikationen bei Fricsays künstlerischer Arbeit in Berlin detailliert aufzuzeigen: die Schwierigkeiten, die das RIAS-Orchester hatte, seine Auflösung und Neugründung als Radio-Symphonie-Orchester Berlin, die Probleme, die Fricsay als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper und auch an der Münchner Oper hatte, weil er sich weigerte, faule Kompromisse einzugehen und seine hochgesteckten künstlerischen Ziele und Forderungen aufzugeben. Das Buch ist zugleich eine Geschichte des Musiklebens in Nachkriegsdeutschland, besonders in Berlin.
Das Verdienst von Peter Sühring ist es, auch die Komplikationen bei Fricsays künstlerischer Arbeit in Berlin detailliert aufzuzeigen: die Schwierigkeiten, die das RIAS-Orchester hatte, seine Auflösung und Neugründung als Radio-Symphonie-Orchester Berlin, die Probleme, die Fricsay als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper und auch an der Münchner Oper hatte, weil er sich weigerte, faule Kompromisse einzugehen und seine hochgesteckten künstlerischen Ziele und Forderungen aufzugeben. Das Buch ist zugleich eine Geschichte des Musiklebens in Nachkriegsdeutschland, besonders in Berlin.