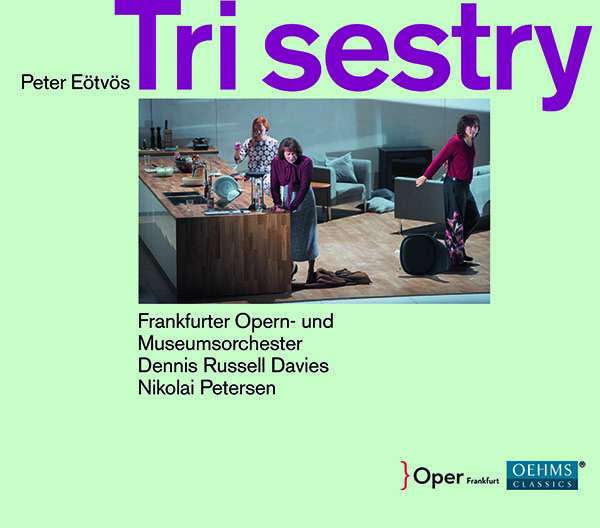Ab dem 15. Dezember 2019 ist Raina Kabaivanska, Italiens unangefochtene Diva, unglaubliche 85 Jahre jung, denn von Alter kann man bei dieser hocheleganten, wirklich exquisiten Frau nicht sprechen, die einem da schlank und in beste italienische alta moda gekleidet entgegen kommt. Ich habe Raina stets für ihren erlesenen Geschmack bewundert – sie war für mich immer der Inbegriff einer italienischen, kultivierten und klugen Frau (mit extrem schönen Beinen, wenn man das als Mann etwas ungalant so konstatieren darf – sie ist zudem eine der wenigen Sängerinnen, zu der ich Du sage.).

Raina Kabaivanska, die Zeitlose/gboperamagazin
Ich erinnere mich genau an die Male, die wir uns in Palermo (für ihre Francesca neben dem jungen Cura) oder Martina Franca (ein exquisiter Lieder- und Arienabend) oder Paris (dto., wobei mir von diesem Abend vor allem die hinreißend gesungene Arie der Pamira aus dem Siège de Corinth wegen ihrer unglaublichen Piano-Kunst in Erinnerung geblieben ist) gesehen haben. Und natürlich an die bis heute nachhallende Adriana Lecouvreur neben dem schmelzend singenden Franco Tagliavini in Modena. An dieser nahm die ganze Stadt teil und ehrte ihre große Künstlerin. Denn sie wohnt ebenda.
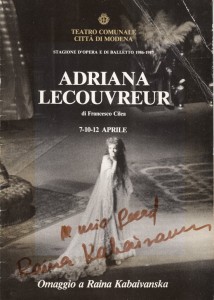 Raina Kabaivanska war über Jahrzehnte der Inbegriff der Butterfly in Verona, die Tosca und die Adriana Italiens und in der Welt, sie hat in allen großen Häusern (und viel in Berlin die Tosca neben Pavarotti) gesungen. Sie ist als geborene Bulgarin zur Ur-Italienerin geworden und wurde mit ihrer Erscheinung und eleganten, hochindividuellen Präsenz zum Mythos auf Italiens Bühnen, nachdem die Kollegin Renata Scotto zum Star der Met wurde. Niemand machte der Kabaivanska über viele Jahre diesen Rang streitig, und bis heute hat sich für sie – die Erbin der Olivero – keine Nachfolgerin gefunden.
Raina Kabaivanska war über Jahrzehnte der Inbegriff der Butterfly in Verona, die Tosca und die Adriana Italiens und in der Welt, sie hat in allen großen Häusern (und viel in Berlin die Tosca neben Pavarotti) gesungen. Sie ist als geborene Bulgarin zur Ur-Italienerin geworden und wurde mit ihrer Erscheinung und eleganten, hochindividuellen Präsenz zum Mythos auf Italiens Bühnen, nachdem die Kollegin Renata Scotto zum Star der Met wurde. Niemand machte der Kabaivanska über viele Jahre diesen Rang streitig, und bis heute hat sich für sie – die Erbin der Olivero – keine Nachfolgerin gefunden.
Rainas unglaublich umfangreiches Repertoire vom anfänglich Bellini, Puccini und Verdi bis hin zu Gluck, Spontini, Donizetti, Poulenc, Weil oder Johann wie Richard Strauss würdigt meine Kollegin Ingrid Wanja, die das nachfolgende Gespräch mit der Sängerin anlässlich einer der vielen, vielen Ehrungen der Künstlerin (diese war in Parma) gehalten hat und dann die die folgenden Karrierejahre- und Ereignisse auffüllt. Aber 85 Jahre Raina Kabaivanska – das mag man einfach nicht glauben! Auguri profondi e cordialissimi, Raina!!! G. H.
Am Abend zuvor hatte sie mit einem Arienabend in Neapel das frisch renovierte Augusteo eingeweiht, am späten Nachmittag des nächsten Tages war sie in Parma eleganter und strahlender Mittelpunkt einer Ehrung, die in den Jahren zuvor Bergonzi und Bruson zuteil geworden war; ziemlich früh am Morgen des 14. dann trafen wir uns zum Interview in ihrem Haus in Modena.
Raina, es sind fast zehn Jahre vergangen, seit wir unser letztes Interview gemacht haben, zehn Jahre, in denen Du eine Menge neuer künstlerischer Erfahrungen gesammelt hast, in denen sich die Zahl Deiner Schallplatten aber nur unwesentlich erhöht hat, so dass die Präsentierung Deiner Arien-Platte gestern in Parma ein schon beinahe ungewöhnliches Ereignis ist. Meine ganze Karriere ist eine absolut anormale. In einer Welt, die von perfekter Organisation, von Computern beherrscht ist, ist sie ein reines Kunstprodukt. Ich habe meine Karriere ganz auf mich selbst gestellt gemacht, ohne Unterstützung oder Beistand von irgendjemandem. Bis vor einigen Jahren war ich nicht einmal an eine Agentur gebunden. Ich kann mir also, ohne überheblich zu sein, einbilden, dass ich wirklich „brava“ bin, denn eine andere Erklärung für meinen Erfolg kann ich beim besten Willen nicht finden. Eher Eigenschaften, die einen Misserfolg programmieren müssten: mein absolutes Streben nach Unabhängigkeit, meine bulgarische Dickköpfigkeit, aber auch meine Unsicherheit…
Unsicherheit in welchem Sinn? Eine Art Minderwertigkeitsgefühl, weil ich aus einem kleinen, fremden Land kam, weil ich mich sehr lange fremd gefühlt habe und es manchmal noch tue. Das hat mich immer befürchten lassen, daß dieses mal Singen das letzte sein könnte. Erst in den vergangenen Jahren habe ich etwas Sicherheit gewonnen, weil ich endlich Resultate sehe, Erfolge, die Liebe des Publikums – das alles gibt mir jetzt etwas Sicherheit. Ich bin immer den Situationen, die an das Star-System denken ließen, ausgewichen. Damit bin ich auch vor Angeboten geflüchtet, wie sie vielleicht keinem anderen Sänger auf der Welt gemacht wurden. Als ich zum Beispiel 1962 an der Met debütiert habe, hat für mich der damals wichtigste Agent der Vereinigten Staaten, ein wunderbarer alter Mann, im Hotel Plaza ein Essen gegeben und danach einen Vertrag aus der Tasche gezogen, in dem er mir für fünf Jahre zwei Vorstellungen oder Konzerte wöchentlich zusagte. 1200 Dollar pro Abend sollte ich bekommen – damals eine schöne Summe. Ich sagte mit seraphischem Lächeln: „No grazie, ich bin verlobt und möchte in Italien bleiben, unabhängig sein und für mich allein entscheiden“. Vielleicht war das eine verlorene Chance, vielleicht aber auch die Rettung vor einem grausamen System, vor dem Zwang, fünf Jahre lang.

Raina Kabaivanska: Elisabetta in „Roberto Devereux“/OBA/Raina Kabaivanska:
Aber es bleibt im Gedächtnis des Publikums... Ja, das ist die einzige Hoffnung. So wie die Hoffnung, dass auch noch nach einigen Jahren in der Pause einer Vorstellung jemand zu seinen Freunden sagt: „Ricordate la Butterfly… la Francesca… la Adriana della Kabaivanska.“ Der Sänger darf nicht berechnend sein und Platten machen, nur um im Gespräch zu bleiben. Was ich besonders monströs finde, sind die Schallplatten von Rollen, die der Künstler nie auf der Bühne gesungen hat. Sie sind una cosa nata morta, denn Oper ist pure Emotion, die Platte aber Technik. Sie ist vleleicht perfekter, aber nicht lebendig. Instinktiv habe ich mich also vor diesem System gerettet. Ich bin zwar jetzt ein Star, aber molto italiana, das heißt, ich habe die Met und Covent Garden verlassen, als ich geheiratet habe, ich bin anomal, weil ich auch eine ganz normale Frau sein wollte. Um die Nummer Eins zu sein, musst du alles opfern. Eben das will ich nicht. Für mich ist es wichtiger, dieses Haus zu haben, diesen wunderbaren Mann, eine Tochter, die gesund heranwächst.
Welches ist die Rolle, mit der Du Dich am meisten identifizierst und mit der Du am meisten identifiziert werden möchtest? Butterfly, die nicht die übliche Butterfly ist. Butterfly, die ich mit sehr viel Würde und Stolz ausstatte. Ich habe ihr stets gegeben, was ich selbst sein will. Sie ist nicht schwach, in Tränen aufgelöst. Meine Butterfly ist eine stolze Frau, die sich umbringt, um ihre Würde zu bewahren. Sie ist keine kleine, schwache Trippelnde – die angeblich original japanischen Butterflys sind ein großer Unsinn. Meine Cio-Cio-San ist italienisch, europäisch, universell. Eine so große Persönlichkeit darf nicht künstlich verkleinert werden. Sie ist das Denkmal der Mutter, die alles für ihr Kind opfert. Sie in erster Linie als Japanerin zu sehen, hieße sie begrenzen, sie kastrieren.

Raina Kabaivanska: als Adriana Lecouvreur/OBA/Raina Kabaivanska:
Du hast noch – neben- und durcheinander – eine Karriere im slawischen, im Belcanto-Fach, im veristischen Fach und vieles andere gemacht Worin siehst Du Deine eigentliche Berufung? Der wahre Künstler darf keine Grenzen kennen außer den natürlichen Grenzen – und meine kenne ich sehr genau. Aber meine Gedanken, meine Überlegungen kennen keine Grenzen, der Wunsch, immer wieder etwas Neues zu machen, kennt keine Grenzen.
Und ich will Dir ein Geheimnis anvertrauen: Wenn ich meine Karriere bald beenden sollte was ich nicht hoffe (und was auch nicht passierte, wie man weiß) – würde ich es mit meiner neuesten Partie tun: mit der Emilia Marty in Janáceks Makropoulos, die ich in Torino erstmals singen will. Das gefiele mir, weil es sehr symbolisch wäre, denn immerhin kann ich auf eine lange Karriere zurückblicken. Also steht diese Opernsängerin, die nicht sterben kann und zum Singen verdammt ist, mir sehr nahe. Am Ende stirbt sie, und vielleicht sterbe ich mit ihr auf der Bühne. Meine Neugier hat mich immer dazu getrieben, neue Abenteuer für meine Stimme zu suchen, und wegen meiner schrecklichen Selbstkritik habe ich nur Sachen gemacht, die ich wirklich bis hin zur letzten Note machen konnte. Ich habe mich stets vorher vergewissert, ob ich die Partie wirklich so singen kann, wie der Komponist sie geschrieben hat. Ich fühle mich vor allem als musicista, sehe in jedem Piano, jedem Crescendo einen dramaturgischen Sinn. Alle dynamischen Zeichen müssen so gesungen werden, wie sie geschrieben sind, denn sie drücken ein Gefühl aus, ohne dass die Person unvollkommen ist.
Ohne von diesem Grundsatz abzuweichen, möchte ich mit Janácek keinen Ring schließen, der seinen Anfang mit Gluck genommen, Spontini, Bellini, Donizetti, Verdi, die Veristen umfasst hat. Ich habe fast den gesamten Verdi gesungen und von Puccini alles außer der Fanciulla, die mir unendlich oft angeboten wurde. Viel Verismo habe ich – allem Anschein entgegen – nicht gesungen. Man bietet mir immer wieder Santuzza, Fedora an, aber ich mag den extremen Verismo nicht.
Am Anfang meiner Karriere habe ich alles singen müssen, weil ich ja schließlich essen wollte. Ich hatte keinerlei finanzielle Reserven, habe also zum Beispiel Busonis Turandot an der Scala gemacht. Später hat man sie mir für den Maggio Fiorentino angeboten, und ich habe ihnen die Noten zurückgeschickt, weil ich sie nicht singen konnte. Mit der Unbekümmertheit der Jugend habe ich Dinge gemacht, die ich später abgelehnte. Immerhin haben sie mir geholfen, Karriere zu machen. Die Entscheidung richtet sich danach, ob ich die Musik singen kann. Der Verzicht auf die Lady Macbeth fällt mir deshalb leicht, weil ich zwar eine interessante Figur (in meinem Kopf ist sie schon perfekt) darstellen könnte, weil ich aber auch weiß, dass ich vier, fünf Takte nicht optimal singen könnte, weil einige Noten zu tief sind und mir die Koloraturen nicht selbstverständlich in der Stimme liegen. Andere Soprane hat das nicht gestört. Ich verzichte lieber auf die Darstellung einer interessanten Figur, als mich in vokale Schwierigkeiten zu bringen.

Raina Kabaivanska: als „Capriccio“-Contessa in Bologna/TMB
Im Athener Konzert zum Gedenken an Maria Callas warst Du die einzige Mitwirkende, die noch einen direkten Kontakt zu der Gefeierten hatte. Sie hat bei der Wiedereröffnung des Teatro Regio in Turin zusammen mit Giuseppe di Stefano Regie in Verdis Vespri Siciliani geführt, und du hast eine Rolle gesungen, die sie selbst auch interpretiert hatte. In einem Buch, das ziemliches Aufsehen erregt hat, behauptet Di Stefanos Ex-Gattin, dass die Callas zumindest menschlich sehr problematisch war. Welche Erfahrungen hast Du damals mit ihr gemacht? Die Callas war zuerst einmal ein musikalisches Phänomen, wie es nur einmal in einem Jahrhundert auftritt. Sie war ein vokales Phänomen, dessen Stimme alle schauspielerischen Bemühungen überflüssig erscheinen ließ, gerecht kann man ihr nur werden, wenn man sie als musicista sieht.
Ich schäme mich ein bisschen, von der Callas zu sprechen, weil ich mich ihr gegenüber schuldig fühle. Schuldig, weil ich in ihr eine sehr einsame Frau kennengelernt habe, die ein großes Bedürfnis nach Freundschaft hatte. Sie hat dieses Verhältnis mit Di Stefano gehabt, aber ich glaube, es war nur ein Versuch, der Einsamkeit zu entrinnen. Callas lebte nur auf der Bühne wirklich, nur durch die Personen, die sie auf der Bühne verkörperte. Darin besteht ihre Größe als Künstlerin. Im realen Leben war sie nicht besonders interessant. Sie hatte mich um meine Freundschaft gebeten, aber ich habe sie ihr nicht geben können; vielleicht weil ich zu jung, zu sehr mit mir selbst beschäftigt war. Callas hat mich mit nach Paris nehmen wollen, um mit mir die Violetta zu studieren. Sie sagte: „Komm mit mir nach Paris, ich will dir helfen.“ Und ich meinte: „Signora, non ho tempo“. Ich sah die Traurigkeit in ihren Augen, die Traurigkeit einer entsetzlich einsamen Frau, die ohne das Theater nicht leben konnte. Aber das habe ich erst viel später erkannt, und noch heute schäme ich mich, weil ich nicht bereit war ihr zu helfen. Eifersucht, weil ich jetzt ihre Rolle sang, schien sie nicht zu kennen. Jahre später habe ich gehört, dass die Ricciarelli, die damals debütiert und viel Unterstützung hatte, meine Rolle bekommen sollte, denn die Neueröffnung des Teatro Regio war ein großes Ereignis und wichtig für eine Sängerkarriere. Sie haben Callas unter Druck gesetzt, und sie soll gesagt haben: „Ich kenne weder Kabaivanska noch Ricciarelli, aber wenn Kabaivanska den Vertrag hat, soll sie singen.“ Sie war auch als Mensch über dem Durchschnitt, so wie im Grunde ein großer Künstler nie ein kleiner Mensch sein kann – von wenigen Ausnahmen abgesehen.

Raina Kabaivanska:“La Traviata“/OBA/Raina Kabaivanska
Die großen Künstler der unmittelbaren Vergangenheit wie Del Monaco und Bergonzi waren Deine Partner. Wie kommst Du damit zurecht, dass du heute kaum noch Partner auf deinem künstlerischen Niveau antriffst? Ich habe eine große Sehnsucht nach der alten Zeit, aber nicht, weil es die Vergangenheit ist, sondern weil das eine andere Generation war, vor allem was die Arbeitsmoral anging. Die Sänger waren ihrer Kunst ganz ergeben, ungeheuer professionell. Ich erinnere mich an Del Monaco – wie professionell und welch wunderbarer Kollege -, an Bergonzi und Corelli. Das heutige Starsystem, die Art und Weise, wie die Zuschauer manipuliert werden, hat alles verdorben. Die Entscheidungen der Plattenfirmen machen es dem Publikum unmöglich, unbefangen zu urteilen. Die Reklame mit allen Mitteln beeinflusst sein Urteilsvermögen Es fehlt mir heute, dass das Publikum über das Schicksal eines Sängers entscheidet, auch wenn mich das Publikum liebt und wenn ich Erfolg habe. Neu ist auch, dass ich mich quasi dafür rechtfertigen muss, dass ich Erfolg habe, auch gegenüber den Kollegen, wenn ich in den Augen der Leute eine Primadonna bin. Heute ist es nicht mehr das Bestreben eines jeden Ensemblemitglieds, das Beste für eine gelungene Aufführung zu geben. Es herrscht eine absurde Eifersüchtelei, jeder will den anderen übertreffen – und wenn ich mehr Erfolg habe als diese anderen, muss ich mich beinahe dafür entschuldigen.
Nicht nur in Parma wurdest Du als die letzte wirkliche Diva apostrophiert. Was ist der Unterschied zwischen einer guten Sängerin und einer Diva? Una cantante kann wunderbar singen, eine Diva kann man auch ohne eine schöne Stimme sein. Wenn die Diva die Bühne betritt, werden alle von der Kraft, die sie ausstrahlt, in ihren Bann gezogen. Die wirklichen Diven waren immer una categoria molto speciale, Frauen mit einer besonderen Ausstrahlung, mit viel Kraft und natürlich mit musikalischem Vermögen…(Zwischenruf des Ehemanns: „und Schönheit!“) Nein, sie wird erst schön durch ihr Diva-Sein. Ich frage mich oft, wie ich mit meinen 58 Jahren noch eine sechzehnjährige Manon sein kann, aber die Fähigkeit, sich vollkommen in eine Figur hineinzuversetzen, macht jung, strahlend und überzeugt, macht schön: Und das macht die Primadonna aus. Natürlich ist es leichter, mit meiner Figur eine Tosca zu singen statt mit der eines Mehlsacks, aber erst das Sich-Identifizieren mit der Rolle macht schön. Es ist das innere Licht, das schön macht und Ausstrahlung gibt.

Raina Kabaivanska: als Kostelnicka/OBA/Raina Kabaivanska:
In vielen Konzerten und Tosca -Aufführungen hast Du gemeinsam mit Pavarotti gesungen und damit zwar einen Partner auf hohem musikalischem Niveau gehabt, der optische Gesamteindruck war aber doch wohl nicht ebenso befriedigend. Ich muss Dir eins sagen: Luciano ist dick, aber er ist ein echter Künstler, der wirklich seine Rollen lebt. Während viele andere, die schlank und schön sind, trotzdem nicht überzeugen. Wenn die künstlerische Einfühlung fehlt, fehlt alles. Im Gegensatz zu dem, was er zu sein scheint, ist Luciano ein wirklicher Künstler. Er ist etwas aus der naturalistischen Schule, und weil er wirklich an seine Rollen glaubt, erfüllt er sie mit Leben. In Tosca gibt er mir wirkliche Küsse, davor bin ich immer ein bißchen terrorizzata. lch erinnere mich noch gut an die erste Vorstellung mit Bergonzi: Es war ein ästhetisches Vergnügen, weil er so schön sang, dass es mich beflügelte, auch schön zu singen. Ich singe lieber mit großen Sängern, habe nie, um die Beste zu sein, unterlegene Partner haben wollen. Heute versteht man nicht, dass das Melodrama eine so komplexe Kunstform ist, dass sie auf allen Ebenen das höchste Niveau braucht.
Schon nach mancher Vorstellung haben sich Deine Freunde gefragt, wer überhaupt noch nach Dir eine Adriana oder eine Francesca so verkörpern kann wie Du. Ist Deiner Meinung nach eine Erbin für diese Rollen in Sicht? Ich habe nicht viel Zeit, um ins Theater zu gehen. Aber ich werde so oft eingeladen, diese Partien zu singen, dass ich daran zweifle. Auch meine erste Master Class, die ich im September in Turin hatte, hat mir nicht viel Hoffnung gemacht. Es ist nicht wahr, dass es keine Stimmen gibt, die jungen Sänger sind begabt, aber wie kann man zu einer Master Class, zu einem Wettbewerb kommen mit nur zwei Arien im Repertoire. Ich habe mich wirklich aufgeregt: Da erscheinen hübsche, intelligente Mädchen mit einer schönen Stimme und können nur zwei Arien, wissen auch dabei nicht einmal, was sie singen. Ich frage mich stets als erstes: Wer ist Mimì, wer ist Manon? Sie wussten nichts dazu zu sagen. Es war so schlimm, dass ich die Fassung verloren und sie angeschrien habe: „Ihr seid 25 Jahre alt, die Scotto hat mit 17 ‚Traviata‘ gesungen, ich habe in einem Jahr sechs neue Partien gelernt.“. So hat man gearbeitet, so macht man Karriere! Sängerin wird man nicht wegen der Pelze und Juwelen. Sängerin sein heißt arbeiten. Das müssen die Jungen erst kapieren. Sie sehen – wie das heute allgemein ist – nur die glänzende Oberfläche.
Als Erfahrung war dieser Kurs für mich selbst sehr nützlich. Er hat mir gezeigt, wie sehr die jungen Sänger Hilfe brauchen. Die heutigen Gesangslehrer haben keine Ahnung. Die alten Lehrer, die noch etwas von Sängerausbildung verstanden haben, sind tot. Diese jungen Sänger wirken sehr verloren. Und da ich einige positive Resultate nach dieser Master Class bemerkt habe, ist es meine Pflicht weiterzumachen. Ich habe gemerkt, dass ich etwas vermitteln kann, und deshalb mache ich auch gern weiter. Der Schwerpunkt wird dabei auf der Interpretation liegen, obwohl sie natürlich von der Technik nicht zu trennen ist. Wenn die musikalische Phrase nicht durchdacht ist, ist es genau so schlimm, als wenn die Noten nicht richtig gesungen werden. Man kann nicht gut singen, ohne zu interpretieren, und man kann nicht interpretieren, ohne eine perfekte Technik zu haben. Deshalb habe ich gleich mit dem Irrtum aufgeräumt, ich würde ausschließlich Interpretation lehren.

Raina Kabaivanska: als Francesca da Rimini in Palermo/TMP/Raina Kabaivanska
Du hast viel mit Daniel Oren zusammengearbeitet…Für mich ist es wichtig, mich akzeptiert und geliebt zu fühlen. Ich kann nicht arbeiten mit einem Gesicht mir gegenüber, das nicht Zuneigung und Bewunderung ausdrückt. Mit Oren gibt es dieses Feeling, dieses gegenseitige Sich-Verstehen, das einen kreativen Prozess auslöst. Wir haben das gleiche Verständnis für Musik. Ich habe eine Idee, er greift sie auf oder umgekehrt, das ist das Natürlichste und Schönste, was man sich denken kann zwischen zwei Künstlern. Ich kann die Dirigenten nicht ertragen, die in die Garderobe kommen und sagen: „Signora, stia attenta, io la accompagno“. Ich will nicht nur einfach begleitet werden. Ich will Zusammenarbeit, Austausch von Ideen und Erfahrungen. Du hast auch viel mit von Karajan gearbeitet, was abrupt endete, nachdem Du eine Aida abgelehnt hattest. Hast Du das manchmal bereut? Ehrlich gesagt, nein. Ich kenne meine Grenzen – und Aida non e per me.
Du hast viel in Deutschland gesungen. Aber es entgeht niemandem, dass Du ein ganz besonderes Verhältnis zum italienischen Publikum hast. Worin bestehen seine Vorzüge? Ich glaube, dass ich jetzt, in der Phase der Reife, keine Zeit mehr zu verlieren habe. Ich genieße es, wirklich verstanden zu werden. Vielleicht ist es die Sprache, die diesen intensiven Kontakt mit dem Publikum herstellt. Vielleicht ist es auch mein Gespür für den besonderen Geschmack des italienischen Publikums, der mich mit ihm verbindet. Leider herrscht im Ausland ein fürchterliches Missverständnis darüber, was italienische Oper ist. Eine vulgäre Interpretation im veristischen Stil verdirbt die meisten Aufführungen. Je mehr einer schluchzt, je öfter er sich auf die Erde wirft, je fürchterlicher er schreit, desto mehr wird er für typisch italienisch gehalten. Die italienische Musik ist aber eine große Musik, die mit diesen Exzessen nichts zu tun hat. Mir ist klar, dass jedes Publikum die eigenen Komponisten am besten versteht, da gibt es eine Gemeinsamkeit auch der musikalischen Sprache. Wenn ich nach Wien oder nach Deutschland kam, habe ich im italienischen Repertoire unbeschreiblich schreckliche Dinge gehört und gesehen.

Raina Kabaivanska: Armide von Gluck/Bologna/OBA/Raina Kabaivanska
Wie erklärst Du es Dir, dass Dir viele Fans nun schon über Jahrzehnte hinweg die Treue halten? Ja, es gibt einige, die inzwischen schon dreißig Jahre lang zu jeder Premiere kommen. Nach der absurden Attacke in Neapel (der ausgebuhte Tenor in der Adriana behauptete, sie habe das Publikum bezahlt. A.d.R.) muss ich mich quasi dafür entschuldigen, dass ich so viele Freunde habe, die ich natürlich nicht bezahle. Ich bin nicht so reich, dass ich das gesamte Publikum kaufen kann, damit es „brava“ ruft. (Sie lacht) Meine piccoli colleghi müssen einfach zu akzeptieren lernen, das ich geliebt werde. Aber so ist es allen Primadonnen gegangen, der Callas wie der Gencer. Eifersucht ist eine natürliche Sache, aber genauso natürlich sollte es sein, die Überlegenheit eines Kollegen zu akzeptieren. Ein Erfolg, der über dreißig Jahre andauert, kann weder ein Zufall noch das Verdienst von Claqueuren sein.
Wie sehr fühlst Du Dich, so ganz heimisch in Italien, noch mit Deinem Heimatland Bulgarien verbunden? Schon vor Beginn des Konzerts in Sofia gab es zehn Minuten lang Standing ovations, und draußen haben die Studenten geschrieen „Raina è nostra, Raina è con noi„. Es war sehr aufwühlend… … und wohl auch bedrückend wegen der großen Erwartungen, die an Dich geknüpft werden? Ja, auch das. Eine meiner besten Freundinnen, eine große Schriftstellerin, eine noble Frau, die nie den Rücken krumm gemacht hat vor den Machthabern, muss sich jetzt mit Politik befassen, weil es niemanden gibt, der dazu fähig ist. Das, was ich für Bulgarien mache, tue ich auch für sie, für alle, die sich jetzt in diesem Land für die Demokratie einsetzen. Ich bin dieses Jahr zurückgekehrt und habe meine persönliche Stiftung für Waisenkinder gegründet, denn es fehlt an allem, an Milch, an Medikamenten… Diesen Kindern helfen zu können, gibt meiner künstlerischen Arbeit noch einen weiteren, zusätzlichen Sinn.

Raina Kabaivanska: beim Meisterkurs in Siena/Accademia Chigiana
Wäre da nicht das unverwechselbar reizvoll charmante Lächeln gewesen, man hätte Raina Kabaivanska nach ihrem Wechsel vom aktiven Sängerleben in das einer Gesangslehrerin und Förderin von bulgarischen Sängern kaum wieder erkannt, denn Hand in Hand damit ging ein vollkommener Wechsel ihres Typs. Aus der Brünetten mit halblangem Haar war eine weißblonde, sportlich aussehende Dame geworden, als solle der neue Lebensabschnitt von einem völlig neuen Menschen begonnen werden. Nach dem obigen Interview konnte man die Sängerin nach der Emilia Marty in Turin noch als zauberhafte Madeleine in einem italienischen Capriccio in Bologna und als Governess in Brittens Il Giro di Vite (i. e., The Turn of the Screw)in Turin erleben, wo sich zeigte, dass sie sich auch in das Charakterfach ohne den Glamour einer Francesca oder Adriana mit gleicher Souveränität fand. Eine Marschallin oder eine Alte Dame hätte man sich noch von ihr gewünscht, aber die scheiterten an dem Perfektionsbedürfnis der Künstlerin, die sich in der deutschen Sprache nicht heimisch genug fühlte. Eine Herodias in der französischen Fassung der Salome, die Gräfin in Pique Dame, Kurt Weill und Poulenc markieren das Ende der glanzvollen Sängerinnenkarriere. Heute ist sie eine immer noch schöne, hochgewachsene, schlanke und überaus elegante Dame, die unermüdlich in Jurys, Meisterklassen und bei der Förderung der Künstler ihres Heimatlandes tätig ist, das ihr den Einsatz mit einer festlichen Woche voller künstlerischer Veranstaltungen vergelten will. Ingrid Wanja
Das Foto oben zeigt Raina Kabaivanska auf einer Künstlerpostkarte als Butterfly, ihrer Lieblingspartie. Das Gespräch hielt Ingrid Wanja 1993. Die meisten Bilder stammen aus dem Archiv von Geerd Heinsen als cadeaux de l´artiste, andere entnahmen wir der Facebook-Seite des Raina-Kavaivanska-Fan-Clubs, die übrigen sind durch die Widmungen gekennzeichnet; Angaben zur Fondazione Raina Kabaivanska finden sich ebenfalls auf ihrer website.





 Unter den elf Titeln der Programmfolge finden sich fünf von Porpora
Unter den elf Titeln der Programmfolge finden sich fünf von Porpora
 Die Schwedin
Die Schwedin Dies ist nicht die erste, Farinelli gewidmete CD von Ann Hallenberg, wie Markus Budwitius in einer älteren Rezension hier in operalounge.de darlegte:
Dies ist nicht die erste, Farinelli gewidmete CD von Ann Hallenberg, wie Markus Budwitius in einer älteren Rezension hier in operalounge.de darlegte: Und auch Bernd Hoppe hatte verschiedene Begegnungen mit Farinelli, so in seiner Rezension der Veracini-Oper
Und auch Bernd Hoppe hatte verschiedene Begegnungen mit Farinelli, so in seiner Rezension der Veracini-Oper 













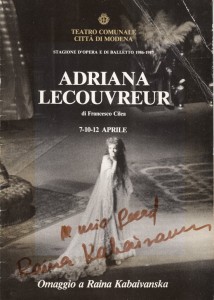 Raina Kabaivanska war über Jahrzehnte der Inbegriff der Butterfly in Verona, die Tosca und die Adriana Italiens und in der Welt, sie hat in allen großen Häusern (und viel in Berlin die Tosca neben Pavarotti) gesungen. Sie ist als geborene Bulgarin zur Ur-Italienerin geworden und wurde mit ihrer Erscheinung und eleganten, hochindividuellen Präsenz zum Mythos auf Italiens Bühnen, nachdem die Kollegin Renata Scotto zum Star der Met wurde. Niemand machte der Kabaivanska über viele Jahre diesen Rang streitig, und bis heute hat sich für sie – die Erbin der Olivero – keine Nachfolgerin gefunden.
Raina Kabaivanska war über Jahrzehnte der Inbegriff der Butterfly in Verona, die Tosca und die Adriana Italiens und in der Welt, sie hat in allen großen Häusern (und viel in Berlin die Tosca neben Pavarotti) gesungen. Sie ist als geborene Bulgarin zur Ur-Italienerin geworden und wurde mit ihrer Erscheinung und eleganten, hochindividuellen Präsenz zum Mythos auf Italiens Bühnen, nachdem die Kollegin Renata Scotto zum Star der Met wurde. Niemand machte der Kabaivanska über viele Jahre diesen Rang streitig, und bis heute hat sich für sie – die Erbin der Olivero – keine Nachfolgerin gefunden.









 Born in Summit (New Jersey), Dalton Baldwin
Born in Summit (New Jersey), Dalton Baldwin 

 Und dann noch. Richard Wagner und die Orgel
Und dann noch. Richard Wagner und die Orgel