Die Festspiele in Bayreuth sind immer noch ein Anlass, sich in das Werk Richard Wagners zu vertiefen. In den Feuilletons und im Netz wird der Komponist noch häufiger bemüht als sonst. Aus Radio und Fernseher ertönt seine Musik nahezu täglich. Auch wenn manche neue Inszenierung das Potenzial in sich trägt, mit Wagner Schluss zu machen, gibt es viele Gründe, es doch noch einmal mit der alten Liebe zu versuchen. So ein Grund ist für mich ein Druckerzeugnis von beträchtlichem Ausmaß: Die Geschichte der Bayreuther Festspiele von Oswald Georg Bauer, erschienen im Deutschen Kunstverlag, zwei Bände im Schuber, 1292 Seiten (ISBN 978-3-422-07343-2). Es ist nicht üblich, das Gewicht von Büchern anzugeben. In diesem Falle aber hätte sich eine Ausnahme von der Regel angeboten. Viel fehlt nicht an zehn Kilo. Mit fünfunddreißig Zentimetern Höhe verweist das ausladende Produkt den alten Brockhaus und die üppigsten Bildbände auf eher bescheidene Plätze. Bevor sich also jemand zu der Anschaffung entschließt, wozu ich nur raten kann, sollte die Unterbringung geklärt sein. Denn zum weiter Verschenken ist das Werk wenig geeignet. Manche Senioren und Kinder – ich hörte meine ersten Rundfunkübertragungen aus Bayreuth mit zwölf – hätten Schwierigkeiten, einen der Bände auf dem Schoß zu halten. Wie dem auch sei. All das sind die kleinsten Probleme, die sich mit diesen Büchern verbinden. Sind sie einmal im Haus und der privaten Bibliothek einverleibt, wüsste ich keinen Anlass, sie wieder herauszurücken. Schon gar nicht für einen wie mich, der sich trotz gewisser Vorbehalte immer noch für Wagner und Bayreuth interessiert. Von Zeit zu Zeit hole ich das stets griffbereite Werk aus dem Regal. Es bleibt nie bei einer kurzen Stippvisite. Liegt es einmal auf dem Tisch, gehen die Stunden nur so hin. Es hat seine Sogwirkung behalten. Bereits vor einiger Zeit wurde es an dieser Stelle ausführlich besprochen. Wie die Bücher selbst, kann auch ein Text hervorgeholt und einer neuen Wertung unterzogen werden.
 Es handelt sich um die erste chronologische Darstellung der Festspiele von 1850 bis 2000. Der Autor war ein enger Vertrauter des Wagner-Enkels Wolfgang, der die Entstehung des Buches bis zu seinem Lebensende wohlwollend begleitete. Bauer diente ihm über viele Jahre als Pressesprecher, war so etwas wie seine rechte Hand und hatte Zugang zu den sagenumwobenen Archiven. Bauer: „Ich fragte ihn, was er davon halte, dass ich die Geschichte der Bayreuther Festspiele schreibe.“ Er sei sichtlich erfreut gewesen, hab ihm die Hand gereicht und gesagt: „Herr Bauer, hiermit ernenne ich Sie zum Chronisten der Festspiele.“ Die engen Kontakte zum Patriarchen Wolfgang Wagner dürften eine gute Voraussetzungen für so ein Werk gewesen zu sein. „Wie alles war“: Erdas Ausruf im Rheingold darf getrost als Motto – und als Anspruch gelten.
Es handelt sich um die erste chronologische Darstellung der Festspiele von 1850 bis 2000. Der Autor war ein enger Vertrauter des Wagner-Enkels Wolfgang, der die Entstehung des Buches bis zu seinem Lebensende wohlwollend begleitete. Bauer diente ihm über viele Jahre als Pressesprecher, war so etwas wie seine rechte Hand und hatte Zugang zu den sagenumwobenen Archiven. Bauer: „Ich fragte ihn, was er davon halte, dass ich die Geschichte der Bayreuther Festspiele schreibe.“ Er sei sichtlich erfreut gewesen, hab ihm die Hand gereicht und gesagt: „Herr Bauer, hiermit ernenne ich Sie zum Chronisten der Festspiele.“ Die engen Kontakte zum Patriarchen Wolfgang Wagner dürften eine gute Voraussetzungen für so ein Werk gewesen zu sein. „Wie alles war“: Erdas Ausruf im Rheingold darf getrost als Motto – und als Anspruch gelten.

Band I, Abb. 135: Drei Grazien, wie sie im Venusberg des „Tannhäuser“ 1891 aufgetreten sind/ Foto: Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth
Bauer hat keine Propagandaschrift verfasst. Seine Darstellung ist kritisch und spart die heiklen Kapitel in der Festspielgeschichte nicht aus. Offen gelegt werden die Verstrickungen mit der politischen Macht, die bereits der Komponist betrieb, und die mit dem Aufstieg Hitlers zum deutschen Reichskanzler ein Ausmaß erreichten, welches den Forstbestand nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zunächst in Frage stellte. Um ein Haar wäre Bayreuth an sich selbst gescheitert. 1968, die Nachkriegsfestspiele gingen bereits in ihr siebzehntes Jahr, erreichten die Protestbewegung der Studenten, die sich mit der Verdrängung der nationalsozialistischen Vergangenheit durch die Elterngeneration nicht abfinden wollte, auch den Grünen Hügel. Erstmals gab es lautstarke Aktionen bei der Auffahrt der Prominenz. Die war nicht mehr unter sich. „Bonzen raus – Volk rein.“ Diese Forderung ist auch im Buch nachzulesen. Sie liegt – und das ist bemerkenswert – gar nicht so weit weg von dem, was sich der ehemalige Barrikadenkämpfer Wagner selbst einmal vorgestellt hatte. Gleich auf den ersten Seiten heißt es nämlich: „Wagners ursprüngliche Idee, dass genügend Vermögende so viel spenden würden, dass den Minderbemittelten ein freier Eintritt ermöglicht würde, hatte sich als utopisch erwiesen.“ Darauf folgt das Zitat Wagners als bittere Erkenntnis: „Wir sind notgedrungen unserer ursprünglichen Idee untreu geworden.“ Für Wagner nimmt dennoch seine Energie ein, die Festspielidee gegen alle Widerstände in die Tat umgesetzt zu haben.

Band I, Abb. 85: Entwurf des Gralsgefäßes für die Uraufführung des „Parsifal“ 1882 von Paul von Joukowsky. Foto: Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth
Als die Arbeiten für den Bau des Festspielhauses begannen, war die Götterdämmerung nicht einmal fertig. Eile war geboten. Dieser Druck ist dem Ring-Finale nach meiner Überzeugung auch anzuhören. Zumindest aber blieb immer Zeit genug, den alltäglichen Antisemitismus, der in Wahnfried zur Hausordnung gehörte, bei allen sich bietenden Gelegenheiten zu pflegen. So mokierte sich Frau Cosima darüber, das Hans Richter, der erste Ring-Dirigent in Bayreuth, eine Jüdin zur Frau genommen hatte. „Es scheidet sich alles, was nicht zusammengehört, wenn es sich noch so nahe gekommen ist; so fühlte ich entschieden, dass Richter nun mehr andere Bahnen wandeln wird“, heißt es in ihrem Tagebuch. Dass die Kosten ausuferten, der ursprüngliche finanzielle Rahmen von hunderttausend Talern drastisch überschritten wird, ist nicht nur ein Problem der Neuzeit. Es war schon damals so. Der Autor hat auf solche immer mit Fakten unterfütterten Schilderungen sehr viel Platz verwendet – mit der unausgesprochenen Folge, dass es nach Wagners Tod 1883 langweiliger wurde in Bayreuth. Als sei mit dem „Meister“ auch der Hauptdarsteller des Bayreuther Dramas dahin.

Band I, Abb. 76: Figurine des Parsifal von Paul von Joukowsky 1882. Foto: Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth
Trotz seiner ungelenken Ausmaße verbreitet das Buch Sinnlichkeit. Daran haben die vielen Fotos einen erheblichen Anteil. Die Kameras sind auch hinter die Kulissen gerichtet. Bayreuth erscheint von Anfang an als Werkstatt. Ein Begriff, der auf Friedrich Nietzsche zurückgeht. Besonders sinnfällig wird dies anhand der Aufführung des Ring des Nibelungen 1933 durch Heinz Tietjen in Bühnenbildern von Emil Preetorius, die 1934 weiterentwickelt wurden. Sie ist in ihrem Entstehen und in ihrer Vervollkommnung dokumentiert. Entwürfe und deren Umsetzung machen die Veränderungen nachvollziehbar. Zitiert wird Preetorius, als er die alten Dekorationen in Augenschein nahm, mit den Worten: Sie müssten „… Luft haben, die Bühne muss freigestellt werden. Also weg mit allem, damit die Größe dieser Bühne wirklich zur Geltung kommt“. Alles Nebenbei sollte weggelassen werden. Wagner sei für ihn, Preetorius, prinzipiell eine „Sache des Lichts“, das der „wandelfähigste und wandelschaffendste Faktor in der ganzen Szenerie“ sei. Noch heute klingt das plausibel, zumal Regisseure wie Christoph Schlingensief, Frank Castorf und Uwe Eric Laufenberg die Bayreuther Bühne wieder total voll geräumt haben, wodurch deren Weite und Dimension optisch schrumpft. Das Kapitel über diesen Ring gehört zu den stärksten des Buches. Bei der Bildauswahl wurde Wert auf die Erkenntnis gelegt, dass noch so phantastisch gelungene Kulissen erst durch die Akteure belebt werden. So ist es auch nach mehr als achtzig Jahren noch beeindruckend, wenn Frida Lieder als Brünnhilde und Max Lorenz als Siegfried am Schluss des Siegfried förmlich aufeinander zufliegen oder wenn sich Josef von Manowarda als Hagen auf dem Felsen in der Götterdämmerung wie sein eigenes Denkmal erhebt.

Band I, Abb. 327: Wilhelm Furtwängler kommt 1931 auf dem Pferd zu den Proben, hier als Ausschnitt. Foto: Sammlung Weirich, Eisenach
Figurinen, Karikaturen, Pläne, Zeichnungen und faksimilierte Dokumente gibt es in großer Zahl. Vieles davon dürfte noch nie öffentlich gezeigt worden sein. Über weite Strecken gleicht das Werk einem Kunstband über Fotographie. Unglaublich, was Kameras schon zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zu leisten vermochten. Auf dem schweren matten Papier fallen die Reproduktionen besonders gut aus. Wer mal keine Lust zum Lesen verspürt, kann sich stundenlang bei den Illustrationen aufhalten und wird immer neue Details entdecken. Mit der Zeit kommt Farbe ins Spiel, wodurch aber auch die schwarzen Hakenkreuze auf dem blutroten Untergrund der Fahnen, die nach 1933 in ganz Bayreuth aufgezogen wurden, noch bedrohlicher wirken. Mein Lieblingsfoto ist schnell ausgemacht: Der Dirigent Wilhelm Furtwängler kommt 1931 noch in Schwarzweiß zu Pferd zu den Tristan-Proben angeritten.

Band II, Abb. 87: Martha Mödl, die Isolde bei den ersten Nachriegsfestspielen 1951, hatte auch nach der Vorstellung ihren großen Auftritt. Foto: Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Zustiftung Wolfgang Wagner
Im zweiten Band, der die Jahre 1951 bis 2005 behandelt, lässt die Spannung etwas nach. Als gehe es wieder von vorn los. Das liegt in der Natur der Sache, nicht an der Kompetenz des Autors. Aus den Nachkriegsjahren gibt es bereits haufenweise Material in Form von Büchern, Zeitschriftenbeiträgen, Programmheften, Hörfunk- und Fernsehsendungen. Hinzu kommen die Tonträger und zunehmend verfilmte Vorstellungen. Und immer geht es um die zehn selben Stücke. Jahraus, jahrein. Zeitzeugen sind noch unter den Lebenden, erinnern sich genau. Meinen ersten Besuch in Bayreuth 1994, der einer Aufführung der Götterdämmerung galt, finde ich auch wieder. Nicht nur das. Ich sehe auch meine Eindrücke von damals bestätigt. Regie führte Alfred Kirchner, die Ausstattung besorgte rosalie. Ich fand es – wie einige Kritiker – gar nicht albern, als sich bei Siegfrieds Tod die stilisierten Bäume niedersenkten, als trauere die Natur um diesen Helden, der menschliche Züge trug. Während ich positive Eindrücke auffrischen kann, werden sich andere Leser womöglich auch zwanzig und mehr Jahre später erneut aufregen über in ihren Augen völlig verunglückte Lösungen. All dies gibt die Dokumentation her. Bauer, der sich eigener Wertungen enthält, tritt in erster Linie als Chronist in Erscheinung, gibt wieder, was Lesern, die nicht dabei waren, einen freien und unparteiischen Zugang zu den einzelnen Produktionen ermöglicht, seien sie nun heftig umstritten gewesen oder nicht. Er kann nicht nur gut schreiben, er vermag – wenn er nicht zitiert – auch sehr unterhaltsam zu erzählen. Mir kam es oft so vor, als hätte ich selbst – viel häufiger als in Wahrheit geschehen – im Zuschauerraum gesessen oder Proben und Arbeitsgespräche ganz aus der Nähe verfolgen können.

Band I, Abb. 464: Germaine Lubin als Isolde 1939, hier als Bildausschnitt: Foto:. Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth
Ausführlich und sehr gründlich behandelt werden jeweils die neuen Inszenierungen. Reprisen, die nicht selten musikalisch beideutender gewesen sind als die ursprünglichen Premieren werden oft nur gestreift und im Detail nicht mehr behandelt. So ein Beispiel ist Lohengrin, den Wolfgang Wagner 1967 herausbrachte, als die Festspiele erstmals ohne Wieland auskommen mussten, der im Jahr zuvor gestorben war. Diese Inszenierung löste das berühmte Oratorium des Bruders in Silber und Blau ab. Während sich das Publikum zufrieden zeigte, mäkelte die Kritik daran herum, sah gar eine – wie es bei Bauer heißt – „Rückkehr zum Konventionellen“. 1972, in seinem letzten Jahr, entpuppte sich dieser Lohengrin als musikalische Sternstunde. Silvio Varviso entfaltete am Pult eine selten gehörte Pracht. René Kollo als jugendlicher Lohengrin, Hannelore Bode als strahlende Elsa, die unvergessene Ursula Schröder-Feinen als fulminante Ortrud und der charaktervolle Donald McIntyre als Telramund wuchsen förmlich über sich hinaus. Unbestechliches Zeugnis legt davon der Mitschnitt des Bayerischen Rundfunks ab. Ich scheue mich nicht, von einem der stärksten Eindrücke zu sprechen, die mir aus Bayreuth zu Ohren kamen. Darauf nimmt das Buch keine Rücksicht.

Band II, Abb. 185: Lotte Lehmann und ihre Schülerin Grace Bumbry 1959 als Gäste in Bayreuth. Zwei Jahre später trat die Bumbry als Venus auf. Foto: Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Zustiftung Wolfgang Wagner
Es darf sich nicht aufhalten, muss nach vorn streben. Seinem eigenen Ordnungsprinzip folgend, ist 1972 die Neuinszenierung des Tannhäuser durch den DDR-Import Götz Friedrich angesagt. Was sich seinerzeit abspielte, liest sich in der Rückschau wie ein deutsch-deutscher Krimi. Bauer bringt das ziemlich gepfeffert herüber. Der tote Tannhäuser lag, wie es in einem Bericht heiß, „in der Haltung des Gekreuzigten, jetzt umgeben vom gesamten Chor in Arbeitskleidung, der die Schlussworte direkt ins Publikum sang als eine ,Verbrüderungsgloriole’.“ Zitiert wird auch Friedrich in einem Interview, in dem er sich auf Brecht berief. Es sei ihm besonders nötig, „Handlungen zu Haltungen zu verdichten“. Und in der TV-Sendung „Aspekte“ brachte er das Fass zum Überlaufen mit der von Bauer wiedergegebenen Bemerkung, die reaktionäre Wartburggesellschaft glaube er, Friedrich, ganz konkret in dem Publikum wiederzufinden, das auf den Grünen Hügel pilgere, um „Kunst und Frieden“ zu genießen. Solche Töne kamen nicht gut an, der Tannhäuser sei zu einem „Politikum ersten Ranges zwischen der BRD und der DDR geworden“. In seinem letzten Jahre, 1978, gewann die Inszenierung abermals mediale Aufmerksamkeit. Der Tannhäuser kam als erste Bayreuther Produktion ins Fernsehen und ist noch heute auf DVD zu haben. Gebührend wird darauf auch im Buch eingegangen.

Band I, Abb. 175: Der Tenor Alois Burgstaller 1896 als Siegfried mit dem Bären. Foto: Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Zustiftung Wolfgang Wagner
Damit ist eines von zwei Themen erreicht, die kritisch anzumerken sind. Kein Festival ist so genau und so umfassend auf Tonträgern dokumentiert wie dieses. Zunächst war es der graue Markt, der sich fast aller im Rundfunk gesendeten Mitschnitte – auf nicht legale Weise – annahm. Immerhin sind sie unter den Leuten. Mehr oder weniger mit Bayreuther Segen sind peu à peu alle Werke, die dort gezeigt werden, auf Tonträger gelangt, die meisten sogar mehrfach. Die Firma Testament sicherte sich mit dem von Joseph Keilberth geleiteten Ring des Nibelungen von 1955 die erste Stereo-Aufnahme aus Bayreuth, nachdem sie ein halbes Jahrhundert im Archiv gelegen hatte. Unter der Hand aber tat sich immer noch mehr. Sammler sind eine besondere Spezis. Sie wollen alles. Mit der Veröffentlichung des Tristan mit Martha Mödl und Ramon Vinay von 1952 unter Herbert von Karajan 2003 bei Orfeo wurde klanglich weit überholt, was davon zuvor im Umlauf war – und den Piraten (außerhalb der 50-Jahre Copyright-Grenzen) der entscheidende Kampf angesagt. Das Bessere ist der Feind des Guten, sagte schon Voltaire. Wie Recht er hatte. Dieses Remastering des besagten Tristan ist deshalb so beispielhaft, weil damit zumindest akustisch der rasante Bayreuther Neuanfang heraufbeschworen wurde. Allein deshalb hätte diese CD-Box, der bei Orfeo weitere folgten und immer noch folgen, ein Gegenstand der Geschichtsschreibung sein müssen.

Band I, Abb. 318: „Tannhäuser“ 1930, Ende zweiter Aufzug, in der spektakulären Neuinszenierungen von Siegfried Wagner, die von Arturo Toscanini dirigiert wurde. Foto: Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Zustiftung Wolfgang Wagner
Soll heißen, die Festivalgeschichte ist auch die Geschichte ihres klingenden Vermächtnisses. Wie, wenn nicht auch akustisch, will man die Bedeutung des legendenumwobenen Veranstaltungsortes erfahren, der in früheren Jahren wesentlich mehr Exklusivität und Individualität zu bieten hatte als heute. Es sind bereits frühzeitig Versuche unternommen worden, den Bayreuther Gesangsstil für die Ewigkeit zu konservieren. Einige Sänger, die von Anfang an dabei gewesen sind, können immer noch gehört werden. Nach der Aufführung des auch französisch gesungenen Tannhäuser in der Pariser Fassung 2017 in Monte-Carlo dürfte das Interesse an dieser Version wieder zugenommen haben. Sie wurde auch 1930 in Bayreuth bei der von Arturo Toscanini geleiteten neuen Produktion gespielt. Im Buch wird beklagt, dass es davon keine Tondokumente gibt, die den Glanz, den der italienische Maestro verbreitete, festgehalten hat. Dass die großen Szenen, die im selben Sommer aufgenommen wurden, aus rechtlichen Grünen offiziell aber von Karl Elmendorff dirigiert werden mussten, in den kleingedruckten Anhang verbannt wurden, finde ich unangemessen. Etwas, das Toscanini mit den Musikern und Sängern erarbeitet hat, wird ja doch auch in diese Aufnahme eingegangen sein, zumal im Buch das Orchester nach einer Kritikermeinung als die „tönende Seele“ des Ganzen bezeichnet wurde. Es ist nicht vorstellbar, dass sich Elemendorff veranlasst sah, aus dem Orchester herauszuspülen, was der berühmte Kollege aus Mailand eingepflanzt hatte. Es hätte sich gelohnt, einen Musikwissenschaftler, der mit Toscaninis Stil bestens vertraut ist, um sein analytisches Urteil zu bitten. Ich habe mir das von Naxos in sorgsamer Restaurierung herausgegebene Album mit gut zweieinhalb Stunden Musik wieder angehört und war überwältigt und hingerissen und von diesem Drive.

Band II, Abb. 546: Wolfgang Schmidt 1994 als Siegfried mit dem Drachen, der von Eric Halverson gesungen wurde. Foto: Bildarchiv Bayreuther Festspiele GmbH
Nun zum zweiten Kritikpunkt. Gleich im Vorwort, wenn der Autor anschaulich Aufbau und Anlage seines Opus erklärt, heißt es: „Aufgrund dieser Struktur wird mit Absicht auf ein Namensregister verzichtet. Bei der Vielzahl der erwähnten Personen würde jeder Name sich unendlich wiederholen, so dass ein solches Register nur unübersichtlich wird und dem Leser kaum eine Hilfe bieten.“ Was dem Leser als Erleichterung versprochen wird, erweist sich mit fortschreitender und auch bei erneuter Lektüre als Bärendienst. Ohne dieses Register lässt sich mit den Büchern nicht gut arbeiten. Wo war doch gleich mal die Stelle, an der dieser Künstler, jener Dirigent oder wer sonst noch in Erscheinung tritt? Gab es überhaupt eine Erwähnung? Jetzt geht die Sucherei los. Es ist die Stunde derjenigen, die optisch lesen, die auch nach dreihundert Seiten noch wissen, wo die gesuchte Person in der zweiten Spalte rechts unten aufgetreten ist. Wer diese Gabe nicht besitzt, ist zwar übel dran – dennoch aber im Besitz eines wichtigen Standardwerkes. Rüdiger Winter

Szene aus Siegfried von 1934 in den Bühnenbildern von Emil Preetorius. Frida Leider als Brünnhilde und Max Lorenz als Siegfried scheinen aufeinander zuzufliegen. Auch dies ein Bildausschnitt, Band I, Abb. 370. Foto: Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Zustiftung Wolfgang Wagner
Foto oben: Anna Bahr-Mildenburg als wilde Kundry im ersten Aufzug des Parsifal von 1911 im Bildausschnitt, Band I, Abb. 229. Foto: Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Zustiftung Wolfgang Wagner. Wir danken Frau Barbara Grahlmann vom Deutschen Kunstverlag sehr herzlich für die ausdrückliche Genehmigung zur Verwendung der Fotos für diesen Beitrag.





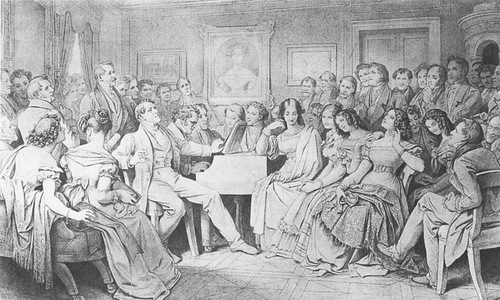
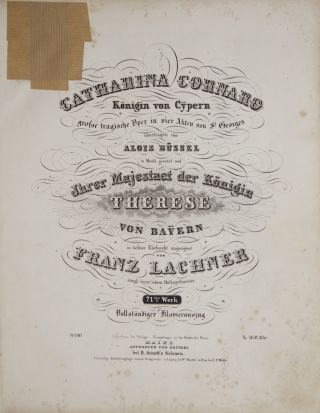











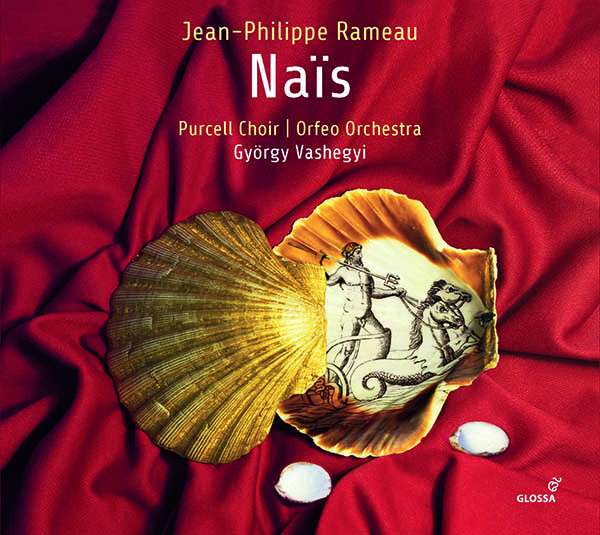






















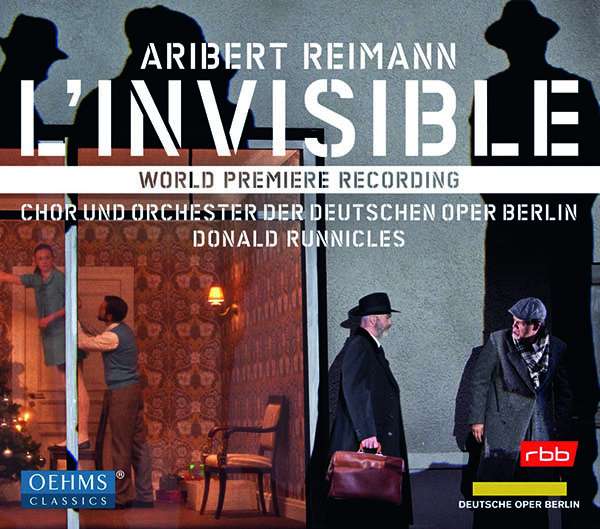



 Der Titel des Buches:
Der Titel des Buches: 