.
Seit über acht Jahrzehnten wird das neue Jahr traditionell mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker eingeleitet. Längst hat es sich zum internationalen Großereignis entwickelt, im Fernsehen und Rundfunk (und mittlerweile natürlich auch im Streaming) live übertragen in aller Herren Länder. Am 1. Jänner 2024 stand nach fünfjähriger Pause zum zweiten Male der gebürtige Berliner Christian Thielemann auf dem Dirigentenpult im Goldenen Musikvereinssaal in Wien. Wie üblich, liegt wenige Tage hernach die Compact Disc vor (Sony 19658858932). Filmisch verewigt, schließen sich Ende des Monats DVD und Blu-ray an, neuerdings komplettiert um die pseudo-nostalgische Langspielplatte.
 Was stand heuer auf dem Programm? Von den insgesamt 15 Nummern des offiziellen Programms sind nicht weniger als neun davon Premieren beim Neujahrskonzert, zwar nicht ganz so viele wie voriges Jahr (14), aber doch ein Fortbeschreiten des eingeschlagenen Weges, wo neuerdings bewusst nicht mehr bloß die „Sträusse“ berücksichtigt werden. Den Auftakt macht der bereits geläufige Karl Komzák mit dem Erzherzog-Albrecht-Marsch, einem eher streitbaren Mitglied des österreichischen Erzhauses gewidmet. Johann Strauss Sohn folgt freilich gleich darauf doppelt mit dem Walzer Wiener Bonbons und der eingängigen Figaro-Polka. Tatsächlich tut sich der Eindruck auf, als ließe der sich anschließende und herrliche k. u. k. Romantik ausstrahlende Walzer Für die ganze Welt von Joseph Hellmesberger junior, eine der Erstaufführungen in diesem Zusammenhang, gar den zuvor gehörten des Walzerkönigs alt aussehen. Die furiose Schnellpolka Ohne Bremse von Eduard „Edi“ Strauss bildet einen passenden Kontrast hierzu und beschließt den ersten Teil des Konzerts. Altbekanntes folgt nach der Pause mit der Ouvertüre zur spät entstandenen Johann-Strauss-Operette Waldmeister auf den Fuß. Selbst von diesem berühmtesten Mitglied der Strauss-Dynastie gibt es nach wie vor Neues zu entdecken, wie der landläufig gewiss unbekannte Ischler Walzer aus seinem Nachlass (und ohne Opus-Zahl) beweist, eine Hommage an sein geliebtes Ischl (das erst 1906, sieben Jahre nach Strauss‘ Tod, den Beinamen Bad erhielt). Eine Reihe vierer unterschiedlicher Polkas setzt den Konzertverlauf fort, davon drei Premieren: Über die Nachtigall-Polka (abermals Johann Strauss Sohn), die Polka mazur Die Hochquelle (Eduards zweiter Konzertbeitrag) und die geläufige Neue Pizzicato-Polka (neuerlich Johann junior) gelangt schließlich der jüngere Hellmesberger mit der Estudiantina-Polka aus seinem Ballett Die Perle von Iberien noch einmal zu Gehör. Mit dem prachtvollen Konzertwalzer Wiener Bürger von Carl Michael Ziehrer wird schließlich der letzte k. u. k. Hofball-Musikdirektor der Donaumonarchie gewürdigt. Wie eigentlich alle Ziehrer-Walzer, will auch dieser, sein wohl berühmtester, den leicht militärischen Einschlag gar nicht verleugnen (der Komponist war schließlich langjähriger Kapellmeister des legendären Hoch-und-Deutschmeister-Infanterie-Regiments Nr. 4). Das soeben eingeleitete Anton-Bruckner-Jahr 2024 (200. Geburtstag) geht nicht einmal am Neujahrskonzert vorüber. Ein frühes, völlig „unbrucknerisches“ Klavierwerk, die gut fünfminütige Quadrille WAB 121, wurde eigens zu diesem Anlass von Wolfgang Dörner für Orchester gesetzt. Das Ergebnis kann sich hören lassen und komplettiert auf eine gewisse Weise Thielemanns Bruckner-Zyklus, den er mit den Wiener Philharmonikern kürzlich vollendet hat (ebenfalls bei Sony erschienen). Heuer ebenfalls abermals vertreten ist der Däne Hans Christian Lumbye, der „Strauss des Nordens“. Sein spritziger Galopp Glædeligt Nytaar! (Frohes neues Jahr!) fügt sich nahtlos in die Programmgestaltung ein. Jetzt erst, beim letzten Stück des offiziellen Konzertprogramms, tritt Josef Strauss hinzu, dessen Delirien-Walzer fraglos einen der einprägsamsten Vertreter dieser beliebten Gattung darstellt. Die Thielemann’sche Darbietung desselben ist gar ein Höhepunkt des heurigen Neujahrskonzerts. Josef Strauss ist es auch, der gleich danach die erste Zugabe, die einzige wirkliche Überraschung des Konzerts, beisteuert. Seine feurig dargebotene Jockey-Polka versöhnt diejenigen, die den womöglich genialsten der Strauss-Brüder heuer etwas vernachlässigt sahen. Nach einem wohltuend nüchternen Neujahrsgruß des Dirigenten geht man zu den weiteren Zugaben über. Den weltbekannten Donauwalzer alias An der schönen blauen Donau meint man schon lange nicht mehr so locker und doch voller Pläsier gehört zu haben. Freimütig heraus gesagt: Diese Interpretation darf sich ganz vorne einreihen, trotz solch illustrer und zurecht gerühmter Vorgänger wie Willi Boskovsky, Herbert von Karajan und Georges Prêtre. Ganz zum Schluss dann erwartbar Johann Strauss Vater mit seinem Radetzky-Marsch. Das (diesmal leider besonders unkoordinierte) Klatschen wird man dem Publikum in diesem Leben nicht mehr austreiben können, aber was wäre ein Neujahrskonzert auch ohne nicht zumindest einen kleinen Wermutstropfen.
Was stand heuer auf dem Programm? Von den insgesamt 15 Nummern des offiziellen Programms sind nicht weniger als neun davon Premieren beim Neujahrskonzert, zwar nicht ganz so viele wie voriges Jahr (14), aber doch ein Fortbeschreiten des eingeschlagenen Weges, wo neuerdings bewusst nicht mehr bloß die „Sträusse“ berücksichtigt werden. Den Auftakt macht der bereits geläufige Karl Komzák mit dem Erzherzog-Albrecht-Marsch, einem eher streitbaren Mitglied des österreichischen Erzhauses gewidmet. Johann Strauss Sohn folgt freilich gleich darauf doppelt mit dem Walzer Wiener Bonbons und der eingängigen Figaro-Polka. Tatsächlich tut sich der Eindruck auf, als ließe der sich anschließende und herrliche k. u. k. Romantik ausstrahlende Walzer Für die ganze Welt von Joseph Hellmesberger junior, eine der Erstaufführungen in diesem Zusammenhang, gar den zuvor gehörten des Walzerkönigs alt aussehen. Die furiose Schnellpolka Ohne Bremse von Eduard „Edi“ Strauss bildet einen passenden Kontrast hierzu und beschließt den ersten Teil des Konzerts. Altbekanntes folgt nach der Pause mit der Ouvertüre zur spät entstandenen Johann-Strauss-Operette Waldmeister auf den Fuß. Selbst von diesem berühmtesten Mitglied der Strauss-Dynastie gibt es nach wie vor Neues zu entdecken, wie der landläufig gewiss unbekannte Ischler Walzer aus seinem Nachlass (und ohne Opus-Zahl) beweist, eine Hommage an sein geliebtes Ischl (das erst 1906, sieben Jahre nach Strauss‘ Tod, den Beinamen Bad erhielt). Eine Reihe vierer unterschiedlicher Polkas setzt den Konzertverlauf fort, davon drei Premieren: Über die Nachtigall-Polka (abermals Johann Strauss Sohn), die Polka mazur Die Hochquelle (Eduards zweiter Konzertbeitrag) und die geläufige Neue Pizzicato-Polka (neuerlich Johann junior) gelangt schließlich der jüngere Hellmesberger mit der Estudiantina-Polka aus seinem Ballett Die Perle von Iberien noch einmal zu Gehör. Mit dem prachtvollen Konzertwalzer Wiener Bürger von Carl Michael Ziehrer wird schließlich der letzte k. u. k. Hofball-Musikdirektor der Donaumonarchie gewürdigt. Wie eigentlich alle Ziehrer-Walzer, will auch dieser, sein wohl berühmtester, den leicht militärischen Einschlag gar nicht verleugnen (der Komponist war schließlich langjähriger Kapellmeister des legendären Hoch-und-Deutschmeister-Infanterie-Regiments Nr. 4). Das soeben eingeleitete Anton-Bruckner-Jahr 2024 (200. Geburtstag) geht nicht einmal am Neujahrskonzert vorüber. Ein frühes, völlig „unbrucknerisches“ Klavierwerk, die gut fünfminütige Quadrille WAB 121, wurde eigens zu diesem Anlass von Wolfgang Dörner für Orchester gesetzt. Das Ergebnis kann sich hören lassen und komplettiert auf eine gewisse Weise Thielemanns Bruckner-Zyklus, den er mit den Wiener Philharmonikern kürzlich vollendet hat (ebenfalls bei Sony erschienen). Heuer ebenfalls abermals vertreten ist der Däne Hans Christian Lumbye, der „Strauss des Nordens“. Sein spritziger Galopp Glædeligt Nytaar! (Frohes neues Jahr!) fügt sich nahtlos in die Programmgestaltung ein. Jetzt erst, beim letzten Stück des offiziellen Konzertprogramms, tritt Josef Strauss hinzu, dessen Delirien-Walzer fraglos einen der einprägsamsten Vertreter dieser beliebten Gattung darstellt. Die Thielemann’sche Darbietung desselben ist gar ein Höhepunkt des heurigen Neujahrskonzerts. Josef Strauss ist es auch, der gleich danach die erste Zugabe, die einzige wirkliche Überraschung des Konzerts, beisteuert. Seine feurig dargebotene Jockey-Polka versöhnt diejenigen, die den womöglich genialsten der Strauss-Brüder heuer etwas vernachlässigt sahen. Nach einem wohltuend nüchternen Neujahrsgruß des Dirigenten geht man zu den weiteren Zugaben über. Den weltbekannten Donauwalzer alias An der schönen blauen Donau meint man schon lange nicht mehr so locker und doch voller Pläsier gehört zu haben. Freimütig heraus gesagt: Diese Interpretation darf sich ganz vorne einreihen, trotz solch illustrer und zurecht gerühmter Vorgänger wie Willi Boskovsky, Herbert von Karajan und Georges Prêtre. Ganz zum Schluss dann erwartbar Johann Strauss Vater mit seinem Radetzky-Marsch. Das (diesmal leider besonders unkoordinierte) Klatschen wird man dem Publikum in diesem Leben nicht mehr austreiben können, aber was wäre ein Neujahrskonzert auch ohne nicht zumindest einen kleinen Wermutstropfen.
In der Summe ein beglückendes Neujahrskonzert, durchaus eines der erinnerungswürdigsten der letzten Zeit. Der Berliner Christian Thielemann hat in diesem urwienerischen Repertoire weiter an Statur gewonnen und, nicht zuletzt dank der erkennbar auf Gegenseitigkeit beruhenden innigen Verbindung mit dem Orchester, womöglich seine letzten Kritiker überzeugen können. Chapeau also und Prosit Neujahr! Daniel Hauser
.
 Alle Jahre wieder wird das neue Jahr mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker eingeleitet. Standen die letzten beiden Konzerte noch unter dem Eindruck der Pandemie, so war dies diesmal, am 1. Jänner 2023, erfreulicherweise kaum mehr nennenswert der Fall. Zum bereits dritten Male (nach 2011 und 2013) wurde der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst mit der musikalischen Leitung geehrt, wobei sein letzter Auftritt zu diesem Anlass vor haargenau einem Jahrzehnt stattfand. Traditionell liegt die CD bereits wenige Tage später vor, so auch heuer (Sony 19658717382).
Alle Jahre wieder wird das neue Jahr mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker eingeleitet. Standen die letzten beiden Konzerte noch unter dem Eindruck der Pandemie, so war dies diesmal, am 1. Jänner 2023, erfreulicherweise kaum mehr nennenswert der Fall. Zum bereits dritten Male (nach 2011 und 2013) wurde der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst mit der musikalischen Leitung geehrt, wobei sein letzter Auftritt zu diesem Anlass vor haargenau einem Jahrzehnt stattfand. Traditionell liegt die CD bereits wenige Tage später vor, so auch heuer (Sony 19658717382).
Von den insgesamt 18 Stücken der Doppel-CD stellen nicht weniger als 14 Neujahrskonzert-Premieren da, wie ein roter Aufkleber auf der CD-Hülle verheißt. Das ist neuer Rekord und durchaus begrüßenswert. Sieht man sich die Namen der berücksichtigten Komponisten an, so ist Johann Strauss Sohn, fraglos der Spitzenreiter der Wiener Neujahrskonzerte insgesamt, diesmal gerade zweimal auf dem offiziellen Programm vertreten (Zigeunerbaron-Quadrille und die eingängige Schnellpolka Frisch heran!). Freilich, als Zugabe kommt noch der Banditen-Galopp sowie der unvermeidliche Donauwalzer hinzu. Die Tendenz ist gleichwohl eindeutig. Unstrittiger Gewinner ist diesmal sein Bruder Josef Strauss, mit sage und schreibe sieben Werken vertreten. Bereits der Auftakt mit dem großartigen, kaum geläufigen Walzer Heldengedichte spricht Bände über dessen Qualitäten. Von den drei weiteren Walzern aus Josefs Feder ist einzig Aquarellen zurecht berühmt, doch auch Perlen der Liebe und Zeisserln wissen für sich einzunehmen. Hinzu treten zwei Polkas françaises – eine Gattung, in der er besonders brilliert –, nämlich die Angelica-Polka sowie Heiterer Muth – letztere mit Chorbegleitung, heuer erstmals nicht nur durch die Wiener Sängerknaben, sondern auch die Wiener Chormädchen. Mit For ever, einer schnellen Polka, und dem Allegro fantastique wird der „josefinische“ Beitrag beschlossen. Der dritte, lange Zeit übersehene Strauss-Bruder Eduard erfährt auch langsam die Anerkennung, die ihm gebührt. Seine spritzige Schnellpolka Wer tanzt mit? eröffnet das Konzert. Zur selben Gattung gehört auch Auf und davon. Gerne würde man auch einmal einen Walzer Eduards auf dem Konzertprogramm sehen.
Eine andere schöne Entwicklung ist, dass Carl Michael Ziehrer, als Nachfolger der „Sträusse“ der letzte k. u. k. Hofball-Musikdirektor der Donaumonarchie und in Wien deren namhafteste Kontrahent, sich mittlerweile beim Jahrzehnte lang hinsichtlich der Programmgestaltung sehr konservativen Neujahrskonzert etabliert hat. Abermals wird ein großer Walzer aus seiner Feder beigesteuert: In lauschiger Nacht steht gegenüber seinen bekannteren Genrebeiträgen wie Wiener Bürger und Hereinspaziert! kaum nach und gibt wie diese gewisse Rückschlüsse auf Ziehrers langjährige Tätigkeit als Militärkapellmeister. Eine Freude auch, den Namen Joseph Hellmesbergers des Jüngeren abermals auf dem Programm in Form von Glocken-Polka und Galopp zu finden. Schließlich darf seit geraumer Zeit auch Franz von Suppè nicht mehr bei der Programmauswahl fehlen. Wie schon des Öfteren, ist es auch im heurigen Jahr eine Ouvertüre, nämlich diejenige zu seiner komischen Operette Isabella, welche die typischen Stärken dieses Komponisten unter Beweis stellt.
Bleiben die Zugaben als letztes Reservoir von Johann Strauss Vater und Sohn. An der schönen blauen Donau vom Junior hat ganz ohne Frage die längste Aufführungsgeschichte und ermöglicht insofern die breiteste Vergleichbarkeit. Tatsächlich reiht sich Welser-Möst trotz übermächtiger Konkurrenz (Karajan, Prêtre, Muti) durchaus in den vorderen Reihen ein. Überhaupt: Das Neujahrskonzert 2023 ist ohne Frage sein bisher bestes. Ein feuriger Abschluss der bisweilen zur Karikatur zu verkommen drohende Radetzky-Marsch des Seniors. Heuer durchaus mitnichten. Insgesamt eines der besseren unter den vielen Neujahrskonzerten. Daniel Hauser
.
Seit nunmehr 80 Jahren beginnt das musikalische neue Jahr mit dem bekanntesten aller Neujahrskonzerte, demjenigen der Wiener Philharmoniker aus dem Goldenen Saal des Musikvereins in Wien (von Sony sind in Folge zwei Viel-CD-Boxen dazu erschienen, dazu nachstehend mehr). 1941 fand dieses Konzert zum ersten Male regulär in der bis heute üblichen Form statt, wenngleich seine Geschichte genaugenommen noch ein wenig weiter zurückgeht, fiel der eigentliche Startschuss doch bereits am 31. Dezember 1939 als Silvesterkonzert. Angesichts dieser Jahreszahlen stellt sich unweigerlich die Frage, in welchem Zusammenhang es überhaupt zu diesen musikalischen Veranstaltungen zur Begehung des Jahreswechsels kam. Ein zumindest mittelbarer Zusammenhang mit der ausgefeilten Propagandamaschinerie der nationalsozialistischen Machthaber lässt sich nach der heutigen Quellenlage nicht abstreiten. Der „Anschluss“ lag nicht lange zurück. Hitler und Goebbels verstanden es, den Nimbus der Musikstadt Wien für die eigenen Zwecke einzuspannen. Die ersten wirklichen Neujahrskonzerte von 1941 bis 1945 fanden dann auch als Benefizkonzerte zugunsten der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ statt.

31. Dezember 1939 – Erstes Neujahrskonzert (eigentlich Silvesterkonzert) der Wiener Philharmoniker. Seit Jahrzehnten präsentieren die Wiener Philharmoniker zum Jahreswechsel ein Programm aus dem Repertoire der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen. Die Nachfrage für die Hauptdarbietung am Neujahrsvormittag und zwei Begleitkonzerte ist enorm: Karten werden ausschließlich über die Website der Wiener Philharmoniker verlost. Sie kosten für das Neujahrskonzert teilweise über 1.000 Euro. Die Veranstaltungen erreichen durch die weltweite Fernsehübertragung zudem Zuschauer in mittlerweile über 90 Ländern. Seinen Ursprung hat das Spektakel im Nationalsozialismus: Am 31. Dezember 1939, vier Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, geben die Wiener Philharmoniker unter der Leitung des Dirigenten Clemens Krauss ein Johann-Strauß-Konzert. Es wird im Radio übertragen. Die Walzerklänge passen bestens in die Strategie der Nazi-Propaganda. Die leichten Melodien sollen die Sorge um Angehörige an der Front zerstreuen. Die Einnahmen des Silvesterkonzerts stellen die Wiener Philharmoniker zur Gänze dem von Adolf Hitler kurz zuvor eröffneten ersten „Winterhilfswerk“ zur Verfügung. Im Jahr darauf wird das Konzert vom Silvester- auf den Neujahrsvormittag verlegt: Am 1. Januar 1941 spielen die Wiener Philharmoniker – wieder unter der Leitung von Krauss – „zum ersten Mal für die NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude'“, wie es in der Konzertankündigung des „Neuigkeits-Welt-Blatts“ vom 22. Dezember 1940 heißt (… weiterlesen hier). (Quelle WDR)
Interessanterweise gab es beim Neujahrskonzert nach Kriegsende nur temporär einen dezenten Bruch: Leitete die Konzerte in Kriegstagen der ehemalige Wiener Staatsoperndirektor Clemens Krauss, wurde für die Neujahrskonzerte 1946 und 1947 der jüdischstämmige Dirigent Josef Krips dazu berufen. Es ist freilich bezeichnend, dass Krauss trotz seiner Verwicklungen in der NS-Zeit ab 1948 wieder die musikalische Leitung der Konzerte übernahm und diese bis 1954, seinem Todesjahr, ununterbrochen behielt. Für die Musik der Strauss-Dynastie hat Krauss ganz ohne Frage einen immensen Beitrag geleistet und ihr auch zum endgültigen Durchbruch bei den Wiener Philharmonikern verholfen. In der Krauss-Epoche kam es auch zur erstmals am 31. Dezember 1952 erfolgten Voraufführung als Silvesterkonzert.
Nach Krauss‘ unerwartetem Ableben erfolgte eine Art Behelfslösung, indem ab 1955 Willi Boskovsky, Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, einsprang. Diese womöglich zunächst als Provisorium angelegte Lösung führte zu einem Vierteljahrhundert Wiener Neujahrskonzert unter Boskovsky, welcher diesem folglich seinen Stempel fest aufdrückte. Seit dem 30. Dezember 1962 gab es eine zweite Voraufführung, welche bis 1997 als geschlossene Veranstaltung für Angehörige des Bundesheeres firmierte. In diese Ära fällt auch das allmählich immer stärker erwachende internationale Interesse an diesem Konzert, das seit 1959 vom ORF nicht mehr bloß im Rundfunk, sondern auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde, ab 1969 schließlich auch in Farbe. Unter Boskovsky kam es auch zu den ersten kommerziellen Einspielungen des Neujahrskonzertes, wobei eine Decca-Platte anlässlich des 25. Jubiläums seines Dirigats 1979 den Anfang machte (das Konzert von 1975 erschien erst nachträglich, zumindest in Japan, ebenfalls).
Die nächsten Jahre ab 1980 dominierte mit dem US-Amerikaner Lorin Maazel wieder ein Dirigent von Weltformat. Dieses Verhältnis erreichte in der Berufung Maazels zum Direktor der Wiener Staatsoper im Jahre 1982 seinen Höhepunkt, doch endete seine Direktion nach nur zwei Jahren aufgrund unüberbrückbarer Konflikte mit der Bürokratie. Interessanterweise blieb sein Engagement beim Wiener Neujahrskonzert davon zunächst unberührt, welchem er noch bis 1986 ohne Unterbrechung vorstand. Die Deutsche Grammophon Gesellschaft brachte indes nur eine Kompilation der Jahre 1980 bis 1983 auf den Markt. Maazel sollte später noch viermal das Neujahrskonzert leiten (1994, 1996, 1999 und 2005).

Der nächste Paukenschlag, der zum absoluten Weltereignis führen sollte, war ohne Frage die Verpflichtung des beinahe 80-jährigen Herbert von Karajan für das Neujahrskonzert 1987. Dieses gilt zurecht bis auf den heutigen Tag als eines der legendärsten und unvergesslichsten aller Neujahrskonzerte. Es war dann auch das erste seit 1979, das einzeln auf Schallplatte und CD erschien (freilich um den herrlichen Kaiser-Walzer gekürzt, der erst in einer späteren Neuauflage ebenfalls inkludiert wurde).
Von 1987 an bürgerte sich eine alljährlich wechselnde musikalische Leitung der Konzerte ein, wobei die meisten Dirigenten mehrmals die Ehre hatten, zu diesem Anlass auf dem Podium zu stehen. Mit Claudio Abbado (1988 und 1991), Carlos Kleiber (1989 und 1992), Zubin Mehta (1990, 1995, 1998, 2007 und 2015), Riccardo Muti (1993, 1997, 2000, 2004, 2018 und 2021), Nikolaus Harnoncourt (2001 und 2003), Seiji Ozawa (2002), Mariss Jansons (2006, 2012 und 2016), Daniel Barenboim (2009 und 2014), Georges Prêtre (2008 und 2010), Franz Welser-Möst (2011 und 2013), Christian Thielemann (2019) und Andris Nelsons (2020) waren es weitere Dirigenten von Weltrang, die von den Wiener Philharmonikern eingeladen wurden. Für 2022 ist wiederum Barenboim, dann 79, designiert.

Bereits anlässlich des 75. Jubiläums erschien bei Sony Classical eine Gesamtausgabe sämtlicher bei den Neujahrskonzerten gespielten Werke auf 23 CDs, die nun in einer um drei Discs erweiterten Neuausgabe noch einmal zusätzlich um das gesamte Repertoire der letzten fünf Jahre bereichert wurde (Sony 19439764562). Berücksichtigt sind also Aufnahmen von 1941 bis 2019. Die ganze Bandbreite der Wiener Neujahrskonzerte erzeigt sich anhand des glücklicherweise inkludierten Index der Werke, denn neben der Strauss-Dynastie sind die Komponisten Beethoven, Berlioz, Brahms, Czibulka, Delibes, Haydn, Hellmesberger Vater und Sohn, Lanner, Lehár, Liszt, Lumbye, Mozart, Nicolai, Offenbach, Reznicek, Rossini, Schubert, Stolz, Richard Strauss, Suppé, Tschaikowski, Verdi, Wagner, Waldteufel, Weber und Ziehrer – freilich in unterschiedlicher Quantität – mit dabei. Der Anspruch, der hier erhoben wird, ist gewissermaßen der einer Anthologie der Wiener Musik von den Anfängen am Anfang des 19. Jahrhunderts bis hin zum Ende der Donaumonarchie, angereichert um kleine Ausflüge, die teils mit Komponistenjubiläen in Verbindung standen (so 2013 das große Verdi- und Wagner-Jahr). So tut sich ein Rückblick auf die zwischen 1966 und 1971 für Eurodisc entstandene Reihe Wiener Musik unter Robert Stolz auf, die mittlerweile in einer 12-CD-Box bei RCA neu aufgelegt wurde. Obwohl dort neben den Wiener Symphonikern hauptsächlich die Berliner Symphoniker zum Zuge kamen, erklangen die Werke von Lanner bis Ziehrer doch ungemein idiomatisch und stellen somit eine ernsthafte Alternative dar.
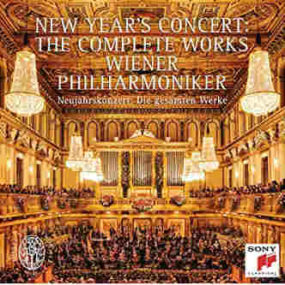
Hier wurde streng chronologisch vergangenen. Anders in der Sony-Neuerscheinung, welche die einzelnen CDs unter thematische Oberbegriffe wie An der schönen blauen Donau, Auf der Jagd oder Liebesgrüße stellt. Das ist eine mögliche Vorgangsweise, doch nötigt sie einem fast zwangsläufig den Blick in den erwähnten Index ab, sucht man ein ganz bestimmtes Werk. Wer ein solches unter diesem und jenem Neujahrskonzert-Dirigenten sucht, wird also mit relativ großer Wahrscheinlichkeit mit einem anderen vorlieb nehmen müssen. Und so herausgerissen aus dem abendlichen Kontext bliebt auch die Atmosphäre auf der Strecke – es ist eben nur noch eine (etwas lässliche und beliebige) Anthologie, kein Miterleben. Hier bleibt dann letztlich bloß der Erwerb der (teilweise nur mehr gebraucht zu findenden) jeweiligen CD des entsprechenden konkreten Neujahrskonzerts.
.
 Bereits zum zweiten Mal fand das weltbekannte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am 1. Jänner 2022 während der Corona-Pandemie statt, diesmal zumindest nicht völlig ohne Publikum – wie es Riccardo Muti im Vorjahr widerfahren war –, aber doch mit einer reduzierten Zahl an Zuschauern, sämtlich im Parkett versammelt. Gleichsam schon traditionell zeichnet Sony für die CD-Ausgabe verantwortlich (194399625026). Am Dirigentenpult der Wiener Philharmoniker durfte Daniel Barenboim nach 2009 und 2014 sein drittes Neujahrskonzert leiten.
Bereits zum zweiten Mal fand das weltbekannte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am 1. Jänner 2022 während der Corona-Pandemie statt, diesmal zumindest nicht völlig ohne Publikum – wie es Riccardo Muti im Vorjahr widerfahren war –, aber doch mit einer reduzierten Zahl an Zuschauern, sämtlich im Parkett versammelt. Gleichsam schon traditionell zeichnet Sony für die CD-Ausgabe verantwortlich (194399625026). Am Dirigentenpult der Wiener Philharmoniker durfte Daniel Barenboim nach 2009 und 2014 sein drittes Neujahrskonzert leiten.
Barenboim, der im achtzigsten Lebensjahr steht, debütierte schon 1965 bei den Philharmonikern, allerdings in seiner Eigenschaft als Pianist. Als Dirigenten luden ihn die Wiener 1989 erstmals ein. Man darf also mit Fug und Recht von einer sehr langjährigen und engen Partnerschaft sprechen, die den gebürtigen Argentinier mit diesem Klangkörper verbindet. Routine ist dieses Konzertereignis, mit dem stets das musikalische Jahr eröffnet wird, auch für einen Profi wie Barenboim mitnichten. Die gebotene Seriosität war stellenweise gar etwas zu deutlich spürbar. Freilich hat sich Barenboim eingehend mit den Eigenheiten der Wiener Musik auseinandergesetzt und ist besser als manch anderer im Stande, den adäquaten Walzertakt zu schlagen.
Überhaupt standen zwei Werke dieser Gattung im Mittelpunkt, nämlich die vom Dirigenten sehr geschätzten Sphärenklänge, die gemeinhin als Höhepunkt im Schaffen von Josef Strauss gelten und die diesmal den offiziellen Teil des Neujahrskonzerts beendeten, und zum anderen Nachtschwärmer, ein Paradestück des noch immer zu Unrecht im Schatten der „Sträusse“ stehenden Carl Michael Ziehrer, des letzten k. u. k. Hofballmusikdirektors, dessen Todestag sich heuer übrigens zum hundertsten Mal jährt. Bei diesem Walzer durften die Philharmoniker sogar selbst mitsingen und mitsummen. Hier kam dann doch etwas von der Heiterkeit herüber, welche frühere Neujahrskonzerte auszeichnete.
Der Ziehrer-Walzer war eine von nicht weniger als sechs Premieren, wobei allein drei davon auf den genannten Josef Strauss entfielen (der Phönix-Marsch, die Polka mazur Die Sirene und die Nymphen-Polka). Eduard Strauss war zwar auch diesmal der am wenigsten bedachte Strauss-Bruder, doch immerhin erklang seine Schnellpolka Kleine Chronik zum ersten Mal im Rahmen eines Neujahrskonzerts. Das andere Stück des „schönen Edi“ war die Polka française Gruß an Prag. Seit langem hat man den Eindruck, dass man seinen Walzern die Neujahrskonzert-Tauglichkeit nicht so wirklich zutraut. Ein Aufsteiger der letzten Jahre war Joseph Hellmesberger junior, der das letzte Premierenstück Heinzelmännchen beisteuerte – neben dem Galopp Kleiner Anzeiger.
Obwohl Johann Strauss Sohn mit acht von achtzehn Werken noch immer dominiert (darunter der Walzer Tausend und eine Nacht, die Fledermaus-Ouvertüre und der Persische Marsch), ist doch eine gewisse Entwicklung dahin spürbar, seine absolute Dominanz zu brechen, was zu begrüßen ist, hat doch gerade das in alle Welt übertragene Neujahrskonzert aus Wien das Potential, weniger präsente Stücke populärer zu machen. Mit dem Phönix-Schwingen-Walzer gleich zu Beginn nach dem genannten Phönix-Marsch wollte man gewiss ein Zeichen setzen: Wie Phönix aus der Asche. Als Zugabe erklang dann nochmal eine Schnellpolka des jüngeren Johann Strauss (Auf der Jagd), bevor Barenboim in seiner Neujahrsansprache (auf Englisch) seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass das gesellschaftliche Auseinanderbrechen gestoppt werden könne und eine Rückbesinnung auf die Einheit einsetze, wie es die Musiker im Orchester vorlebten.
Den Donauwalzer nahm Barenboim anschließend im eher breiten Zeitmaß – wie er das gesamte Konzert symphonisch auslegte –, bevor der abschließende Radetzky-Marsch (heuer das einzige Werk von Johann Strauss Vater) leider wie üblich vom Publikum zerklatscht wurde. Fast wünschte man sich zumindest an dieser Stelle die Ruhe im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins zurück, wie sie 2021 pandemiebedingt einmalig zustande gekommen war. Wie unlängst Usus, erscheint auch dieses Jahr zusätzlich eine DVD- und Blu-ray-Ausgabe des Konzerts. Für 2023 ist bereits der Österreicher Franz Welser-Möst, dann gleichfalls zum dritten Mal, zum Dirigenten des Neujahrskonzerts bestimmt worden. Daniel Hauser
.

Das Neujahrskonzert 2021 (auf CD als Sony 19439840162) stand im Vorfeld unter einem denkbar schlechten Stern, war seine Durchführung aufgrund der Pandemie doch alles andere als sicher und seine letztendliche Ermöglichung durchaus auch von kritischen Tönen begleitet. Nichtsdestoweniger sorgte das im Annus horribilis 2020 bewährte Krisenkonzept der Wiener Philharmoniker, die sogar eine Japan-Tournee bestreiten konnten, dafür, dass es am Ende unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden konnte. Mit Riccardo Muti, im achtzigsten Lebensjahr stehend und gleichsam der Nestor unter den italienischen Dirigenten unserer Zeit, hatte man bereits vor Kenntnis des Jahresverlaufes glücklicherweise einen dem Orchester besonders eng verbundenen Maestro für 2021 vorgesehen, der bereit war, sich den nicht unerheblichen Strapazen und harte Restriktionen, an deren Einhaltung das ordnungsgemäße Procedere geknüpft war, zu unterwerfen.
Die Programmauswahl für 2021 war ohne Frage eine der vielversprechendsten seit langem, fanden doch erstmals drei Komponisten gebührende Beachtung, die zu Unrecht im Schatten der Strauss-Dynastie stehen. Die im selben Jahre 1842 geborenen Carl Millöcker und Carl Zeller gingen besonders als Operettenkomponisten in die Geschichte ein. So nimmt es nicht wunder, dass die dafür ausgewählten Stücke, der Galopp In Saus und Braus von Millöcker und der Walzer Grubenlichter von Zeller, auf Motiven aus zwei Operetten, Der Probekuss sowie Der Obersteiger, beruhen. Für den unbedarften Hörer dürfte vor allen Dingen der Walzer Bad’ner Mad’ln (bezogen auf Baden bei Wien) des österreichisch-tschechischen Komponisten Karl Komzák Sohn ein unerwarteter Höhepunkt des Konzerts gewesen sein. Freilich war dessen Aufnahme ins Neujahrskonzert seit Jahrzehnten überfällig und erstaunte sein bisheriges Fehlen den Kenner.
Kein Geringerer als der vor allem als Wagner-Dirigent unsterblich gewordene Hans Knappertsbusch hatte die Bad’ner Mad’ln zu seinem absoluten Lieblingswalzer erkoren und häufig seine Konzertprogramme damit gewürzt. Man muss bis ins Jahr 1970 zurückgehen, um diesen Konzertwalzer auf einem Programm der Wiener Philharmoniker zu finden (übrigens anlässlich eines Konzerts in Bern unter Boskovsky). Allzu viele Aufnahmen des Werkes gibt es seit Knappertsbusch nicht; Muti hat im Zuge dieses Neujahrskonzerts nun die überzeugendste Interpretation seither vorgelegt. Überhaupt betont dieser Dirigent, gebürtiger Neapolitaner, zurecht die Verbindung zwischen Wien und Italien. Die Walzerseligkeit liegt Muti folglich im Blute und er wurde mit jedem seiner Auftritte beim Wiener Neujahrskonzert idiomatischer.

Daher waren es wirklich gerade die betont sinfonisch angelegten großen Walzer, die die 2021er Veranstaltung zum musikalischen Highlight werden ließen. Neben einem weiteren Werkdebüt – Schallwellen von Johann Strauss Sohn – kam die Crème de la crème der Strauss-Walzer zum Zuge: Frühlingsstimmen (heuer ohne Gesang), der Kaiser-Walzer und natürlich An der schönen blauen Donau. Fürwahr: Breitere Zeitmaße dürfte man bei diesen Hits noch nicht vernommen haben. Den imperialen Kaiser-Walzer bringt Muti auf sage und schreibe 13 Minuten, ohne dass der Spannungsbogen abbräche. So überzeugend hat man dieses späte Glanzlicht im Œuvre des Walzerkönigs seit Karajan nicht gehört. Meisterlich der Einsatz der Rubati, die sich durch eine wahrlich wienerische Note auszeichnen. Muti wäre nicht Muti, käme nicht auch Franz von Suppè, einer seiner heimlichen Favoriten, vor. Mit dem einleitenden Fatinitza-Marsch aus der gleichnamigen Operette begann das Konzert mit dem nötigen Schwung, ohne ins Überschwängliche zu verfallen. Die großartige Ouvertüre zur Operette Dichter und Bauer leitete sodann den zweiten Teil des Konzerts ein. Mit der der ersten Königin des vereinten Italien gewidmeten Margherita-Polka von Josef Strauss setzte der Maestro ein weiteres Zeichen der austro-italienischen Verbundenheit. Dieser Strauss-Sprössling war sodann auch mit der schnellen Polka Ohne Sorgen vertreten. Auch wenn besonders in der zweiten Konzerthälfte die Dominanz des berühmteren Bruders Johann unübersehbar war, kam ihr gleichnamiger Vater neben dem traditionell als Zugabe gespielten Radetzky-Marsch (diesmal zum Glück ohne „Zerklatschen“, daher auch in seiner ganzen Detailfreudigkeit nachvollziehbar) noch mit dem flotten Venetianer-Galopp zu seinem Recht. Ohne Übertreibung darf sich dieses Neujahrskonzert von 2021 unter die herausragendsten einreihen und wurde insofern doch noch zu einem musikalischen Hoffnungsschimmer für das neue Jahr. Daniel Hauser
 Der französische Tenor Cyrille Dubois verzichtet auf alle Experimente und Zutaten, versucht es ganz schlicht, sich nur mit seiner Stimme Gehör zu verschaffen. Und das ist ihm in seiner Aufnahme, die beim französischen Label NoMadMusic herausgekommen ist, nach meinem Eindruck vorzüglich gelungen (NMM 117). Begleitet wird er am Flügel von seiner Landsfrau Anne Le Bozec, die seit 2005 als Professorin für Lied- und Vokalbegleitung am Konservatorium Paris lehrt. Der von ihr entscheidend mitbestimmte Vortrag ist flott, doch nicht gehetzt. Sie lässt sich selbstbewusst durch eigene Lösungen vernehmen, die aber nie in Widerspruch mit der Gesangslinie geraten. Vielmehr hat es den Eindruck, als wandere da am Flügel noch jemand mit. Zwischen Forte und Piano bewegt sich das Ausdrucksspektrum beider Künstler auf verschlungenen Wegen. In diesem Spannungsfeld wird das Geschehen ausgebreitreit. „Nur nicht so laut“, heißt es gleich im ersten Lied. Dieser Einwurf könnte auch ein Motto der Interpretation sein. Nie wirkte die Stimme von Dubois auf mich empfindsamer und feiner als in dieser Aufnahme. Einem Seismograph gleich, reagiert sie gleichermaßen auf äußere und innere Ereignisse. Zwischen den Liedern werden oft auffällig lange Pausen von bis zu acht Sekunden eingelegt, die sich auch als hörerfreundlich erweisen. Dadurch ist der gelegentlich schroffe Wechsel zwischen Schauplätzen und Gemütszuständen gut nachzuvollziehen, ohne dass der Zusammenhalt gefährdet wird. Was aber inhaltlich zusammengehört, rückt auch in der Abfolge, dann nur durch kürzere Pausen getrennt, eng zusammen. Schließlich soll das Publikum an den Lautsprechern oder unter den Kopfhörern auch folgen können. Ich bevorzuge Kopfhörer, weil sie einen die Darbietung noch viel näher bringen kann.
Der französische Tenor Cyrille Dubois verzichtet auf alle Experimente und Zutaten, versucht es ganz schlicht, sich nur mit seiner Stimme Gehör zu verschaffen. Und das ist ihm in seiner Aufnahme, die beim französischen Label NoMadMusic herausgekommen ist, nach meinem Eindruck vorzüglich gelungen (NMM 117). Begleitet wird er am Flügel von seiner Landsfrau Anne Le Bozec, die seit 2005 als Professorin für Lied- und Vokalbegleitung am Konservatorium Paris lehrt. Der von ihr entscheidend mitbestimmte Vortrag ist flott, doch nicht gehetzt. Sie lässt sich selbstbewusst durch eigene Lösungen vernehmen, die aber nie in Widerspruch mit der Gesangslinie geraten. Vielmehr hat es den Eindruck, als wandere da am Flügel noch jemand mit. Zwischen Forte und Piano bewegt sich das Ausdrucksspektrum beider Künstler auf verschlungenen Wegen. In diesem Spannungsfeld wird das Geschehen ausgebreitreit. „Nur nicht so laut“, heißt es gleich im ersten Lied. Dieser Einwurf könnte auch ein Motto der Interpretation sein. Nie wirkte die Stimme von Dubois auf mich empfindsamer und feiner als in dieser Aufnahme. Einem Seismograph gleich, reagiert sie gleichermaßen auf äußere und innere Ereignisse. Zwischen den Liedern werden oft auffällig lange Pausen von bis zu acht Sekunden eingelegt, die sich auch als hörerfreundlich erweisen. Dadurch ist der gelegentlich schroffe Wechsel zwischen Schauplätzen und Gemütszuständen gut nachzuvollziehen, ohne dass der Zusammenhalt gefährdet wird. Was aber inhaltlich zusammengehört, rückt auch in der Abfolge, dann nur durch kürzere Pausen getrennt, eng zusammen. Schließlich soll das Publikum an den Lautsprechern oder unter den Kopfhörern auch folgen können. Ich bevorzuge Kopfhörer, weil sie einen die Darbietung noch viel näher bringen kann. Nicht selten lässt Dubois einzelne Worte trillerhaft erzittern. Was ein Trick sein könnte, um der Dramatik dieses Liederzyklus Herr zu werden, schafft zugleich auch eine stilistische Nähe zum Operngesang, die mich selbst nicht stört, ihm aber auch als grenzwertiges Manko ausgelegt werden könnte. Lyrische Passagen, mit denen die Winterreise in reichem Maße gesegnet ist, gelingen am eindrucksvollsten. Wasserflut, das sechste Lied, das in seiner Darbietung nicht enden will, dürfte nicht nur von mir als eine der mit Abstand besten Leistungen wahrgenommen worden sein. Nicht nur dieses Lied versieht Dubois mit einem impressionistischen Touch, der dem Zyklus sehr gut steht. In solchen Momenten ist er als Sänger ganz Franzose, der ein fabelhaftes Deutsch beherrscht. Sein ganz leichter Akzent stört überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir Deutsche hören es schließlich ganz gern, wenn sich Franzosen unserer Sprache bedienen. In Schlagern, Filmen oder im Theater wurde ein exotischer Kult daraus. Dubois spielt aber nicht damit. Er kann und will nur seine Herkunft nicht verleugnen. Und das ist gut so. Das Cover der Neuerscheinung ist auffällig: Ganz in Weiß die beiden Akteure vor ebensolchem Hintergrund. Mehr als Schnee und Eis assoziiert diese Wahl eine steril-klinische Atmosphäre, wie man sie vom Regietheater kennt. In der Tat verbreitet die Aufnahme eine gewisse Distanz und Kühle. Gefühle werden nur in kleinen Dosen zugelassen. Dubois gibt sich in seiner Interpretation mehr als Erzähler denn als Betroffener.
Nicht selten lässt Dubois einzelne Worte trillerhaft erzittern. Was ein Trick sein könnte, um der Dramatik dieses Liederzyklus Herr zu werden, schafft zugleich auch eine stilistische Nähe zum Operngesang, die mich selbst nicht stört, ihm aber auch als grenzwertiges Manko ausgelegt werden könnte. Lyrische Passagen, mit denen die Winterreise in reichem Maße gesegnet ist, gelingen am eindrucksvollsten. Wasserflut, das sechste Lied, das in seiner Darbietung nicht enden will, dürfte nicht nur von mir als eine der mit Abstand besten Leistungen wahrgenommen worden sein. Nicht nur dieses Lied versieht Dubois mit einem impressionistischen Touch, der dem Zyklus sehr gut steht. In solchen Momenten ist er als Sänger ganz Franzose, der ein fabelhaftes Deutsch beherrscht. Sein ganz leichter Akzent stört überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir Deutsche hören es schließlich ganz gern, wenn sich Franzosen unserer Sprache bedienen. In Schlagern, Filmen oder im Theater wurde ein exotischer Kult daraus. Dubois spielt aber nicht damit. Er kann und will nur seine Herkunft nicht verleugnen. Und das ist gut so. Das Cover der Neuerscheinung ist auffällig: Ganz in Weiß die beiden Akteure vor ebensolchem Hintergrund. Mehr als Schnee und Eis assoziiert diese Wahl eine steril-klinische Atmosphäre, wie man sie vom Regietheater kennt. In der Tat verbreitet die Aufnahme eine gewisse Distanz und Kühle. Gefühle werden nur in kleinen Dosen zugelassen. Dubois gibt sich in seiner Interpretation mehr als Erzähler denn als Betroffener. Nicht zuletzt durch die Übermacht des schon erwähnten Fischer-Dieskau auf dem Musikmarkt, der im Laufe seiner langen Karriere an die zehn Winterreisen eingespielt hat, ist der Eindruck entstanden, als seien Baritone und Bässe mit dem Zyklus häufiger dokumentiert als Tenöre. Da ist durchaus etwas dran. Für eine genaue Aussage müssten alle Aufnahmen durchgezählt werden, auch jene in Rundfunkarchiven, die nie veröffentlicht wurden. Ich kann mich nicht entscheiden, welcher Stimmlage ich den Vorzug gebe. Kennengelernt habe ich die Winterreise mit einem Tenor – nämlich mit Peter Anders in der von Michael Raucheisen begleiteten Einspielung des Reichsrundfunks Berlin von 1945, die oft auf Platte, später auch als CD aufgelegt wurde. Ich war sofort angesteckt von der fiebrigen und extrovertierten Darbietung, die keinen Zweifel daran ließ, dass hier einer den Zyklus so singt, als sei ihm die Geschichte des jungen Mannes, der im Dunkeln fremd auszog, und am Ende das Schicksal des einsamen Leiermanns „drüben hinter’m Dorfe“ bauf dem Eis teilt, selbst geschehen. Mit Hans Hotter eröffnete mir ein Heldenbariton eine andere Perspektive, indem er das dramatische Geschehen bis in alle Einzelheiten auslotete, ergründete und deutete – also nicht betont nacherlebend zu Gehör brachte. Dafür ließ er sich viel mehr Zeit als der fast gleichaltrige Kollege. Hotter beförderte Details zutage, über die Anders hinwegsauste. Deshalb ist seine Aufnahme von 1955 mit Gerald Moore am Flügel (EMI) für mich immer maßstäblich geblieben – auch wenn er ziemlich alt und behäbig wirkt. Anders nahm seine Winterreise mit siebenunddreißig Jahren auf, Hotter mit sechsundvierzig.
Nicht zuletzt durch die Übermacht des schon erwähnten Fischer-Dieskau auf dem Musikmarkt, der im Laufe seiner langen Karriere an die zehn Winterreisen eingespielt hat, ist der Eindruck entstanden, als seien Baritone und Bässe mit dem Zyklus häufiger dokumentiert als Tenöre. Da ist durchaus etwas dran. Für eine genaue Aussage müssten alle Aufnahmen durchgezählt werden, auch jene in Rundfunkarchiven, die nie veröffentlicht wurden. Ich kann mich nicht entscheiden, welcher Stimmlage ich den Vorzug gebe. Kennengelernt habe ich die Winterreise mit einem Tenor – nämlich mit Peter Anders in der von Michael Raucheisen begleiteten Einspielung des Reichsrundfunks Berlin von 1945, die oft auf Platte, später auch als CD aufgelegt wurde. Ich war sofort angesteckt von der fiebrigen und extrovertierten Darbietung, die keinen Zweifel daran ließ, dass hier einer den Zyklus so singt, als sei ihm die Geschichte des jungen Mannes, der im Dunkeln fremd auszog, und am Ende das Schicksal des einsamen Leiermanns „drüben hinter’m Dorfe“ bauf dem Eis teilt, selbst geschehen. Mit Hans Hotter eröffnete mir ein Heldenbariton eine andere Perspektive, indem er das dramatische Geschehen bis in alle Einzelheiten auslotete, ergründete und deutete – also nicht betont nacherlebend zu Gehör brachte. Dafür ließ er sich viel mehr Zeit als der fast gleichaltrige Kollege. Hotter beförderte Details zutage, über die Anders hinwegsauste. Deshalb ist seine Aufnahme von 1955 mit Gerald Moore am Flügel (EMI) für mich immer maßstäblich geblieben – auch wenn er ziemlich alt und behäbig wirkt. Anders nahm seine Winterreise mit siebenunddreißig Jahren auf, Hotter mit sechsundvierzig.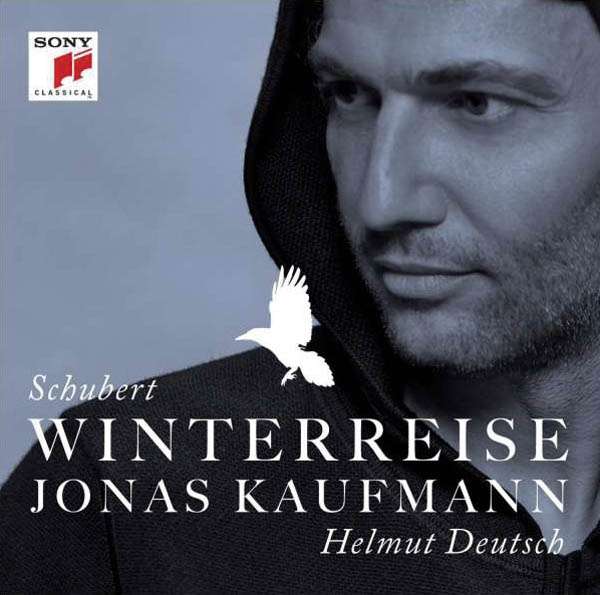 Die Auswahl an verfügbaren Aufnahmen von Tenören ist also durchaus üppig – und auch superb. Aus der historischen Abteilung sind unbedingt Julis Patzak (Preiser), Anton Dermota (Telefunken und Preiser), Ernst Haefliger (Deutsche Grammophon und Claves), Peter Pears (Decca) und Rudolf Schock (Eurodisc) zu nennen. In die Jahre gekommen ist die immer noch frisch wirkende Deutung durch den DDR-Tenor Eberhard Büchner (Eterna). Mit dem Kanadier Jon Vickers (EMI und VAI), dem Schweden Set Svanholm (Andromeda) und René Kollo (Oehms) haben sich auch drei Heldentenöre dem Werk zugewandt ohne allerding herausragende Maßstäbe setzen zu können. Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn legte 2013 Jonas Kaufmann seine stimmlich unverkennbare Version bei Sony, mit der er vor allem seinen vielen Fans gefallen haben dürfte. Schließlich wären da noch aus jünger Zeit Pavol Breslik (Orfeo), Markus Schäfer (Cavi Music), Jan Kobow (ATMA), Werner Güra (Harmonia Mundi) und Daniel Behle (Sony), der mit einem interessanten Album punkten konnte, das gleich zwei Fassungen enthielt, einmal das Original und zum anderen den ganzen Zyklus mit Trio-Begleitung. Es ist also viel Bewegung auf dem Markt. Nun ist auch Dubois dazu gekommen. Rüdiger Winter
Die Auswahl an verfügbaren Aufnahmen von Tenören ist also durchaus üppig – und auch superb. Aus der historischen Abteilung sind unbedingt Julis Patzak (Preiser), Anton Dermota (Telefunken und Preiser), Ernst Haefliger (Deutsche Grammophon und Claves), Peter Pears (Decca) und Rudolf Schock (Eurodisc) zu nennen. In die Jahre gekommen ist die immer noch frisch wirkende Deutung durch den DDR-Tenor Eberhard Büchner (Eterna). Mit dem Kanadier Jon Vickers (EMI und VAI), dem Schweden Set Svanholm (Andromeda) und René Kollo (Oehms) haben sich auch drei Heldentenöre dem Werk zugewandt ohne allerding herausragende Maßstäbe setzen zu können. Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn legte 2013 Jonas Kaufmann seine stimmlich unverkennbare Version bei Sony, mit der er vor allem seinen vielen Fans gefallen haben dürfte. Schließlich wären da noch aus jünger Zeit Pavol Breslik (Orfeo), Markus Schäfer (Cavi Music), Jan Kobow (ATMA), Werner Güra (Harmonia Mundi) und Daniel Behle (Sony), der mit einem interessanten Album punkten konnte, das gleich zwei Fassungen enthielt, einmal das Original und zum anderen den ganzen Zyklus mit Trio-Begleitung. Es ist also viel Bewegung auf dem Markt. Nun ist auch Dubois dazu gekommen. Rüdiger Winter













 An der Covent Garden Oper London trat sie 1965 als Amelia in Verdis »Simon Boccanegra« auf. Im italienischen Fernsehen wirkte sie in Aufführungen der Opern »Othello« von Verdi und »Lohengrin« von Wagner mit. Zu den Glanzrollen der Künstlerin gehörten die Medea in Cherubinis Oper gleichen Namens, die Maddalena in »Andrea Chénier« von Giordano, die Nedda im »Bajazzo«, die Santuzza in »Cavalleria rusticana«, die Tosca, die Butterfly, die Aida, die Amelia in Verdis »Ballo in maschera«, die Leonore im »Troubadour« und in »La forza del destino« von Verdi, die Elisabetta im »Don Carlos«, die Mathilde in »Wilhelm Tell« von Rossini und die Titelheldin in »Francesca da Rimini« von Zandonai.
An der Covent Garden Oper London trat sie 1965 als Amelia in Verdis »Simon Boccanegra« auf. Im italienischen Fernsehen wirkte sie in Aufführungen der Opern »Othello« von Verdi und »Lohengrin« von Wagner mit. Zu den Glanzrollen der Künstlerin gehörten die Medea in Cherubinis Oper gleichen Namens, die Maddalena in »Andrea Chénier« von Giordano, die Nedda im »Bajazzo«, die Santuzza in »Cavalleria rusticana«, die Tosca, die Butterfly, die Aida, die Amelia in Verdis »Ballo in maschera«, die Leonore im »Troubadour« und in »La forza del destino« von Verdi, die Elisabetta im »Don Carlos«, die Mathilde in »Wilhelm Tell« von Rossini und die Titelheldin in »Francesca da Rimini« von Zandonai.

 Das Label
Das Label 
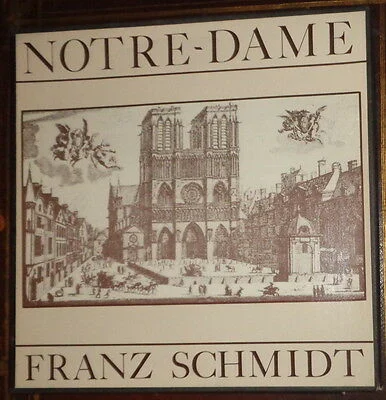 PS.:
PS.:



 Unter seiner Leitung kamen die besten älteren und neueren Werke auf die Scene. Dessen ungeachtet fand der junge Künstler immer noch Zeit, sich mit Composition zu beschäftigen, und einige Kirchen- und Kammerstücke, etliche symphonische Compositionen, ja bereits eine große Messe stammen aus dieser Periode seines Lebens. In seinem Drange nach höherer Ausbildung begab sich S. nach Wien, um dort seine musikalischen Studien fortzusetzen. Im September 1842 kam S. in Wien an und wurde ein Schüler des berühmten Simon Sechter. Schon nach zwei Jahren trat er mit seinem ersten dramatisch-musikalischen Versuche vor; es wurde nämlich seine einactige Oper: „La Primadonna“ im Kärnthnerthor-Theater zur Aufführung gebracht und mit Tadolini und Rovere in den Hauptpartien mehrere Male mit Beifall gegeben.
Unter seiner Leitung kamen die besten älteren und neueren Werke auf die Scene. Dessen ungeachtet fand der junge Künstler immer noch Zeit, sich mit Composition zu beschäftigen, und einige Kirchen- und Kammerstücke, etliche symphonische Compositionen, ja bereits eine große Messe stammen aus dieser Periode seines Lebens. In seinem Drange nach höherer Ausbildung begab sich S. nach Wien, um dort seine musikalischen Studien fortzusetzen. Im September 1842 kam S. in Wien an und wurde ein Schüler des berühmten Simon Sechter. Schon nach zwei Jahren trat er mit seinem ersten dramatisch-musikalischen Versuche vor; es wurde nämlich seine einactige Oper: „La Primadonna“ im Kärnthnerthor-Theater zur Aufführung gebracht und mit Tadolini und Rovere in den Hauptpartien mehrere Male mit Beifall gegeben.




 Alle Jahre wieder wird das neue Jahr mit dem
Alle Jahre wieder wird das neue Jahr mit dem 


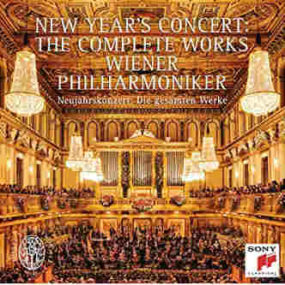
 Bereits zum zweiten Mal fand das weltbekannte
Bereits zum zweiten Mal fand das weltbekannte



 Am 13. September 1934 in Astrachan, seinerzeit RSFSR innerhalb der Sowjetunion, geboren, brillierte die russische Sopranistin
Am 13. September 1934 in Astrachan, seinerzeit RSFSR innerhalb der Sowjetunion, geboren, brillierte die russische Sopranistin 

