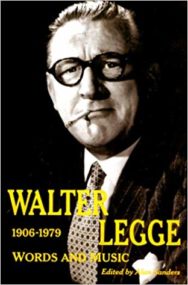In Manchester eilt man mit Weile. Nun endlich erfolgt die lange erwartete Vollendung des Zyklus der sieben Sinfonien von Jean Sibelius mit dem Hallé Orchestra unter seinem Chefdirigenten Mark Elder, der 2020 zudem sein bereits 20-jähriges Jubiläum als dortiger musikalischer Leiter feiern kann. Auch die nun vorgelegten Sinfonien Nr. 4 und 6 erscheinen auf dem Eigenlabel des Orchesters (CD HLL 7553).
Mit einigem Recht kann man behaupten, dass man sich damit die beiden am seltensten gespielten Sinfonien bis zum Schluss aufgehoben hat. Die a-Moll-Sinfonie ist ohne Frage der düsterste Beitrag des Finnen zur Sinfonik, komponiert zwischen 1910 und 1911 und ob ihrer Trostlosigkeit von der Kritik von Anfang an nicht unbedingt verstanden. Elder wählt gemessene Tempi, gerade im Vergleich mit Karajans Klassiker für die Deutsche Grammophon Gesellschaft aus den 1960er Jahren. In den Ecksätzen ist er mit jeweils beinahe zwölf Minuten deutlich langsamer unterwegs. Man könnte nicht behaupten, der pechschwarze Kopfsatz würde dadurch entstellt – im Gegenteil, überzeugender hat man das selten vernommen. Im darauffolgenden Allegro ist Elder mit gut fünf Minuten zeitlich nur unwesentlich hinter Karajan, dem Satzcharakter durchaus gerecht werdend. Vermutet man dort zunächst eine gewisse Entspannung, zieht die Dramatik bald wieder spürbar an. Der langsame Satz, mit Il tempo largo umschrieben, ist über weite Strecken ein Ruhepol und mit annähernd 13 Minuten Spielzeit völlig im Rahmen. Insgesamt scheint Elder mehr dem spätromantischen Tonfall verpflichtet, verzichtet er doch auf ein allzu grelles Ausreizen der Modernität, welche diesem Werk innewohnt (so beispielhaft in Roschdestwenskis Einspielung für Melodija). Nie war Sibelius seinem Altersgenossen Mahler ähnlicher als in der Vierten – ein eher fruchtloses Treffen der beiden Komponisten, die sich zwar respektieren, aber nicht wirklich verstanden, ein paar Jahre zuvor, 1907, mag dann doch einen Eindruck hinterlassen haben. Freilich dürfte auch Sibelius‘ zeitweise ernstlich angeschlagene Gesundheit in diese Sinfonie eingeflossen sein. Im Finalsatz, abermals ein Allegro, setzt sich unerwartet doch ein zuversichtlicherer Gestus durch, über dem freilich eine latente Bedrohung bestehen bleibt; die Coda klingt neuerlich pessimistisch und seltsam ungewiss aus. Indem Elder in diesem Finale das Tempo, verglichen mit anderen Dirigenten, deutlich zurücknimmt, erzielt er ein völlig neues Hörerlebnis.
Die Sechste von 1922/23 präsentiert sich ungleich freundlicher. Als einzige unter Sibelius‘ Sinfonien steht sie in keiner konkreten Tonart, sondern ist größtenteils im dorischen Modus komponiert. Den Tonschöpfer selbst erinnerte sein Werk „an den Duft des ersten Schnees“ und „reinstes Quellwasser“. Tatsächlich ist die „Cinderella der sieben Sinfonien“, wie sie der Musikwissenschaftler Gerald Abraham treffend nannte, eine sehr lyrische, unheroische, fast zarte Komposition, was häufig fälschlich mit Leichtgewichtigkeit gleichgesetzt wird. Interessanterweise gleichen sich Elders und Karajans Spielzeiten (DG) hier nahezu (8:53 – 6.00 – 3:45 – 10:03). Dies gilt auch für die wirklich formidable Lesart, welche Paavo Berglund in seinen späten Jahren auf dem Eigenlabel des London Philharmonic Orchestra vorlegte. Auf die Sechste muss man sich einlassen können. Elders warme Interpretation trägt ihren Teil dazu bei dies zu ermöglichen und bietet den nötigen Kontrast zur dunklen Vierten. Es ist ein über weite Strecken optimistisches Werk, das sich gleichwohl jedem Anflug von Pathos entzieht. Obwohl klassisch viersätzig, ist die Musik doch ständig im Fluss – eine Entwicklung, die Sibelius in seiner einsätzigen Siebenten dann perfektionieren sollte.
Die klangliche Seite der 70-minütigen CD ist erfreulich ausgefallen: eher dunkel, bassstark und nicht zu spitz klingend. Wieder diente die bewährte Bridgewater Hall in Manchester als Aufnahmeort, an welchem die Einspielungen im August 2018 (Nr. 4) und im Jänner 2019 (Nr. 6) entstanden. Ein dreisprachiges Booklet (Deutsch, Englisch, Französisch) rundet die Sache erfreulich ab. So findet der Sibelius-Zyklus des Hallé einen gelungenen Abschluss, den man besonders wegen der Vierten haben sollte. Daniel Hauser
Es geht weiter, und zwar chronologisch, was den im Entstehen befindlichen Sibelius-Zyklus des jungen finnischen Dirigenten Santtu-Matias Rouvali, 34, anbelangt. Verantwortlich zeichnet das Label Alpha mit Sitz in Paris. Diesmal stehen die hochberühmte Sinfonie Nr. 2 sowie die recht selten eingespielte Suite König Christian II. im Mittelpunkt (Alpha 574). Binnen weniger Jahre avancierte Rouvali zu einem der angesagtesten Dirigenten der jungen Generation, übernahm 2017 die traditionsreichen Göteborger Symphoniker (mit denen dieser Zyklus bestritten wird) und wurde 2019 zum nächsten Chefdirigenten des Philharmonia Orchestra in London designiert, Amtsantritt 2021. Dass dies gute künstlerische Gründe hat, zeigte Rouvali spätestens mit seiner von der Kritik einhellig gelobten Einspielung des Sibelius-Erstlings (Alpha 440).
 Was hebt die Neuaufnahme der Zweiten aus der mittlerweile schier unüberschaubaren Masse hervor? Nun, zum Einen die wirklich sehr gute Klangtechnik, die voll auf der Höhe der Zeit ist. Eher dunkel timbriert, kommt sie dem Werkcharakter entgegen. Ein Blick auf die Spielzeiten zeigt, dass sich Rouvali lieber etwas mehr als zu wenig Zeit nimmt, ohne zu schleppen. Sie sind nahezu identisch mit Karajans erster Einspielung mit dem Philharmonia Orchestra: Zehn Minuten für den Kopfsatz, vierzehn und eine halbe für den langsamen zweiten Satz, sechs Minuten für das quirlige Scherzo und schließlich etwa fünfzehn für das monumentale Finale. Das allein ist freilich kein Qualitätskriterium, wie deutlich flottere (etwa Paul Paray) wie auch bedeutend getragenere Lesarten (gerade der späte Bernstein in Wien) zeigten. Und doch ist diese brandaktuelle Interpretation weit mehr als Mittelmaß. Der ab und an eher als Präludium zu Größerem dargebotene Kopfsatz gerät bei Rouvali nicht zum etwas banalen Auftakt, sondern hat Gewicht. Heimlicher Höhepunkt das stellenweise wirklich sehr tiefschürfende getragene Andante, wo die gewaltige Dynamik der Aufnahme ihre Überlegenheit demonstrieren kann. Der Spannungsbogen im intermezzohaften Vivacissimo steigert der Dirigent gekonnt bis zum schlussendlichen Durchbruch, wo dann allerdings erst pessimistische Töne dominieren. Es ist bei Rouvali ein hartes, keineswegs von Anfang an entschiedenes Ringen zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Unterdrückung und Freiheit. Dass die Finnen dieses Stück als eine Art musikalische Unabhängigkeitserklärung an den Zaren begriffen (das Land war noch bis 1917 nordwestlichster Part des Russischen Kaiserreiches), darauf wurde an anderer Stelle bereits verwiesen. Gleichwohl waren es wohl doch primär private denn politische Umstände, die diese Komposition tatsächlich beeinflussten. In der überwältigenden Coda können die Göteborger Symphoniker nochmal ihre ganze Klasse im nordischen Repertoire ausspielen. Rouvali vermeidet, dass es allzu einseitig erstrahlt, woran die tiefen Bässe und die grummelnden Pauken ihren Anteil haben, alles schon ausbalanciert und durchhörbar, keine Extreme. Dies geht dann allerdings ein klein wenig auf Kosten der intensiven, geradezu unerbittlichen Gluthitze und Rauschhaftigkeit, die ein Barbirolli oder Szell zu entfachen imstande waren, indem sie die Blechbläser zuletzt ganz ungehemmt wild herausfahren ließen. Vielleicht aber klingt Rouvalis Sibelius auch schlichtweg richtig finnisch, denn man fühlt sich etwas an Osmo Vänskäs Wiedergabe mit der Sinfonia Lahti (BIS) erinnert, die in die monumentale Sibelius-Edition (68 CDs, über 80 Stunden Spielzeit) aufgenommen wurde.
Was hebt die Neuaufnahme der Zweiten aus der mittlerweile schier unüberschaubaren Masse hervor? Nun, zum Einen die wirklich sehr gute Klangtechnik, die voll auf der Höhe der Zeit ist. Eher dunkel timbriert, kommt sie dem Werkcharakter entgegen. Ein Blick auf die Spielzeiten zeigt, dass sich Rouvali lieber etwas mehr als zu wenig Zeit nimmt, ohne zu schleppen. Sie sind nahezu identisch mit Karajans erster Einspielung mit dem Philharmonia Orchestra: Zehn Minuten für den Kopfsatz, vierzehn und eine halbe für den langsamen zweiten Satz, sechs Minuten für das quirlige Scherzo und schließlich etwa fünfzehn für das monumentale Finale. Das allein ist freilich kein Qualitätskriterium, wie deutlich flottere (etwa Paul Paray) wie auch bedeutend getragenere Lesarten (gerade der späte Bernstein in Wien) zeigten. Und doch ist diese brandaktuelle Interpretation weit mehr als Mittelmaß. Der ab und an eher als Präludium zu Größerem dargebotene Kopfsatz gerät bei Rouvali nicht zum etwas banalen Auftakt, sondern hat Gewicht. Heimlicher Höhepunkt das stellenweise wirklich sehr tiefschürfende getragene Andante, wo die gewaltige Dynamik der Aufnahme ihre Überlegenheit demonstrieren kann. Der Spannungsbogen im intermezzohaften Vivacissimo steigert der Dirigent gekonnt bis zum schlussendlichen Durchbruch, wo dann allerdings erst pessimistische Töne dominieren. Es ist bei Rouvali ein hartes, keineswegs von Anfang an entschiedenes Ringen zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Unterdrückung und Freiheit. Dass die Finnen dieses Stück als eine Art musikalische Unabhängigkeitserklärung an den Zaren begriffen (das Land war noch bis 1917 nordwestlichster Part des Russischen Kaiserreiches), darauf wurde an anderer Stelle bereits verwiesen. Gleichwohl waren es wohl doch primär private denn politische Umstände, die diese Komposition tatsächlich beeinflussten. In der überwältigenden Coda können die Göteborger Symphoniker nochmal ihre ganze Klasse im nordischen Repertoire ausspielen. Rouvali vermeidet, dass es allzu einseitig erstrahlt, woran die tiefen Bässe und die grummelnden Pauken ihren Anteil haben, alles schon ausbalanciert und durchhörbar, keine Extreme. Dies geht dann allerdings ein klein wenig auf Kosten der intensiven, geradezu unerbittlichen Gluthitze und Rauschhaftigkeit, die ein Barbirolli oder Szell zu entfachen imstande waren, indem sie die Blechbläser zuletzt ganz ungehemmt wild herausfahren ließen. Vielleicht aber klingt Rouvalis Sibelius auch schlichtweg richtig finnisch, denn man fühlt sich etwas an Osmo Vänskäs Wiedergabe mit der Sinfonia Lahti (BIS) erinnert, die in die monumentale Sibelius-Edition (68 CDs, über 80 Stunden Spielzeit) aufgenommen wurde.
Die fünfsätzige, etwa 25-minütige König Christian II.-Suite ist mehr als eine bloße Zugabe. Zeitlich ist sie etwas vor der zweiten Sinfonie zu verorten, steht also im selben Spannungsverhältnis zu den als Besatzern empfundenen Russen im Lande. Das Beiheft misst der Elegie, in der Suite an zweiter Stelle, die größte Bedeutung bei; einst fungierte sie als Ouvertüre der kompletten Schauspielmusik. Interessant ist im Grunde gerade die Hintergrundgeschichte, handelt sie doch vom letzten König der sogenannten Kalmarer Union, also der unter einem Herrscher vereinigten drei nordischen Reiche Dänemark, Norwegen und Schweden (damals noch inklusive Finnland), freilich unter allzu starker dänischer Vorherrschaft, welche die Schweden in den offenen Aufstand trieb und am Ende auch die mit großen Mühen erfochtene Erlangung ihrer Unabhängigkeit zur Folge hatte. Christian II. selbst endete tragisch, verlor nicht nur Schweden, sondern wenig später auch die Krone und die Freiheit, Jahrzehnte lang in Haft dahin vegetierend. Dies vielleicht auch als warnendes Beispiel für den Zaren gedacht. Rouvali holt das Beste aus dieser Musik heraus, die eben doch nicht ganz die einmalige Klasse der Sinfonie Nr. 2 aufweisen kann.
Summa summarum geht es also geglückt weiter. Die Spuren dieses Zyklus wird man nach menschlichem Ermessen gespannt weiterverfolgen können. Demnächst im heimischen Wiener Theater. Daniel Hauser
Mit einer neuen Gesamtaufnahme der Sinfonien von Jean Sibelius fielen die Berliner Philharmoniker im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Rahmen. 2015 wurde der 150. Geburtstag des finnischen Komponisten begangen. Sibelius wurde am 8. Dezember 1865 in Hämeenlinna geboren. Die Neuerscheinung als Eigenlabel der Philharmoniker ist dem Ereignis allein durch die Präsentation angemessen (BPHR150071). Es braucht aber ein Regal mit mindestens fünfundzwanzig Zentimetern Tiefe, um die Box im Querformat neben anderen Alben angemessen unterbringen zu können. Die äußere Gestaltung ist nicht die einzige Besonderheit. Für die sieben Sinfonien sind vier herkömmliche CDs reserviert. Alternativ werden die Werke noch als höchstaufgelöste Audio-Blu-ray sowie im Bildformat als Concert Videos angeboten. Beide können in Blu-ray-Playern abgespielt und am TV-Schirm gesteuert werden. Es empfehlen sich allerdings zusätzliche gute Lautsprecher, weil bei Wiedergabe über die Fernsehlautsprecher die Möglichkeiten nicht annähernd ausgeschöpft werden können.

Mit dieser Produktion kommt die digitale Realität für relativ wenig Geld in die privaten Haushalte. Ob diese Form der Datenträger zukunftsfähig oder wieder nur eine Zwischenlösung ist, muss sich zeigen. Irritierend ist bei allem Respekt die voluminöse Verpackung. Ich stelle mir das neue Zeitalter eigentlich kleiner, portabler und auch platzsparender vor. Mit so einem Kasten lässt sich nicht auf Reisen gehen. Andererseits sollen wir uns ja in unseren vier Wänden auf Musik einlassen, in aller Ruhe und Konzentration, bei einem Glas Weines tief in ein bequemes Fauteuil versenkt. Sibelius gibt das her. Er ist nichts für nebenbei, egal, wer am Pult welchen Orchesters steht. Die Berliner Philharmoniker werden von ihren Chef Simon Rattle geleitet, der die Sinfonien zum Jubiläum auch vor Publikum aufführte. Besucher können ihre Live-Eindrücke überprüfen. Wer nicht selbst dabei war, ist es nun wenigstens am Bildschirm. Rattle hat sich immer mit Sibelius beschäftigt. Als er 2002 nach Berlin kam, brachte er bereits eine Gesamtaufnahme mit, die er für die EMI mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra eingespielt hatte. Sie war 1991 veröffentlicht worden und ist – jetzt bei Warner – auch noch zu haben. Rattle ist zwischen 1980 und 1998 Chef dieses Klangkörpers gewesen. Im Vergleich schneidet die neue Aufnahme um Längen besser ab. Nicht so sehr in der Deutung dieser Musik als in der raffinierten technischen Ausführung. Die ist unschlagbar. Sibelius ist – wenn man so will – ein ideales Medium für akustische Herausforderungen. Er wurde bereits für Schelllackplatten produziert und trat seinen Siegeszug um die Welt noch in Mono an. Es ist nicht das Geringste dagegen einzuwenden, wenn die raffinierten Klangstrukturen seiner Sinfonik mit ebenso raffinierten Verfahren auf Tonträger transformiert werden und unter die Leute gebracht werden.
Rattle hat dafür das richtige Gespür. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als er in Berlin antrat – unkonventionell, jung, der klassischen Musik in sehr klassischen Konzerten ein ganz neues Gesicht gab. Er scherte sich nicht um die mächtigen Vorbilder, die auch wie dunkle Schatten auf dem Berliner Konzertbetrieb lasteten. Sein Sibelius ist nicht vergrübet. Das Blech klingt nicht „schmutzig“, sondern hell und glasklar. Unter dem Eindruck dieses Dirigenten möchte ich nicht verzichten wollen auf Barbirolli oder Ormandy. Rattle will ja auch mit der Vergangenheit nicht brechen, was auch gar nicht gehen würde, schon gar nicht mit diesem traditionsreichen Orchester, vor dem schon der Komponist höchst selbst bei der triumphalen deutschen Premiere seiner 2. Sinfonie am 12. Januar 1905 stand. In der Edition wird auf dieses bemerkenswerte Datum ausdrücklich verwiesen. Rattle will Sibelius in der Gegenwart platzieren holen – mit allen Mitteln, die dafür auch technisch zur Verfügung stehen. Das ist sein Verdienst wie es auch durch diese bemerkenswerte Neuerscheinung, der eine große Verbreitung zu wünschen ist, zum Ausdruck kommt.
Genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie die zweite Sinfonie von Sibelius in meine Hände gelangte. Dafür ist es zu lange her. Es war wohl eine ehr beiläufige Anschaffung. Vielleicht auch eine Empfehlung. Ich schleppte die Schallplatte nach Hause, legte sie auf und war von dieser Musik auf Anhieb hingerissen. Das Gewandhausorchester Leipzig spielte unter der Leitung von Carl von Garaguly. Es mag aufregendere Interpretationen geben – von Roshdestwenski etwa, Barbirolli, Maazel, Bernstein oder Berglund. Die Auswahl ist enorm. Kaum ein anderes Werk von Sibelius ist so oft eingespielt worden wie dieses. Noch immer wächst der Katalog. Zumal um das Jubiläum herum. Sibelius ist eher noch im Kommen, als dass er in Vergessenheit geriete. Der Philosoph Theodor W. Adorno sollte nicht Recht behalten, als er Sibelius in mehreren Schriften als rückwärtsgewandt schmähte, gegen Mahler und Schoenberg ausspielte und ihn auf das Niveaus eines Amateurs herabsetze. Adorno hasste an Sibelius, wofür dieser vom Publikum geliebt wurde. Wobei diese Liebe und Verehrung oft auch missverständlich ist. Den Finnen auf grandiosen Naturschilderungen festnageln zu wollen, halte ich für einen Irrtum. Er lässt sich davon zwar inspirieren, aber seine Werke sind meist seelische Bekenntnisse. Depressiv, dunkel, eine Musik am Abgrund, eine Musik, die nicht wärmt. Es kommt mir so vor, als scheine durch die Töne immer nur die Mitternachtssonne. Sibelius war im Grunde ein unglücklicher, zerrissener Mensch, der alle Tiefen durchschritt, die das Leben bereithält. Er komponierte keine Alpensinfonie wie sein Zeitgenosse Richard Strauss.
 Decca hat ihr Archiv durchsucht. Fundstücke wurden in eine Edition mit elf CDs gepackt: Sibelius Great Performances (478 8598). Der Titel stimmt immer. So viele Aufnahmen es auch gibt, völlig daneben liegt keine. Im Gegenteil. In der Menge drückt sich die Vielfalt aus. Decca hat sich für die Gesamtaufnahme der sieben Sinfonien mit dem London Symphony Orchestra unter Anthony Collins entschieden. Es ist die zweite Gesamtaufnahme aus den Kindertagen der Langspielplatte, aufgenommen Anfang der 1950er Jahre. Erstmals hatte Sixten Ehrling die Sinfonien in Stockholm eingespielt. Collins, der sich als Komponist von Filmmusik einen Namen machte, bemüht sich um eine sehr genaue und exakte Wiedergabe, die in heutigen Ohren mitunter etwas trocken und spannungsarm klingt. Als historisches Ereignis ist sie aber unbestritten. Collins gilt als ein Wegbereiter von Sibelius, zumal er auch mit sinfonischen Stücken bekanntmachte, die bis dahin weitgehend unbekannt waren.
Decca hat ihr Archiv durchsucht. Fundstücke wurden in eine Edition mit elf CDs gepackt: Sibelius Great Performances (478 8598). Der Titel stimmt immer. So viele Aufnahmen es auch gibt, völlig daneben liegt keine. Im Gegenteil. In der Menge drückt sich die Vielfalt aus. Decca hat sich für die Gesamtaufnahme der sieben Sinfonien mit dem London Symphony Orchestra unter Anthony Collins entschieden. Es ist die zweite Gesamtaufnahme aus den Kindertagen der Langspielplatte, aufgenommen Anfang der 1950er Jahre. Erstmals hatte Sixten Ehrling die Sinfonien in Stockholm eingespielt. Collins, der sich als Komponist von Filmmusik einen Namen machte, bemüht sich um eine sehr genaue und exakte Wiedergabe, die in heutigen Ohren mitunter etwas trocken und spannungsarm klingt. Als historisches Ereignis ist sie aber unbestritten. Collins gilt als ein Wegbereiter von Sibelius, zumal er auch mit sinfonischen Stücken bekanntmachte, die bis dahin weitgehend unbekannt waren.
Zweimal – und das aus meiner Sicht völlig zu Recht – ist in der Edition die 2. Sinfonie vertreten. Neben Collins nimmt sich Pierre Monteux des Werkes an. Finlandia findet sich gar viermal. Beide Stücke – die Sinfonie und die sinfonische Dichtung – sind am populärsten geworden. Während sich Hans Rosbaud mit den Berliner Philharmonikern bei Finlandia um Schönklang bemüht (1955), schlägt Charles Mackerras am Pult des London Proms Symphony Orchestra (1958) herbe Töne an (1958). Erik Tuxen mit dem Dänischen Rundfunkorchester (1954) und Eduard van Beinum am Pult des Concertgebouw Orchestra (1957) liegen irgendwo dazwischen (1954). Nähe zu Tschaikowski, die Sibelius oft angekreidet wurde, ist nicht zu überhören. Das Werk ist auch deshalb interessant, weil es politische Positionen von Sibelius erkennen lässt. Seine Entstehungsgeschichte ist eng verknüpft mit den Bestrebungen der Finnen, innerhalb des russischen Reiches, zu dem sie seit 1809 gehörten, mehr nationale Eigenständigkeit zu gewinnen. Sibelius war Teil dieser Bewegung. 1899 gelangte in Helsingfors – das ist die schwedische Form von Helsinki – ein neues Werk zur Aufführung, das aus einer Ouvertüre und sechs Orchesterstücken bestand, zu denen Szenen aus dem finnischen Leben dargestellt wurden. Die Form war etwas störrisch, doch ungewöhnlich. Aus dem sechsten Tableau ging in überarbeiteter Form Finlandia hervor. Die übrigen Teile haben gekürzt als Scènes Historiques Eingang ins Gesamtwerk gefunden. Sibelius soll sich zunächst dagegen gewehrt haben, Finlandia einen Text unterzulegen. Er ließ sich aber umstimmen. Anlass dafür war 1939 der Überfall der Sowjetunion auf Finnland. Dieser Krieg endete der mit der Einverleibung finnischer Gebiete, darunter Teile Kareliens. In einer besonderen Fassung ist dem hymnischen Teil Musik ein Gedicht des Finnen Veikko Antero Koskenniemi untergelegt. Hier eine Übersetzung ins Deutsche:
 O Finnland, sieh, nun endlich will es tagen, / die Nacht vergeht, ist sie auch schwarz und lang. / Hör, wie die Lerche, die noch schluchzt in Klagen, / bald alle Himmel füllt mit dem Gesang. / Und alle werden frei zu atmen wagen. / Dein Morgen naht, geliebtes Vaterland! / Finnland, erhebe dich aus dunkler Stunde, / den neuen Tag begrüß‘ offen und frei./ Die alte Kraft, von der wir haben Kunde, / zerbreche auch die jüngste Sklaverei. / Kein Herr schlug je dir tödlich eine Wunde. / Dein Tag bricht an, geliebtes Vaterland.
O Finnland, sieh, nun endlich will es tagen, / die Nacht vergeht, ist sie auch schwarz und lang. / Hör, wie die Lerche, die noch schluchzt in Klagen, / bald alle Himmel füllt mit dem Gesang. / Und alle werden frei zu atmen wagen. / Dein Morgen naht, geliebtes Vaterland! / Finnland, erhebe dich aus dunkler Stunde, / den neuen Tag begrüß‘ offen und frei./ Die alte Kraft, von der wir haben Kunde, / zerbreche auch die jüngste Sklaverei. / Kein Herr schlug je dir tödlich eine Wunde. / Dein Tag bricht an, geliebtes Vaterland.
Leopold Stokowski soll dafür geworben haben, diesen Gesang zur Nationalhymne aller Länder zu küren. Ein Gedanke, der mir so faszinierend wie naiv erscheint. Schließich brauchte ja nur „Finnland“, das in dem Vers zweimal vorkommt, durch das jeweilige andere Land ersetzt zu werden. Lediglich Biafra, das sich in den 1960er Jahren kurzzeitig von Nigeria abspaltete und keine internationale Anerkennung fand, folgte dieser Idee. Decca entschied sich in der Box für die am weitesten verbreitete Orchesterfassung.
Mehr als hundert Lieder hat Sibelius komponiert, meist in schwedischer Sprache. Finnland gehörte bis Anfang des 19. Jahrhunderts zu Schweden. Schwedisch ist noch heute eine der offiziellen Landessprachen. Oft eingespielt, haben sich die Lieder – ähnlich den von vokalen Einsprengseln durchsetzten Theatermusiken – im Konzertbetrieb nie durchgesetzt. Obwohl deutsche Opernhäuser und Konzertagenten selbst vor Tschechisch und Russisch – oder dem, was sie dafür halten – nicht zurückschrecken, sind nordische Sprachen deutlich unterrepräsentiert. Kirsten Flagstad hatte Lieder von Sibelius ständig im Repertoire. Die Einspielung von vierzehn Titeln in der Orchesterfassung für Decca aus dem Jahr 1958 gehören zum eisernen Bestand dieses Labels und haben auch in der neuen Edition ihren Platz. Die Flagstad stand damals im Herbst ihrer Karriere. Noch einmal versammelt sie all ihre individuellen stimmlichen Mittel zu majestätischer Entfaltung. Die Aufnahmen glänzen wie altes Gold. Der Flagstad gelingt das Wunder, sprachliche Grenzen durch stimmliche Pracht zu überwinden, als seien es Vokalisen, Stimmungen, Farben, die sie vorträgt und keine in Musik gesetzten Texte. Höstkväll (Herbstabend) ist dafür ein treffendes Beispiel. Var det en dröm? (Was es ein Traum?) ebenfalls. „Bitte schön, hier mein schönstes Lied“, soll der Komponist gesagt haben, als er das Manuskript der Sängerin Ida Ekman übergab. Fällig ist eine Neuauflage der Lieder gewesen, die Birgit Nilsson mit einem Wiener Opernorchester unter Bertil Bokstedt 1965 für die Decca einspielte. Da es Überschneidungen mit dem Programm der Flagstad gibt, drängt sich ein Vergleich regelrecht auf. Ihre Stimme ist zwar intakter als die der älteren Kollegin. Mit deren Ausdruck und Beseeltheit kann sie es aber nicht aufnehmen.
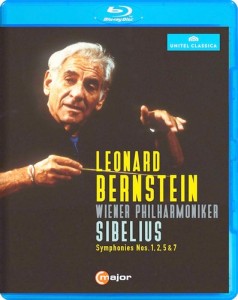 Eine Klasse für sich ist Sibelius mit Leonard Bernstein. In seinen späten Jahren hat er zwischen 1986 und 1990 Anlauf zu einer neuen Produktion der Sinfonien mit den Wiener Philharmonikern genommen. Es blieb bei den Sinfonien Nummer 1, 2, 5 und 7, mitgeschnitten im Konzert, bei C Major nun auch als Blu-ray (732404). Ton und Bild sind gleichermaßen wie gestochen. Sie lassen die Erinnerung an die kunterbunten verwaschenen Filme vergessen, die mal durch die Bezahlklassiksender geschoben wurden. Jetzt erst wird deutlich, wie sinnstiftend die Regie gearbeitet hat. Die Hinlenkung zu einzelnen Instrumenten oder ganzen Gruppen im rechten Moment legen dem Zuschauer die Struktur der Sinfonien offen. So schön und lehrreich zugleich kann Musik am Bildschirm sein! Bernstein ist mitten hineingestellt. Er berauscht die Musiker, das Publikum und sich selbst. Sein Sibelius ist ganz ungezügelte Hingabe und Leidenschaft. Dafür wurde er geliebt. Doch Vorsicht! Vier Sinfonien hintereinander sind nicht zu schaffen. Zu groß ist die emotionale Wucht, die Bernstein niederprasseln lässt. Es empfiehlt sich, sich die Werke einzeln vorzunehmen.
Eine Klasse für sich ist Sibelius mit Leonard Bernstein. In seinen späten Jahren hat er zwischen 1986 und 1990 Anlauf zu einer neuen Produktion der Sinfonien mit den Wiener Philharmonikern genommen. Es blieb bei den Sinfonien Nummer 1, 2, 5 und 7, mitgeschnitten im Konzert, bei C Major nun auch als Blu-ray (732404). Ton und Bild sind gleichermaßen wie gestochen. Sie lassen die Erinnerung an die kunterbunten verwaschenen Filme vergessen, die mal durch die Bezahlklassiksender geschoben wurden. Jetzt erst wird deutlich, wie sinnstiftend die Regie gearbeitet hat. Die Hinlenkung zu einzelnen Instrumenten oder ganzen Gruppen im rechten Moment legen dem Zuschauer die Struktur der Sinfonien offen. So schön und lehrreich zugleich kann Musik am Bildschirm sein! Bernstein ist mitten hineingestellt. Er berauscht die Musiker, das Publikum und sich selbst. Sein Sibelius ist ganz ungezügelte Hingabe und Leidenschaft. Dafür wurde er geliebt. Doch Vorsicht! Vier Sinfonien hintereinander sind nicht zu schaffen. Zu groß ist die emotionale Wucht, die Bernstein niederprasseln lässt. Es empfiehlt sich, sich die Werke einzeln vorzunehmen.
 Ein Dirigent unserer Tage hat sich in der Sibelius-Rezeption allein dadurch verdient gemacht, dass er den Blick auf das Gesamtwerk neu schärft – der charismatische Finne Leif Segerstam, der auch 285 Sinfonien komponiert hat. In seinen neuen Einspielungen mit dem Turku Philharmonic Orchestra für Naxos widmet er sich den Theatermusiken. Sie gehören für mich zu den spektakulärsten Ereignissen im Gedenkjahr. Diese farbigen, facettenreichen und kräftigen Kompositionen offenbaren ein starkes dramatisches Talent. In seiner vorzüglichen Biographie (eine Besprechung weiter unter) vertritt Volker Tarnow die Auffassung, Sibelius hätte „der größte Opernkomponist Skandinaviens“ werden können. In Bayreuth und München hörte er noch im zu Ende gehenden 19. Jahrhundert Wagners Parsifal und fühlte sich für das eigene Schaffen beflügelt. Pläne gab es reichlich. Am Ende lief es auf den kurzen Einakter Die Jungfrau im Turm hinaus, 1896 in Helsinki uraufgeführt und seither zu einem Schattendasein verurteilt. Wenngleich in einzelnen Szenen von betörender Schönheit, fehlt der Zusammenhalt. Die kurze Oper zerfällt in aufwühlende Einzelteile und dürfte auf dem Konzertpodium größere Chancen haben als auf einer Bühne.
Ein Dirigent unserer Tage hat sich in der Sibelius-Rezeption allein dadurch verdient gemacht, dass er den Blick auf das Gesamtwerk neu schärft – der charismatische Finne Leif Segerstam, der auch 285 Sinfonien komponiert hat. In seinen neuen Einspielungen mit dem Turku Philharmonic Orchestra für Naxos widmet er sich den Theatermusiken. Sie gehören für mich zu den spektakulärsten Ereignissen im Gedenkjahr. Diese farbigen, facettenreichen und kräftigen Kompositionen offenbaren ein starkes dramatisches Talent. In seiner vorzüglichen Biographie (eine Besprechung weiter unter) vertritt Volker Tarnow die Auffassung, Sibelius hätte „der größte Opernkomponist Skandinaviens“ werden können. In Bayreuth und München hörte er noch im zu Ende gehenden 19. Jahrhundert Wagners Parsifal und fühlte sich für das eigene Schaffen beflügelt. Pläne gab es reichlich. Am Ende lief es auf den kurzen Einakter Die Jungfrau im Turm hinaus, 1896 in Helsinki uraufgeführt und seither zu einem Schattendasein verurteilt. Wenngleich in einzelnen Szenen von betörender Schönheit, fehlt der Zusammenhalt. Die kurze Oper zerfällt in aufwühlende Einzelteile und dürfte auf dem Konzertpodium größere Chancen haben als auf einer Bühne.
 Inzwischen sind bei Naxos fünf CDs erschienen, darunter die komplette Bühnenmusik zum Schauspiel Pelléas et Mélisande von Maurice Maeterlinck (8.573301), welches Debussy als Vorlage für seine gleichnamige Oper diente. Im Gegensatz zu diesem ist Sibelius direkter, einschmeichelnder in der musikalischen Erfindung, weniger geheimnisvoll und entrückt. Als Reaktion des schwedischen Schriftstellers August Strindberg auf Materlincks Symbolismus gilt sein Bühnenstück Svanevit (Schwanenweiß). Die Musik dazu wird von einem Hornsignal eingeleitet, das mit seinen zehn Sekunden als eigenständiger Teil ausgewiesen ist. Ein unglaublicher Einfall! (8.573341). Zudem hat sich Segerstam die Bühnenmusik zu Jedermann vorgenommen (8.573340). Das Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal war auch ins Finnische übersetzt worden. Sibelius, der viele Male in Deutschland und Österreich weilte, dürfte es schon im Original gekannt haben. Die Musik hebt gewaltig an, als würde zum letzten Gericht geblasen und verdichtet sich in der Mitte zu einem erschütternden Largo, aus dem ich schon die Metamorphosen von Strauss heraushöre, obwohl diese erst dreißig Jahre später entstanden sind.
Inzwischen sind bei Naxos fünf CDs erschienen, darunter die komplette Bühnenmusik zum Schauspiel Pelléas et Mélisande von Maurice Maeterlinck (8.573301), welches Debussy als Vorlage für seine gleichnamige Oper diente. Im Gegensatz zu diesem ist Sibelius direkter, einschmeichelnder in der musikalischen Erfindung, weniger geheimnisvoll und entrückt. Als Reaktion des schwedischen Schriftstellers August Strindberg auf Materlincks Symbolismus gilt sein Bühnenstück Svanevit (Schwanenweiß). Die Musik dazu wird von einem Hornsignal eingeleitet, das mit seinen zehn Sekunden als eigenständiger Teil ausgewiesen ist. Ein unglaublicher Einfall! (8.573341). Zudem hat sich Segerstam die Bühnenmusik zu Jedermann vorgenommen (8.573340). Das Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal war auch ins Finnische übersetzt worden. Sibelius, der viele Male in Deutschland und Österreich weilte, dürfte es schon im Original gekannt haben. Die Musik hebt gewaltig an, als würde zum letzten Gericht geblasen und verdichtet sich in der Mitte zu einem erschütternden Largo, aus dem ich schon die Metamorphosen von Strauss heraushöre, obwohl diese erst dreißig Jahre später entstanden sind.
 Kuolema (Der Tod) und Kung Kristian II (König Christian II.) füllen die nächste CD (8.573299). Kuolema untermalt das Schauspiel des Finnen Arvid Järnefelt, Kung Kristian ein Theaterstück von Adolf Paul, der Schwede war, sich die meiste Zeit seines Lebens aber in Berlin aufhielt. Er war mit Sibelius, August Strindberg und Edvard Munch eng befreundet. Solche Beziehungen und Lebensstationen ragen in viele Werke von Sibelius hinein. Kristian (1481-1559) war König von Dänemark und Schweden. Finnland war zu seiner Zeit Teil Schwedens. Bis heute beruht das große Ansehen dieses Königs darauf, dass er sich auf die Seite der im Aufblühen begriffenen Städte und der Kaufleute, die daran großen Anteil hatten, stellte und die Macht des Adels zurückdrängte. Inhalt des Stückes sind weniger die politischen Verhältnisse als die Beziehung von Kristian zu seiner Geliebten Dyveke Sigbritsdatter, der unheilvolle Einflüsse auf den König nachgesagt wurden und die offenbar einem Giftmord zum Opfer fiel. Von großer Sympathie für Dyveke, deren Schicksal in der nordischen Kunst oft thematisiert wurde, scheint die Musik getragen. Andererseits wirkt sie aber auch aus sich heraus, ohne dass es genauer Kenntnisse der historischen Hintergründe bedarf. Eine knappe Suite aus der Schauspielmusik hatte sich schon zu Lebzeiten von Sibelius durchgesetzt. Er dirigierte sie oft selbst. In der Decca-Sammlung wird sie von Alexander Gibson mit dem London Symphony Orchestra gespielt.
Kuolema (Der Tod) und Kung Kristian II (König Christian II.) füllen die nächste CD (8.573299). Kuolema untermalt das Schauspiel des Finnen Arvid Järnefelt, Kung Kristian ein Theaterstück von Adolf Paul, der Schwede war, sich die meiste Zeit seines Lebens aber in Berlin aufhielt. Er war mit Sibelius, August Strindberg und Edvard Munch eng befreundet. Solche Beziehungen und Lebensstationen ragen in viele Werke von Sibelius hinein. Kristian (1481-1559) war König von Dänemark und Schweden. Finnland war zu seiner Zeit Teil Schwedens. Bis heute beruht das große Ansehen dieses Königs darauf, dass er sich auf die Seite der im Aufblühen begriffenen Städte und der Kaufleute, die daran großen Anteil hatten, stellte und die Macht des Adels zurückdrängte. Inhalt des Stückes sind weniger die politischen Verhältnisse als die Beziehung von Kristian zu seiner Geliebten Dyveke Sigbritsdatter, der unheilvolle Einflüsse auf den König nachgesagt wurden und die offenbar einem Giftmord zum Opfer fiel. Von großer Sympathie für Dyveke, deren Schicksal in der nordischen Kunst oft thematisiert wurde, scheint die Musik getragen. Andererseits wirkt sie aber auch aus sich heraus, ohne dass es genauer Kenntnisse der historischen Hintergründe bedarf. Eine knappe Suite aus der Schauspielmusik hatte sich schon zu Lebzeiten von Sibelius durchgesetzt. Er dirigierte sie oft selbst. In der Decca-Sammlung wird sie von Alexander Gibson mit dem London Symphony Orchestra gespielt.
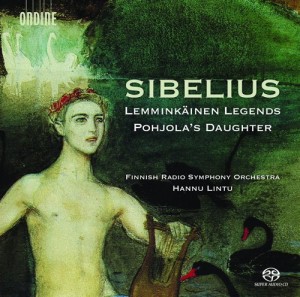 Bei Sibelius stellt sich hartnäckig die Frage nach den Quellen, aus denen sich viele seiner Werke speisen. Muss man die kennen? Bei Finlandia liegen die Dinge noch vergleichsweise einfach. Ist es aber unabdingbar, sich durch den Kosmos der fünfzig Gesänge des finnischen Nationalepos Kalevala zu arbeiten, um die Lemminkäinen-Legenden, die eines der zentralen Werke sind, zu verstehen? Von den einzelnen Fassungen gar nicht zu reden. Ondine hat sie in einer neuen Einspielung des Finnischen Rundfunkorchesters unter Hannu Lintu produziert (ODE 1262-5), gekoppelt mit Pohjola’s Tochter. Der Schwan von Tuonela – mal an zweiter, mal an dritter Stelle der Legenden positioniert – führt auch ein eigenständiges Leben in Konzerten und Einspielungen. Anklänge an die Vorspiele der jeweils dritten Aufzüge von Tristan und Meistersinger sind nicht zu überhören. Im Epos umkreist der heilige Schwan die Toteninsel Tuonela. Lintu, Jahrgang 1967 und gebürtiger Finne, dürfte mit dem mythischen Metaphern vertraut sein. Er zieht seine Hörer in diese dunklen Geschichten hinein und erspart ihnen nicht den Blick in Abgründe, die Sibelius so vertraut waren. Rau und gnadenlos raunt es aus dem Orchester. Lemminkäinens Abenteuer sind keine Strandspaziergänge. Nach Mord und Todschlag werden menschliche Körper zerteilt – und schließlich wieder zusammengesetzt.
Bei Sibelius stellt sich hartnäckig die Frage nach den Quellen, aus denen sich viele seiner Werke speisen. Muss man die kennen? Bei Finlandia liegen die Dinge noch vergleichsweise einfach. Ist es aber unabdingbar, sich durch den Kosmos der fünfzig Gesänge des finnischen Nationalepos Kalevala zu arbeiten, um die Lemminkäinen-Legenden, die eines der zentralen Werke sind, zu verstehen? Von den einzelnen Fassungen gar nicht zu reden. Ondine hat sie in einer neuen Einspielung des Finnischen Rundfunkorchesters unter Hannu Lintu produziert (ODE 1262-5), gekoppelt mit Pohjola’s Tochter. Der Schwan von Tuonela – mal an zweiter, mal an dritter Stelle der Legenden positioniert – führt auch ein eigenständiges Leben in Konzerten und Einspielungen. Anklänge an die Vorspiele der jeweils dritten Aufzüge von Tristan und Meistersinger sind nicht zu überhören. Im Epos umkreist der heilige Schwan die Toteninsel Tuonela. Lintu, Jahrgang 1967 und gebürtiger Finne, dürfte mit dem mythischen Metaphern vertraut sein. Er zieht seine Hörer in diese dunklen Geschichten hinein und erspart ihnen nicht den Blick in Abgründe, die Sibelius so vertraut waren. Rau und gnadenlos raunt es aus dem Orchester. Lemminkäinens Abenteuer sind keine Strandspaziergänge. Nach Mord und Todschlag werden menschliche Körper zerteilt – und schließlich wieder zusammengesetzt.
Wer sich auf den Weg zu Jean Sibelius macht, sein Werk genauer erkunden will, findet sich auf einer Bildungsreise wieder. Sie führt nicht nur in den Norden Europas sondern quer durch den Kontinent, den er selbst oft durchquerte. Er war das, was man einen Europäer nennt. Allein deshalb ist er auch im Jahr seines 150. Geburtstages so zeitgemäß. Rüdiger Winter
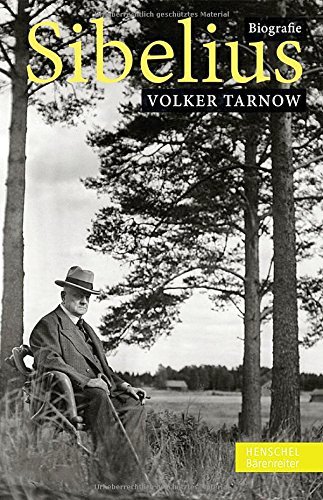 Ein hoch interessantes Buch, das sich untertreibend Biografie Sibelius nennt, hat Volker Tarnow im Henschelverlag herausgegeben – und das Versprechen, das es indirekt auf den ersten Seiten in leicht ironischem Tonfall gibt, nicht nur informierend, sondern auch unterhaltend zu sein, erfüllt es bis zur letzten Seite. Sein Sujet macht es dem Buch leicht, auch dem in puncto Musikgeschichte bereits Belesenen noch viel Neues zu bieten, kann dieses aus der Tatsache ziehen, dass man über die Geschichte Finnlands und seiner Komponisten, von denen außer Sibelius kaum einer bekannt ist, wenig weiß, obwohl sie einer der interessantesten ganz Europas ist im Hin- und Hergerissensein des Landes zwischen Russland/Sowjetunion und Deutschland oder Schweden, wozu noch kommt, dass die Oberschicht Schwedisch und die Unterschicht Finnisch sprach, eine Art Klassenkampf sich in der Benutzung der jeweiligen Sprache ausdrückte, der auch Individuen wie Sibelius innerlich spaltete. Im ersten Kapitel Das klassische Niemandsland geht der Autor zurück bis vor das Jahr 1792, vor dem der in Un Ballo in Maschera gemeuchelte Gustav III. im Geburtsort des Komponisten eine Kirche erbauen ließ, die wie ein Opernhaus aussieht. So ist dann im Verlauf des Werks auch von einigen Versuchen Sibelius‘ die Rede, eine Oper zu komponieren, wobei es nur zu einem Einakter, Die Jungfrau im Turm, kommt, dessen Libretto hochpolitischen Inhalt vermuten lässt.
Ein hoch interessantes Buch, das sich untertreibend Biografie Sibelius nennt, hat Volker Tarnow im Henschelverlag herausgegeben – und das Versprechen, das es indirekt auf den ersten Seiten in leicht ironischem Tonfall gibt, nicht nur informierend, sondern auch unterhaltend zu sein, erfüllt es bis zur letzten Seite. Sein Sujet macht es dem Buch leicht, auch dem in puncto Musikgeschichte bereits Belesenen noch viel Neues zu bieten, kann dieses aus der Tatsache ziehen, dass man über die Geschichte Finnlands und seiner Komponisten, von denen außer Sibelius kaum einer bekannt ist, wenig weiß, obwohl sie einer der interessantesten ganz Europas ist im Hin- und Hergerissensein des Landes zwischen Russland/Sowjetunion und Deutschland oder Schweden, wozu noch kommt, dass die Oberschicht Schwedisch und die Unterschicht Finnisch sprach, eine Art Klassenkampf sich in der Benutzung der jeweiligen Sprache ausdrückte, der auch Individuen wie Sibelius innerlich spaltete. Im ersten Kapitel Das klassische Niemandsland geht der Autor zurück bis vor das Jahr 1792, vor dem der in Un Ballo in Maschera gemeuchelte Gustav III. im Geburtsort des Komponisten eine Kirche erbauen ließ, die wie ein Opernhaus aussieht. So ist dann im Verlauf des Werks auch von einigen Versuchen Sibelius‘ die Rede, eine Oper zu komponieren, wobei es nur zu einem Einakter, Die Jungfrau im Turm, kommt, dessen Libretto hochpolitischen Inhalt vermuten lässt.
Sibelius komponierte im Verlauf seines stets von Krankheiten gezeichneten und trotzdem langen Lebens acht Sinfonien, der klassischen Wiener Schule verpflichtet und sich dem Einfluss Brahms‘ wie Wagners entziehend, von denen die letzte verloren ging, wohl von ihm selbst verbrannt wurde. Der Verfasser liefert, eingebettet in das chronologisch aufgebaute Buch, detaillierte Interpretationen derselben, auch die anderen, zu diversen Gelegenheiten komponierten Stücke, angefangen von den „Luftschlössern“ des Sechzehnjährigen, werden knapper charakterisiert. Der „Erneuerer der Sinfonie“ zu sein dürfte keine zu gewagte Aussage über Sibelius sein. Als grundsätzliche Frage stellt sich die, ob Sibelius den finnischen Nationalstil kreierte oder ob der finnische Nationalstil Sibelius beeinflusste.
Anekdotisches, wie die Übernahme des Vornamens Jean von den Visitenkarten des verstorbenen Onkels, steht neben der Auseinandersetzung um finnischen Symbolismus oder finnischen Jugendstil. Das Musikleben der Städte Berlin, Wien und Paris wie das der USA wird anschaulich aus der Sicht des Komponisten geschildert. Sibelius‘ Erstlingswerke, so Kullervo, werden mit denen zeitgenössischer Komponisten verglichen, der Einfluss der Runengesänge aus Karelien und des Epos‘ Kalevala untersucht. Ein Rückblick auf die Geschichte der Tonarten fehlt nicht, ebenso wenig wie ein Hinweis und eine Erklärung zum von Sibelius benutzten Orgelpunkt.
Nicht unterschlagen wird die Hemmungslosigkeit des Komponisten, was Alkohol- und Tabakkonsum betrifft, nur unterbrochen durch ein Krebsleiden, das Buhlen um eine russische Pension bei gleichzeitigem Komponieren „antirussischer“ Musik wie der Karelia-Suite. Die Gastspiele auf dem Weg zur Pariser Weltausstellung und in Paris selbst werden ebenso geschildert wie der Aufenthalt in Italien, die Mär vom patriotischen Gehalt der 2. Sinfonie als solche entlarvt, Sibelius als Dirigent, so der Berliner Philharmoniker, gewürdigt. Nicht nur die Sinfonien werden eingehend analysiert, auch das Violin-Konzert, durch Jascha Heifetz ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, und die Streichquartette sowie die Lieder, auch auf deutsche Texte, Bühnenmusiken, so zu Der Sturm und Jedermann werden vom Verfasser berücksichtigt. Von einer Eroberung Englands ist die Rede, von der Annäherung an die Atonalität in der 4. Sinfonie, vom heiklen Jägermarsch für die in Deutschland ausgebildeten, im finnischen Bürgerkrieg kämpfenden Finnen.
Wie andere skandinavische Künstler auch traf Sibelius seine Entscheidung für Weiß gegen Rot und für Deutschland gegen die SU. „Strikter Antikommunismus“ dient als Erklärung wie auch die doppelte Rolle, die Sibelius als „finnischer Patriot“ und als Mitglied des „schwedischsprachigen Bürgertums“ spielte. Sehr lustig ist die Bemerkung des Verfassers, dass „Sibelius-Hasser wieder einmal, leider nur nachträglich, den Faschismus besiegen“. Dieser Ton ist eine der angenehmen Seiten des Buches, aber nicht die einzige, die das Lesen von Anfang bis Ende ertragreich wie vergnüglich werden lassen. Ein Anhang aus Vita, Diskographie, Anmerkungen, Ortsnamenkonkordanz und Personenregister genügt wissenschaftlichen Ansprüchen. 288 Seiten, Henschel Verlag, ISBN 978-3-89487-941-9 Ingrid Wanja

Herzliches Einvernehmen am festlich gedeckten Teetisch: Die Sängerin Kirsten Flagstad zu Besuch bei Jean Sibelius in seinem Landhaus Ainola, das nach der Ehefrau des Komponisten, Aino, benannt ist. Es liegt etwa vierzig Kilometer von Helsinki entfernt und ist ein Museum. Wer sich näher informieren will über das Haus, den Hausherren, seinen Lebenslauf, sein Schaffen und die einzelnen Werke, braucht nur diesem Link zu folgen. – Das große Foto oben, das uns Norbert Baumbauer zur Verfügung stellte, zeigt in einem Ausschnitt das Sibelius-Denkmal in Helsinki. Es wurde 1967, zum zehnten Todestag des Komponisten, im Stadtteil Töölö enthüllt. Der Entwurf stammt von der finnischen Künstlerin Eila Hiltunen. R. W.










 Was hebt die Neuaufnahme der
Was hebt die Neuaufnahme der 


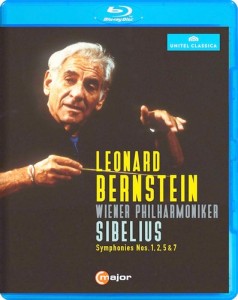



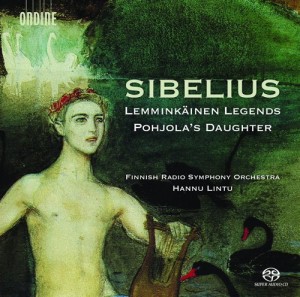
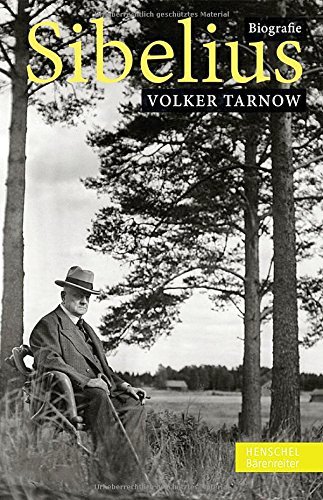













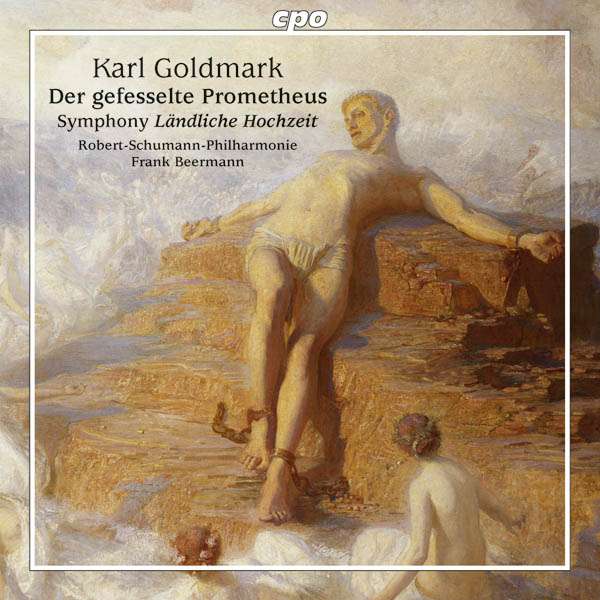





 Lehmanns Kunst trägt die Züge ihrer Zeit
Lehmanns Kunst trägt die Züge ihrer Zeit


 Im Jubiläumsjahr 2019 eine ganze CD mit Koloraturarien des Operettenerfinders
Im Jubiläumsjahr 2019 eine ganze CD mit Koloraturarien des Operettenerfinders  Da passt ein Album mit
Da passt ein Album mit 





 Streng genommen hatte das
Streng genommen hatte das