.
Eine meiner Lieblingsopern im Kanon der „post-napoleonischen“ Opern waren die Abencérages von Luigi Cherubini, 1813 an der Pariser Opéra mit Erfolg aufgeführt und so gut wie vergessen, bis Peter Maag eine originalsprachige konzertante Aufführung für die RAI Mailand 1975 organisierte, die als Generalprobe für eine leider nicht zustande gekommene Aufnahme bei Decca dienen sollte (Arts-Ausstattung mit mehrsprachigem Libretto, dto. Aufsätzen und bestem Radio-Sound).
Dennoch ein caveat. Mich beschlich beim erneuten Hören, auch der nachstehend neuen und endlich idiomatisch besetzten Aufnahme vom Palazetto doch eine gewisse Langeweile ab der Mitte der ersten CD. Liegt es am Konzertanten? Aber man findet auch Einschränkungen bei der alten RAI-Aufnahme, deren Französisch in Teilen wegen des Italienisch-spanischen Kontingents auch eingeschränkt zu nennen ist. Vielleicht liegt es aber auch an der Oper selbst, die nicht so zündend ist wie Cherubinis Médée oder die Lodoiska? Schwer zu sagen. Vielleicht entzieht sich dieser eher repräsentativ-statuarische Plot mit der entsprechend repräsentativ-statischen Musik unseren modernen Ohren eher als die action-story der Kindsmörderin mit ihrer vorwärtsjagenden Dynamik. Erneutes Hören und heiße Erwartung ist eben auch mit leichter Enttäuschung gekoppelt.
Mit der betörenden Margherita Rinaldi und den beiden (einzigen) Franzosen Jean Dupuy (schmelzend als Troubadour in der amputierten Ballettmusik) sowie Jacques Mars hervorragend besetzt (naja, der grobe Francisco Ortiz hätte an seinem Französisch arbeiten müssen) und mit wenigen Strichen hervorragend musikalisch wiedergegeben war es RAI-Aufnahme (zuerst Melodram, später bei Arts in bestem Stereo), die mich durch mein musikalisches Hören begleitete und mich immer wieder zu dieser Oper zurückkehren ließ.

Cherubinis „Abencerragi“ mit Anita Cerquetti/ Maggio Musicale Fiorentino Edizione
Natürlich hatte man die italienische, drastisch gekürzte Bastardfassung aus Florenz 1957 mit der hinreißenden Anita Cerquetti im Schrank (LP Cetra live und später nun in absolut erstaunlichem Sound vom Florentiner Theater direkt auf CD, worüber ich bereits bei operalounge jubelte). Und der geneigte Leser weiß, dass Anita Cerquetti eine der wenigen meiner Säulenheiligen ist. Über die ich nichts kommen lasse. Aber sie ist hier in der falschen Oper, wenngleich natürlich ihre stimmlichen Auftritte betörend cremig und reich an Pathos sind. Nur eben klingt die Oper durch die zeitgenössische Übersetzung eher wie von Cimarosa. Und der Tenor Louis Rooney ist kein Gewinn. Das Idiom ist ganz entscheidend bei diesen französischen Werken. Auch die übrige Besetzung (Mario Petri et al) mulmt so vor sich hin, wenngleich Carlo Maria Giulini einen flotten Drive einlegt und die ohnehin sich leicht versandende Musik vorantreibt. Nur wegen der Cerquetti konservierbar.
Und als Einzelarie für Tenor, „Suspendez à ces murs… J’ai vu disparaître“, kennt man ja die Aufnahmen von Roberto Alagna, Guy Chauvet, Georges Thill und anderen, die erstaunlicherweise diese noch im Repertoire haben/hatten.
.
 Aber man muss wieder einmal der italienische Rundfunkanstalt RAI und dem Maggio Musicale für ihre Entdeckungsfreude danken. Dort wurden in den Fünfzigern bis Siebzigern Opern von Cherubini, Spontini, Paer und anderen aufgeführt und die Hinterlassenschaft des bourbonischen Königshauses von Neapel (dem Bruder Napoleons) gewürdigt, das die bejubelten Opern aus Paris für die eigenen Entertainments am Hofe Neapels importierte. Es ist dieser Periode zu verdanken, dass sich die französischen Opern namentlich der napoleonischen Epoche dort gehalten haben. In italienischer Übersetzung zwar, aber dadurch gingen sie auch in das „normale“ italienische Opernrepertoire ein, das bis heute gepflegt wird. Die Nachkriegsepoche brachte für Italien dann wieder diese Fast-Entdeckungen, wie sie das Maggio Musicale vor allem präsentierte (Fernand Cortez oder eben auch Les Abencerages), die Scala folgte (Gluck/ Callas), andere Bühnen dann mit dem französischen Verdi und Donizetti (Gencer etc).
Aber man muss wieder einmal der italienische Rundfunkanstalt RAI und dem Maggio Musicale für ihre Entdeckungsfreude danken. Dort wurden in den Fünfzigern bis Siebzigern Opern von Cherubini, Spontini, Paer und anderen aufgeführt und die Hinterlassenschaft des bourbonischen Königshauses von Neapel (dem Bruder Napoleons) gewürdigt, das die bejubelten Opern aus Paris für die eigenen Entertainments am Hofe Neapels importierte. Es ist dieser Periode zu verdanken, dass sich die französischen Opern namentlich der napoleonischen Epoche dort gehalten haben. In italienischer Übersetzung zwar, aber dadurch gingen sie auch in das „normale“ italienische Opernrepertoire ein, das bis heute gepflegt wird. Die Nachkriegsepoche brachte für Italien dann wieder diese Fast-Entdeckungen, wie sie das Maggio Musicale vor allem präsentierte (Fernand Cortez oder eben auch Les Abencerages), die Scala folgte (Gluck/ Callas), andere Bühnen dann mit dem französischen Verdi und Donizetti (Gencer etc).
.
Nun also gibt es eine Neuaufnahme der Les Abencérages ou L’Étendard de Grenade in der originalen Dreiaktfdassung von 1813, aus Budapest 2021, die bereits als optischer Stream im Netz konzertant zu erleben war und in deren Umfeld die Aufnahme vom Palazzetto zustande kam (Co-production Palazzetto Bru Zane / Orfeo Music Foundation / Haydneum / MÜPA).
 Es gibt die komplette Ballettmusik (endlich und bei Neuaufnahmen eigentlich selbstverständlich) mit schöner Troubadour-Einlage, es gibt die Aufmärsche und großen Chöre. Dennoch beschleicht mich gelegentlich Langeweile. An den Sängern liegt es nicht. Die vokale Besetzung ist herragend, auch das exzellente Französisch. Als Noraime bezaubert Anais Constans mit leuchtenden Höhen und schönem, vollem Ton. Edgaras Montvidas ist ein bewährter Palazzetto-Tenor und macht viel aus dem Liebhaber Almanzor, könnte vielleicht etwas geschmeidiger und etwas stürmischer sein. Immerhin ist er der Liebhaber vom Dienst. Ganz kleine Ermüdungserscheinungen sind nicht zu überhören. Aber er ist in der Tat ein gestandener Held und überzeugender Verfechter seines (muslimischen Opern-)Glaubens. Artavazd Sargsyan gibt dem spanischen Krieger Gonzalve (dessen Großzügigkeit zum lieto fine führt) viel „christliche“ Kraft und doubliert mit Schmelz als Troubadour in der Balletteinlage. Mit Thomas Dolié, Tomislav Lavoie, Douglas Williams und Philippe-Nicolas Martin sind die fiesen Feinde Almanzors hervorragend besetzt. Lóránt Najbauer tritt erfreulich in kleineren Partien auf, begleitet von Adriána Kalafszky als regionale servante. György Vashegyi am Pult des Orfeo Orchestra und des etwas leidenschaftslosen Purcell Choir könnte mehr an nötigen Drive bei dieser Oper hinlegen, die von den beiden anderen Dirigenten-Kollegen mit mehr Elan, mehr Überzeugung voran getrieben wird. Aber die neue Palazzetto-Einspielung ist unbedingt habenswert auch wegen der wie stets luxuriösen Ausstattung mit zweisprachigen Libretto (wie stets kein Deutsch) und dto. Aufsätzen von Alexandre Dratwicki, Raúl González Arévalo und Jean Mongrédien. Mich begeisterte die selten gehörte Ballettmusik … Aber drei CDs können eine lange Strecke sein, man hört sie am besten in Portionen. G. H.
Es gibt die komplette Ballettmusik (endlich und bei Neuaufnahmen eigentlich selbstverständlich) mit schöner Troubadour-Einlage, es gibt die Aufmärsche und großen Chöre. Dennoch beschleicht mich gelegentlich Langeweile. An den Sängern liegt es nicht. Die vokale Besetzung ist herragend, auch das exzellente Französisch. Als Noraime bezaubert Anais Constans mit leuchtenden Höhen und schönem, vollem Ton. Edgaras Montvidas ist ein bewährter Palazzetto-Tenor und macht viel aus dem Liebhaber Almanzor, könnte vielleicht etwas geschmeidiger und etwas stürmischer sein. Immerhin ist er der Liebhaber vom Dienst. Ganz kleine Ermüdungserscheinungen sind nicht zu überhören. Aber er ist in der Tat ein gestandener Held und überzeugender Verfechter seines (muslimischen Opern-)Glaubens. Artavazd Sargsyan gibt dem spanischen Krieger Gonzalve (dessen Großzügigkeit zum lieto fine führt) viel „christliche“ Kraft und doubliert mit Schmelz als Troubadour in der Balletteinlage. Mit Thomas Dolié, Tomislav Lavoie, Douglas Williams und Philippe-Nicolas Martin sind die fiesen Feinde Almanzors hervorragend besetzt. Lóránt Najbauer tritt erfreulich in kleineren Partien auf, begleitet von Adriána Kalafszky als regionale servante. György Vashegyi am Pult des Orfeo Orchestra und des etwas leidenschaftslosen Purcell Choir könnte mehr an nötigen Drive bei dieser Oper hinlegen, die von den beiden anderen Dirigenten-Kollegen mit mehr Elan, mehr Überzeugung voran getrieben wird. Aber die neue Palazzetto-Einspielung ist unbedingt habenswert auch wegen der wie stets luxuriösen Ausstattung mit zweisprachigen Libretto (wie stets kein Deutsch) und dto. Aufsätzen von Alexandre Dratwicki, Raúl González Arévalo und Jean Mongrédien. Mich begeisterte die selten gehörte Ballettmusik … Aber drei CDs können eine lange Strecke sein, man hört sie am besten in Portionen. G. H.
.

Cherubinis „Abencérages“ – Kostüm für den ersten Almanzor, Louis Nourrit, zur Uraufführung in Paris 1813/ BNF Gallica
Les Abencérages markiert die Rückkehr des Komponisten zur Oper nach zehn Jahren der Stille. Cherubini arbeitete mit dem Librettisten Étienne de Jouy zusammen, der sich von Jean-Pierre Claris de Florians Roman Gonzalve de Cordoue inspirieren ließ. Die Ehe von Almansor und Noraïme, beide vom Stamm der Abencérages, wird durch den feindlichen Stamm der Zégris bedroht, deren Häuptling ebenfalls in Noraïme verliebt ist. Die Zégris denken sich eine List aus, um Almansor absetzen zu lassen. Der zu Unrecht angeklagte Almansor wird dank des Eingreifens von Gonzalve de Cordoue (Gonzalvo de Córdoba) wieder in seiner Ehre bestätigt. Das Werk hatte einen gewissen Erfolg (fast zwanzig Aufführungen – nach einer glänzenden Uraufführung unter der Leitung von Louis Luc Loiseau de Persuis, bei der das Kaiserpaar auftrat), geriet aber nach dem Untergang des Kaiserreichs in Vergessenheit. Dennoch ist Les Abencérages ein Juwel der französischen romantischen Grand Opéra, wie sie damals mit den Werken von Catel, Le Sueur und Spontini aufkam. Die Oper ist in vielerlei Hinsicht ein Vorläufer einiger der größten Werke des Genres: durch die Bedeutung der Entwicklung in der Partitur (vielleicht unter dem Einfluss der jüngsten Entdeckung von Beethovens Symphonien in Paris); durch die Suche nach Klangfarben für dramaturgische Zwecke, indem die Holz- oder Blechbläserfanfaren des Orchesters mit der Lyrik der Soloinstrumente kontrastiert werden; durch die sehr komplizierte Verbindung zwischen der Liebesgeschichte und der großen historischen Erzählung (Jouy verankert die französische Grand Opéra in einem ständigen Bezug zur Geschichte); schließlich durch die Bedeutung des Chors, dessen Rolle, obwohl weniger dekorativ, eine dramatischere Funktion erhält.
.

Der Komponist Luigi Cherubini/ Wikipedia
Luigi Cherubini: Obwohl in Florenz geboren, bleibt Cherubini eine herausragende Persönlichkeit der französischen Schule in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sein Ruf als Komponist litt unter den Feinden, die er sich als Direktor des Pariser Konservatoriums (1822-1842) machte. Unverkennbar ist jedoch, dass er ein einflussreicher Komponist war, der mehr als dreißig Opern, eine große Anzahl von Kammermusik sowie zahlreiche religiöse und symphonische Werke schuf. Der Sohn eines Theatermusikers, der ihm den Kontrapunkt beibrachte, debütierte relativ schnell in Florenz, dann in London und Turin. 1785 wurde er in Paris durch den Geiger Viotti mit Marie-Antoinette bekannt gemacht und wurde Mitglied der Société Olympique, einer Konzertgesellschaft, die einer Freimaurerloge ähnelte und von der französischen Aristokratie besucht wurde. Dennoch war seine erste Komposition für die Académie Royale de Musique, Démophon (1788), kein durchschlagender Erfolg. 1789 wurde er zum Co-Direktor des Théâtre de Monsieur, des späteren Théâtre Feydeau. Dort führt er die ersten Aufführungen seiner wichtigsten Meisterwerke auf: Lodoïska (1791), Élisa (1794), Médée (1797), L’Hôtellerie portugaise (1797) und Les Deux Journées (1800). Obwohl sein Opéra-Ballett Anacréon ou L’Amour fugitif (1803) zu Beginn des Ersten Französischen Kaiserreichs eine vollkommene Beherrschung seiner Kunst zeigt, wurde Cherubini aufgrund seines konterrevolutionären Rufs und seiner schwierigen Beziehung zu Napoléon von den Pariser Bühnen ferngehalten. Seine institutionelle Karriere nahm erst unter der Restauration richtig Fahrt auf, insbesondere mit seiner Ernennung zum Superintendenten der Chapelle Royale (1814) und seiner Wahl zum Mitglied des Institut de France (1815).

Cherubinis „Abencérages“ – Kostümentwurf für Alémar, Henri-Étienne Dérivis bei der Pariser Uraufführung 1813/ BNF Gallica
Mit Les Abencérages brachte Cherubini nach dem zehn Jahre zuvor dort gezeigten Anacréon erstmals wieder ein Werk an der Pariser Oper heraus. Er begann Ende Januar 1812 mit der Komposition. Die Uraufführung fand am 6. April 1813 in Anwesenheit von Napoleon Bonaparte und dessen Ehefrau Marie-Louise von Österreich statt. Es war der Vorabend von Napoleons Aufbruch zu den Schlachten von Großgörschen und Bautzen. Die musikalische Leitung hatte Louis-Luc Loiseau de Persuis. Es sangen Louis Nourrit (Almanzor), Jacques-Émile Lavigne (Gonzalve), Henri-Étienne Dérivis (Alemar), Laforêt (Kaled), Duparc (Alamir), Alexandre (Octaïr), Jean-Honoré Bertin (Abderame), Mouttit père/Henrard (Waffenherold), Alexandrine-Caroline Branchu (Noraïme) und Joséphine Armand (Egilone). Die Choreografie der Ballette stammte von Pierre Gardel. Der Aufführung war nur ein Achtungserfolg beschieden. Das Werk wurde schnell auf zwei Akte gekürzt, brachte es aber dennoch nur auf zwanzig Aufführungen.1828 wurde eine Bearbeitung von Gaspare Spontini mit zusätzlicher Musik (möglicherweise von Cherubini oder Spontini) im Königlichen Opernhaus Berlin gezeigt. Deren deutsche Textfassung stammte von Karl Alexander Herklots. Größere Aufmerksamkeit erhielt eine Produktion beim Maggio Musicale Fiorentino 1957 unter der Leitung von Carlo Maria Giulini. (Wikipedia)
.
..
 Cherubini-Dokumente gibts es erstaunlich viele. Meistens live, wenige aus dem Studio. Ali Baba gab es von der RAI 1963 (Rinaldi, Panerai/ Melodram) und 1963 (Santunione, Sanzogno, nur-Radio) ebendort (ehemals Melodram), Anacreon ebenfalls (1996 Lagrange, Ferro, nur-Radio; 1971 Florenz Ricciarelli, Inbal; 2000 Venedig Workman, Ferro, nur-Radio), Demophon nur für Sammler aus Perugia 1982 (Gasdia, Kelm, ehemals auf Voce-LP) und 1985 Rom (Caballé/ youtube), Les deux Journées unter Thomas Beecham 1947 bei der BBC hatten mal Intaglio und andere im Programm, eine Neuaufnahme unter Christoph Spering gab es bei opus 111 (I due Giornati mit Paolo Silveri und Mirto Picchi hörte man auf MRF LPs von der RAI 1955), Elisa mit Gabriella Tucci boten die RAI und Melodram, Koukourgi 2010 Klagenfurt nur-Radio, Fatiniska dirigierte Lukasz Borwicz 2020 beim Beethovenfest in Warschau und auf DUX, ebenso die Lodoiska 2008 ebendort. 1984 eine schöne Aufführung in Amsterdam mit Patterson und Aler (nur-Radio); Lodoiska gibt´s auch bei Sony aus der Scala mit Mariella Devia und bei Naive mit Nathalie Manfrino unter Jeremy Rhorer. Die Osteria Portuguese kam bei Melodram von der RAI (1952 Ligabue, Piazza) heraus; 1975 (Devia, Calabrese, nur-Radio). Und ein bisschen Kleinkram darüber hinaus. Ein Blick zu youtube lohnt wie immer.
Cherubini-Dokumente gibts es erstaunlich viele. Meistens live, wenige aus dem Studio. Ali Baba gab es von der RAI 1963 (Rinaldi, Panerai/ Melodram) und 1963 (Santunione, Sanzogno, nur-Radio) ebendort (ehemals Melodram), Anacreon ebenfalls (1996 Lagrange, Ferro, nur-Radio; 1971 Florenz Ricciarelli, Inbal; 2000 Venedig Workman, Ferro, nur-Radio), Demophon nur für Sammler aus Perugia 1982 (Gasdia, Kelm, ehemals auf Voce-LP) und 1985 Rom (Caballé/ youtube), Les deux Journées unter Thomas Beecham 1947 bei der BBC hatten mal Intaglio und andere im Programm, eine Neuaufnahme unter Christoph Spering gab es bei opus 111 (I due Giornati mit Paolo Silveri und Mirto Picchi hörte man auf MRF LPs von der RAI 1955), Elisa mit Gabriella Tucci boten die RAI und Melodram, Koukourgi 2010 Klagenfurt nur-Radio, Fatiniska dirigierte Lukasz Borwicz 2020 beim Beethovenfest in Warschau und auf DUX, ebenso die Lodoiska 2008 ebendort. 1984 eine schöne Aufführung in Amsterdam mit Patterson und Aler (nur-Radio); Lodoiska gibt´s auch bei Sony aus der Scala mit Mariella Devia und bei Naive mit Nathalie Manfrino unter Jeremy Rhorer. Die Osteria Portuguese kam bei Melodram von der RAI (1952 Ligabue, Piazza) heraus; 1975 (Devia, Calabrese, nur-Radio). Und ein bisschen Kleinkram darüber hinaus. Ein Blick zu youtube lohnt wie immer.

Cherubinis „Abencérages“ – die Uraufführungs-Sängerin der Noraime, Alexandrine Caroline Branchu (nata Chevalier, fu nel 1807, all’età di 27 anni la prima protagonista de „La Vestale“/Musero Spontini, Maiolati Spontini)
Aber es geht nichts über Cherubinis Médée von 1997, die so unglaublich modern den Dialog mit dem Gesang mischt und ihn als psychologisches Gestaltungselement für die Titelheldin einsetzt (ihr gehen nach einem fast nur gesprochenem ersten Akt in der Folge buchstäblich die Worte aus). Médée ist für mich das non plus ultra der Opern jener Epoche und richtungsweisend danach. Sie ist für mich nahezu ideal vertreten mit einer Videoeinspielung aus Compiegne 1996 (DOM, noch immer kaufbar bei Amazon; Michele Command eine recht reife Titelheldin, aber das Spannende ist die Mischung aus Schauspielern für die Hoffman-Dialoge und Sängern für die Oper selbst, im Soundtrack absolut ideal sich mischend; auf der Bühne eher etwas gewöhnungsbdürftig). Um die Video-Version von BelAir aus Brüssel mit der ziemlich grässslichen Nadja Michael muss man trotz Rousset am Pult einen Bogen machen. Auch eigentlich um den Dynamic-Mitschnitt aus Martina Franca mit der groben Iano Tamar in Berlitz-Französisch in der Titelpartie (trotz Jean-Philippe Courtis als balsamischer Créon). Phyllis Treigle gibt bei Newort Classics eine seriöse, aber uninsprierte Médeé neben einem dto. recht blanden Kollegium, aber immerhin war dies 2003 die erste und bis heute einzige originalsprachige Studio-Einspielung. Rosalind Plowright sang sie en francais und bemerkenswert in Buxton 1986 (mit bellenden Hunden, nur-Radio) und weniger erfolgreich in Covent Garden1989 neben (immerhin) Renée Fleming als Dirce (Video). Unter dem Dirigenten Michael Hofstetter gab es bemerkenswerte Aufführungen in Gießen und Koblenz 1999, die die veränderte Ouvertüre und das Finale mit verstärkten Trompeten der Version für Brüssel 1840 aufwiesen (Sammlermitschnitte). 2015 dirigierte Igor Folwill die Oper en francais (und nur Sammlern zugängig) in Ulm (mit den von Alan Curtis nachkomponierten Rezitativen in französischer Sprache) in der Edition von Heiko Cullmann, dem Fachmann für Medea überhaupt.
Von den mehr als zahlreichen sog. italienischen Lachner-Versionen (keine im originalen Deutsch von Herklots Berlin 1800 bzw. Treitschke Wien 1821, Lachners Rezitative von 1855, dann in Italienisch von Salvatore de Castrone (Salvatore Marchesi) mit den Rezitativen von Luigi Arditi 1865 am Her Majesty‘s Theatre in London (später Covent Garden); Maria Callas aufwärts sang dann alles in der Übersetzung von Carlo Zangarini) mit und ohne M. C. (der unübertroffene Prototyp dieser Fassung), Inge Borkh (deutsch von Horst Goerges und Wilhelm Reinking, absolut wahnsinnig), Eileen Farrell (jaja), Josephine Barstow (in Englisch), Marisa Galvany (wüst), Maralin Niska (wüst), Leonie Rysanek (letzte Zuckungen ohne Tiefe), Dimitra Theodossiou in Lissabon 2005 (nicht unrecht mit vier Belcanto-Stimme), Leyla Gencer (streng humorlos), Orianna Santunione (ordentlich), Magda Olivero (glottisglucksend, aber bedeutend), Montserrat Caballé (indiskutabel), Gwyneth Jones (bei Decca, gar nicht und zutiefst überflüssig), Denia Mazzola (veristisch und verbraucht-explodierend, youtube), Elizabeth Connell (schneidend), Adelaide Negri (noch wüster), Shirley Verrett (Lachner in Französisch, abgefahren, die Diva wollte das nicht im Original sprechen), Sonya Yoncheva (somnambul-maulig), Anna Caterina Antonacci (maulig-riskant). Und jüngst 2022 Sondra Radvanovsky sehr beeindruckend an der Met (wunderbare Schauspielerin, sehr aufregend als Gesamteuindruck, reif, schonungslos tapfer und unruhig; Video-Stream, Kino) etc. will ich hier einige nur erwähnen. G. H.
.
.

Cherubinis „Les Abencérages“ – Figurinen zur Uraufführung in Paris 1813/ BNF Gallica
Zur Oper selbst: „Nie hat Cherubini ein männlicheres Talent und eine größere dramatische Schöpfungskraft bewiesen, als in Les Abencérages. Gerade in dieser Oper hat dieser große Komponist auf eine ihm ureigene Art den harmonischen Reichtum, der der Stolz der deutschen Schule ist, mit der richtigen, packenden Ausdruckskraft verbunden, die die französische Bühne verlangt.“ So schrieb der Verleger und Schriftsteller Auguste Wahlen, als er wenige Jahre nach der Premiere der Oper in Paris (1813) eine Sammlung von Libretti seines Freundes Etienne de Jouy veröffentlichte, zu der eben auch das Textbuch zu Les Abencerages gehörte. Dass diese eine der erfolgreichsten Opern Cherubinis gewesen ist, belegen nicht nur die schmeichelhaften Äußerungen der bei der Premiere anwesenden Persönlichkeiten, darunter auch von Napoleon und Marie Louise, sondern paradoxerweise auch ein Antrag des Komponisten. Cherubini hatte nach etwa zwanzig Vorstellungen die Absicht, die Oper auf zwei Akte reduzieren, damit mehr Balletteinlagen aufgenommen werden konnten: diese Vorgehensweise war in Frankreich den Opern vorbehalten, die in den Kreis der Repertoirewerke aufgenommen werden wollten. Les Abencérages hatte in Berlioz, Mendelssohn und Spontini große Bewunderer und Förderer. Spontini hatte bei La Vestale ebenfalls schon mit Etienne de Jouy zusammengearbeitet und hatte als erster Les Abencerages in deutscher Fassung in Deutschland dirigiert.

Cherubini: „Les Abencérages“ – Bühnenbild zur Uraufführung in Paris 1813/ BNF Gallica
Bedauerlicherweise hielt die Popularität von Les Abencérages nicht lange an. Viele Jahrzehnte lang geriet die Oper, abgesehen von einigen wenigen Aufführungen der Ouvertüre oder einzelner Arien Almanzors, in Vergessenheit. Die Produktion des Maggio Musicale Fiorentino aus dem Jahre 1956 (mit Anita Cerquetti und Louis Roney unter der Leitung von Carlo Maria Giulini) bot deshalb die Möglichkeit, wenngleich auch nur in einer wenig gelungenen italienischen gereimten Übersetzung, ein für Cherubinis künstlerischen Weg wichtiges Werk, seine letzte ernste Oper wieder aus der Versenkung zu holen.

Cherubinis „Abencérages“ – „Die Halle der Abencerages“ in der Alhambra, Granada, 1853/ Wikipedia
Cherubini wollte in Les Abencérages die Konventionen der französischen Oper überwinden und versuchte deshalb wie in seiner Médée, die szenisch-dramatische Seite zu betonen, auch wenn das etwas überladene Libretto Etienne de Jouys für ihn dabei vielleicht hinderlich war. Gegenüber seinen vorhergehenden Opern zeigt Cherubini hier eine stärkere Tendenz zum Melos. Die Arien werden genauer umrissen, wenngleich – wie bei den anderen für Paris geschriebenen Werken – die geschlossenen Nummern fehlen. Cherubini kann zwar, bedingt durch die bereits erwähnten Mängel des Librettos, die Hauptpersonen nicht so genau vertiefen wie in Medea oder Lodoiska, es gelingt ihm in Les Abencérages aber doch Chöre von hoher Qualität zu schaffen, die bei der Uraufführung an der Opéra am 6. April 1813 zu Recht allgemeine Bewunderung erregten. Die Nummer, die sich vor allen anderen dem Publikum einprägte, war der Chor im Finale des zweiten Akts „Grenade est libre“. Nicht weniger gelungen und kunstvoll ist der Orchestersatz, und das nicht nur in der Ouverture und in den Ballettmusiken. In der gesamten Oper spürt man das Bestreben Cherubinis, der französischen Oper ein neues Gewand zu geben, beginnend mit der Komplexität des*szenischen Aufbaus über die Wahl eines dem sinnlichen Spanien verpflichteten Sujets bis hin zu der Verwendung beachtlichen Chor- und Orchestermassen, die das Werk zu einem Beispiel der Grand Opera vor deren eigentlicher Zeit machen.
Für eine Wiederaufnahme von Les Abencéragess in französischer Sprache musste man auf die Rundfunkproduktion der RAI vom 15. Januar 1975 warten, die beim italienischen Radio durch Peter Maag angeregt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde auf die erste, dreiaktige Fassung zurückgegriffen. Trotz eingeschränkter Verwendung der Ballettmusiken wurden, entgegen der Rundfunkpraxis jener Jahre, nur geringe Striche vorgenommen. Die Aufnahme ohne Publikum, und wurde nach einigen wenigen, kleinen Korrekturen ein paar Tage später gesendet. Die konzertante Übertragung mit dem Orchester der RAI in Mailand sollte als Generalprobe für eine nicht zustande gekommene Aufnahme bei Decca dienen. Gian Andrea Lodovici/Übersetzung: Daniel Brandenburg (den Text von Gian Andrea Lodovici entnahmen wir gekürzt der Arts-Ausgabe der RAI-Einspielung).
.
.

Maria Fortuny: „Der Mord an den Abenceraji,“ 1870/ Wikipedia
Les Abencérages: Der Name scheint sich von Yussuf ben-Serragh abzuleiten, dem Oberhaupt des Stammes zur Zeit von Mohammed VII., dem Sultan von Granada (1370-1408), der diesem Herrscher in seinem Kampf um die Krone, derer er dreimal beraubt wurde, gute Dienste erwies. Über die Familie ist nur wenig sicheres bekannt. Dem Chambers Biographical Dictionary zufolge kamen sie im 8. Jahrhundert nach Spanien, aber der Name ist aus dem Roman von Ginés Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada, bekannt, in dem die Fehden der Abencérages mit der rivalisierenden Familie der Benedin (arabisch banu Edin) und die grausame Behandlung, der die ersteren ausgesetzt waren, beschrieben werden. J. P. de Florians Gonsalve de Cordoue und Chateaubriands Le dernier des Abencerrages sind Adaptionen der Geschichte von Pérez de Hita.
Es wird erzählt, dass einer der Abencérages, der sich in eine Dame der königlichen Familie verliebt hatte, auf frischer Tat ertappt wurde, als er zu ihrem Fenster hinaufkletterte. Die Morde wurden von Ibrahim Benedin angeordnet, der eine Fehde mit der Familie hatte. In seiner Wut sperrte er die gesamte Familie in einem der Säle der Alhambra ein und gab den Befehl, sie alle zu töten. Die Wohnung, in der dies geschehen sein soll, ist einer der schönsten Innenhöfe der Alhambra und wird immer noch der Saal der Abencerrages genannt.
Washington Irving ist in Tales of the Alhambra (1832) anderer Meinung und behauptet, das Massaker sei eine Fiktion, aber eine Reihe von Abencérages seien damals in einer der Schlachten getötet worden. Nichtsdestotrotz wird die Legende in zahlreichen Gedichten und Theaterstücken, in der Novelle Die Abencerraje und in zwei Opern (Les Abencérages von Luigi Cherubini und L’esule di Granata von Giacomo Meyerbeer) erwähnt. (Wikipedia)
.
.

Cherubinis „Abencérages“ – „La nuit de la Prise de Grenade“/ Gemälde von Gustave Ethuin/ Wikipedia
Zum Inhalt/ Erster Akt: Im Granada des 15. Jahrhunderts herrschen noch die Mauren. Allerdings gibt es einen Konflikt zwischen den Adelsgeschlechtern der Abencerragen und der Zegris. Alemar, Alamir und Kaleb, allesamt Anhänger der Familie Zegri, verschwören sich gegen Almanzor. Dieser gehört der Abencerragen-Familie an. Die Verschwörer neiden ihm seine bisherigen Siege und politischen Erfolge, und sie sind entschieden gegen die Verlobung zwischen Almanzor und der Prinzessin Noraïme. Am gleichen Tag wird ein von Almanzor abgeschlossener Friedensvertrag mit Spanien mit einem großen Fest gefeiert. Während des Festes trifft die Nachricht ein, dass der gerade gefeierte Frieden bereits gebrochen sei. Das bedeutet für Almanzor, dass er seine geplante Hochzeit mit Noraïme verschieben muss. Stattdessen muss er in den Krieg ziehen. Dabei wird ihm die Fahne von Granada anvertraut, die er mit in den Krieg führen soll. Diese Fahne gilt als eine Art Nationalheiligtum und darf unter keinen Umständen verloren gehen. Es ist die Pflicht eines jeden, dem die Fahne anvertraut wurde, diese wieder zurückzubringen. Geschieht das nicht, hat der Betreffende sein Leben verwirkt. Genau an diesem Punkt setzen die Verschwörer an und organisieren den Diebstahl der besagten Fahne.

Cherubinis „Abencérages“ – Kostümentwürfe für die Uraufführung 1813/ BNF Gallica
Zweiter Akt: Der Krieg ist gewonnen, und Almanzor kehrt als siegreicher Feldherr heim. Allerdings kann er die ihm anvertraute Fahne nicht pflichtgemäß zurückgeben, da diese ihm gestohlen wurde. Trotz seiner Siege wird er nun verhaftet und vor Gericht gestellt. Dort fordern die Zegris seine Hinrichtung. Angesichts der militärischen Erfolge von Almanzor verzichtet der Gerichtspräsident Abderam auf die Todesstrafe. Almanzor wird aber des Landes verwiesen. Bei seiner Rückkehr würde die Todesstrafe gegen ihn dann doch vollstreckt. Damit haben die Zegris ihr Ziel erreicht. Nun sinnen natürlich die Abencerragen, der Clan von Almanzor, auf Rache.
Dritter Akt: Almanzor kehrt als Sklave verkleidet in seine Heimat zurück, um mit sich mit seiner Geliebten und vormaligen Braut Noraïme zu treffen. Sie beschließen eine gemeinsame Flucht. Noch ehe es dazu kommt, haben die Zegris Almanzor entdeckt und verhaftet. Dieser wird nun erneut vor das Gericht gestellt und soll nach dem Willen der Zegris nun hingerichtet werden. Der Richter entscheidet, Almanzor solle hingerichtet werden, falls nicht irgendjemand der Anwesenden bereit wäre, für ihn gegen Alamir, den Hauptanführer der Zegris, zu kämpfen. Es findet sich tatsächlich ein Ritter, der sich als Gonzalve zu erkennen gibt, der die spanische Delegation bei den Friedensabschlüssen geleitet hat. Gonzalve tötet Alamir in dem Zweikampf. Außerdem ist es Gonzalve gelungen, in den Besitz der gestohlenen Fahne zu gelangen. Er kennt die Geschichte von der Verschwörung der Zegris und dem Diebstahl der Fahne. Diese Wahrheit offenbart er nun der Öffentlichkeit. Daraufhin werden die verbliebenen Zegris verurteilt und Almanzor freigesprochen. Dieser wird nun vom Volk als Kriegsheld gefeiert und kann endlich seine Prinzessin heiraten. (Wikipedia). (Abb. oben Blanca and Abon Hamet in the Gardens of the Alhambra, from Chateaubriands‘ Ata, ‚Le Dernier des Abencerages“/ Wiki). Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie hier
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.











 Die große Bühne, nämlich das Wiener Burgtheater, tat sich 1785 für
Die große Bühne, nämlich das Wiener Burgtheater, tat sich 1785 für

 Bald wusste ich es besser. Das Libretto war auch in der DDR aufzutreiben, für Pfennige in einem Antiquariat im nahegelegenen Jena. Dieses Reclam-Heft habe ich heute noch. Um mir die Texte einzuprägen, hätte ich es allerdings nicht gebraucht. Wagners Ring-Sprache lernt sich leicht. Zumal dann, wenn die Sänger so deutlich singen wie auf meiner Schallplatte, die inzwischen auch mehrfach als CD und in astreinem Stereo aufgelegt wurde. Jedes Wort ist zu verstehen. Keine Silbe wird verschluckt. Nichts geht unter im Orchester. Aus dieser Genauigkeit erwächst das inhaltliche und musikalische Verständnis in seinen Grundzügen ganz von allein. Wenngleich sich der Vortragstil über die Jahrzehnte verändert hat, die Notwendigkeit der inhaltlichen Verständlichkeit ist geblieben. Ich war „verdorben“. So perfekt sollte ich Wagner nur noch selten hören.
Bald wusste ich es besser. Das Libretto war auch in der DDR aufzutreiben, für Pfennige in einem Antiquariat im nahegelegenen Jena. Dieses Reclam-Heft habe ich heute noch. Um mir die Texte einzuprägen, hätte ich es allerdings nicht gebraucht. Wagners Ring-Sprache lernt sich leicht. Zumal dann, wenn die Sänger so deutlich singen wie auf meiner Schallplatte, die inzwischen auch mehrfach als CD und in astreinem Stereo aufgelegt wurde. Jedes Wort ist zu verstehen. Keine Silbe wird verschluckt. Nichts geht unter im Orchester. Aus dieser Genauigkeit erwächst das inhaltliche und musikalische Verständnis in seinen Grundzügen ganz von allein. Wenngleich sich der Vortragstil über die Jahrzehnte verändert hat, die Notwendigkeit der inhaltlichen Verständlichkeit ist geblieben. Ich war „verdorben“. So perfekt sollte ich Wagner nur noch selten hören.



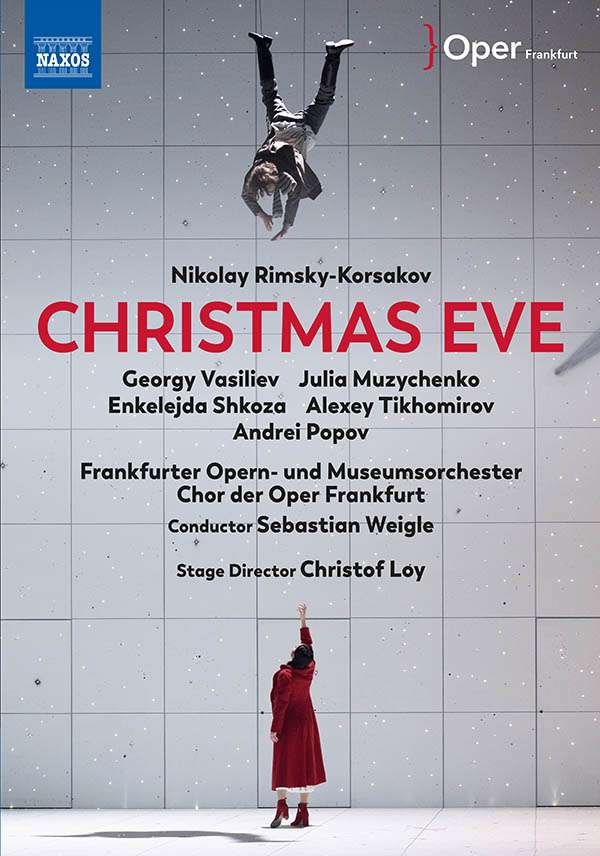






 Zurück nach Lateinamerika: Il Guarany
Zurück nach Lateinamerika: Il Guarany


 Oper wurde ein Modell zur Beruhigung des schlechten Gewissens
Oper wurde ein Modell zur Beruhigung des schlechten Gewissens












 Aber man muss wieder einmal der italienische Rundfunkanstalt
Aber man muss wieder einmal der italienische Rundfunkanstalt  Es gibt die
Es gibt die 


 Cherubini-Dokumente
Cherubini-Dokumente





