.
In Zeiten von Brexit, Backstop, Good Friday Abkommen oder erneuter Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten, also Pro-Republik-Irland-Tendierenden und Pro-Großbritannien-Verbleibenden, Nord-Irlands und der ebenso bewusst vorsichtigen Republik selbst ist es auch für Außenstehende lohnend, sich an die gemeinsamen kulturellen Wurzeln dieser so schmerzhaft geteilten Insel zu besinnen, die so lange und ebenso schmerzhaft dominiert unter der Jahrhunderte langen Fremd-Herrschaft in mannigfaltiger Hinsicht gelitten hat und deren kulturelle Identität von der englischen oft bis zur Unkenntlichkeit überdeckt wurde.
Das gilt auch und vor allem für die Literatur und Musik Irlands, die zur Zeit des Komponisten Robert O´Dywyer es unglaublich schwer hatte, zu einer eigenen Identität zu finden, ein eigenes Idiom in sprachlicher wie musikalischer Hinsicht zu erfinden und aus dem eigenen Fundus der Folklore und der zaghaften, eher amateurhaften Versuchen eine Selbständigkeit zu entwickeln. Vor Robert O´ Dywer (1862 – 1949; von ihm nachstehend mehr) hatte es nur mehr oder weniger gehobene Folklore, Balladen eines Thomas Moore und anderen gegeben (das romantische Europa ging der Legende vom gälischen Ossian durch den Iren Robert McPherson/ 1736 – 1796 auf den Leim, in Erinnerung heute nur noch durch Massenets Zitat im Werther). Aber eine Oper im eigenen irischen Idiom gab es eben nicht. Man sang von der Sehnsucht nach Befreiung vom britischen Joch oder der Schönheit der grünen Insel am Kamin, in den Kneipen oder den Music-Halls.
.

Robert O´Dwyers Oper „Eithne“: die rte lyric Aufnahme vom Konzert 2017 in Dublin
Mit absoluter Überraschung und vielleicht das Objekt der Bewunderung überschätzendem Beifall wurde im Oktober 2017 im republikanischen Dublin von dem Chor der National Opera Irlands und dem RTE National Symphony (Radio) Orchestra unter Fergus Sheil Robert O´Dwyers Oper Eithne von 1909 konzertant in modernen Zeit erstaufgeführt: Eine Oper über die mythische Vergangenheit Irlands in eben gälischer Sprache. Davon liegt nun die CD-Übernahme bei RTE Lyric vor, dem Radiosender der Republik, der das Konzert vom Oktober 2017 übertragen hatte, den Jubel des Konzertpublikums eingeschlossen (RTECD 1568/ 2 CD).
.
Es ist dies eine Oper über die mythische Vergangenheit der gälischen Insel, mit Königsfindung, Giganten, magischen Vögeln, Fabelwesen, einer tragischen Liebesgeschichte natürlich (die schöne Eithne muss aus einem Zauber befreit werden und den High King heiraten, während ein anderer Ritter sie begehrt). Um 1900 begann auf der Insel eine Renaissance irischer Selbstfindung auch auf dem Musiksektor, und die 1902 gegründete Gaelic League spielte dabei eine entscheidende Rolle. Bereits 1904 beauftrage sie O´Dwyer mit der Komposition zu einem Libretto von Tadgh O´Donoghue, Cran ach Oir/ The Tree of Gold, die erfolgreich in Dublin aufgenommen wurde. Der Bariton und promovierte Musikwissenschaftler Gavan Ring beschreibt die Umstände zur Komposition der Oper Eithne im folgenden Artikel, den wir mit seiner Genehmigung dem Programmheft zur Aufführung 2017 entnahmen. Das Booklet zur neuen CD-Ausgabe bietet für nicht Gälisch-Sprechende neben dem Text von Gavan Ring das Libretto in englischer Übersetzung, während die Tracks in der irischen Sprache verbleiben, die in ihrer Schreibform noch verwirrender als Tschechisch aussieht und keine Hilfe beim Auffinden der Solonummern ist. Wir lernen aber, dass „… ard a mian chun fialdh lae gréine“ eben „Freude für die Jagd an diesem sonnigen Tag“ heißt, das ist doch was!
.

„Ossian“, Gemälde von Anne-Louis Girodet/Wiki
Gavan Ring ist auch der prachtvolle High King in dieser Aufnahme aus der Concert Hall in Dublin, wo seine Kollegen Orla Boylan/ Eithne, Robert Tritschler/Ceart, Imelda Drum/Nuala sowie Brendan Collins, Eamon Mulhall, John Molloy, Robert McAllister, Rachel Croash, Fearghal Curtis, Eoghan Desmond und Conor Breen zusammen mit den genannten Kräften unter Fergus Sheil diese musikalisch sehr an Brahms, Mendelssohn, Sullivan und eine runde Mischung irischer Balladen erinnernde große spät-romantische Oper vorstellen. Sie mag in ihrem musikalischen Eindruck für kontinentale Ohren vielleicht nicht die genialste Schöpfung sein (und scheint mir in der Instrumentierung interessanter als von der Erfindung her), aber ihre ideologisch-patriotische Wirkung war damals bedeutend. Wir haben im vereinten Nachkriegseuropa ganz vergessen, dass Irland (1801 nach jahrhundertelanger Besatzung offiziell an Großbritannien angeschlossen) erst 1937 eine Republik wurde (ohne Nordirland, das bis heute in zwei sich bekämpfende Lager gespalten ist) und 1949 aus dem Vertrag mit Großbritannien austrat. Erst 1998 gab die Republik offiziell ihren Anspruch auf Nordirland auf, nachdem 1985 ein Waffenstillstand mit der pro-republikanischen Sinn Fein und das sogenannte Karfreitags-Friedens-Abkommen, erreicht worden war, das wegen eines harten Brexit heute bedroht ist. G. H.

Robert O´Dwyer: „Eithne“/ der Autor und Bariton Gavan King/ Konzert in Dublin 2017/ Foto website Gavan King
Und nun der Artikel von Gavan Ring zur Oper Eithne und deren Komponisten Robert O´Dwyer: Der vom irischen Musikwissenschaftler Joseph Ryan als „farbiger Charakter“ beschriebene Robert O’Dwyer wurde am 27. Januar 1862 in Bristol als Sohn irischer Eltern geboren. Er wurde dort in verschiedenen Kirchen als Chorknabe und Organist ausgebildet, bevor er seine Karriere als Tenor bei der Carl Rosa Opera Company und anschließend als Dirigent begann – sein erster Einsatz mit dem Taktstock ereignete sich, als er 1891 erfolgreich für den Chefdirigenten während einer Carl-Rosa-Aufführung von Wallace‘ Maritana einsprang. Es schlossen sich weitere Engagements bei verschiedenen britischen Wandergruppen an, bevor er sich 1897 in Dublin niederließ. Im Jahre 1900 wurde man landesweit erstmals auf O’Dwyer aufmerksam, als seine Orchesterouvertüre Rosalind den ersten Preis beim Belfast Feis Ceoil gewann. Diese Leistung stand am Anfang von O’Dwyers erfolgreichster Dekade als Komponist – eine Periode, in der er einer der Stimmführer wurde im Bestreben hinsichtlich der Etablierung einer unverwechselbaren nationalen Schule der irischen Musikkomposition.
Überaus nationalistisch und ein starker Befürworter einer Wiederbelebung der irischen Sprache (irisch Gaeilge), wurde er nicht lange nach seinem Erfolg mit Rosalind Mitglied der Conradh na Gaeilge (Liga des Irischen) und gründete 1902 den Festchor der Liga. Die Liga gab sogleich Chormusik bei O’Dwyer in Auftrag. Den Anfang machte eine Reihe von vierteiligen Liedern, genannt Amhrán an Oireachtais (1902). Bereits 1904 beauftragte die Liga O’Dwyer indes in Kooperation mit dem bekannten Schriftsteller Tadhg O’Donoghue mit einem Opernprojekt, das den ersten Akt des irischen Märchens Crann an Óir (Der Goldbaum) vertonten sollte. Dieser erste Aufzug wurde beim Oireachtas na Gaeilge, dem alljährlichen Festival der Liga, im selben Jahr aufgeführt und entpuppte sich insgesamt als großartiger Erfolg.

Robert O´Dwyer: „Eithne“/ Kozert in Dublin 2017/ Orla Boylan/Foto Opera Theatre Company
In der Hoffnung, den Erfolg von Crann an Óir wiederholen zu können, verlangte die Liga von O’Dwyer für das Festival von 1909 etwas Ähnliches. Der Komponist entschied sich für die märchenhafte Legende von Éan an cheoil bhinn (Der Vogel der süßen Musik), die ihm die Basis für den Plot von Eithne lieferte. Die Geschichte dieser Legende selbst war bereits allgemein bekannt innerhalb der Kreise der Liga des Irischen, da sie bereits als Teil des unveröffentlichten Geschichtenwettbewerbs im Zuge des Festivals von 1901 eingereicht und 1908 schließlich publiziert worden war. O’Dwyer gewann den renommierten Wissenschaftler und Dramatiker Tomás Ó Ceallaigh als Librettisten für Eithne. Ó Ceallaigh, ein aus Sligo stammender Priester, war sehr aktiv in der Formierung der irischen kulturellen Wiedergeburt im Laufe des frühen 20. Jahrhunderts; seine Übersetzung von W. B. Yeats Meilenstein Cathleen ni Houlihan im Jahre 1902 verschaffte ihm einen großen Bekanntheitsgrad.
.
Das Libretto entstand in weniger als einem Monat im Juli 1909; die Proben für Eithne begannen, als O’Dwyer in seinem Haus in Rathmines komponierte. Er engagierte zudem drei Kopisten für die Orchesterparts. Der Kompositionsprozess ging so hektisch vonstatten, dass der Abend vor der Vollendung von Eithne mit der Generalprobe zusammenfiel. Eithne erlebte seine Uraufführung am 2. August 1909 und lief bis zum 5. August im Round Room der Dubliner Rotunda (dem heutigen Ambassador Theatre). Die von einem Orchester von vierzig Musikern und einem Chor von sechzig Sängern begleiteten und von O’Dwyer persönlich geleiteten Aufführungen waren ungeheuer erfolgreich und wurden von der Kritik mit Lob überschüttet. Dies führte dazu, dass man innerhalb der Liga ein Komitee einsetzte, das die Publizierung der Gesangspartitur initiierte und eine Wiederaufnahme der Oper für 1910 beschloss. Das unter dem Vorsitz des bekannten irischen Mediziners Sir Charles Cameron stehende Komitee bestand aus Vertretern der künstlerischen, politischen und gesellschaftlichen Intelligenzija Dublins, darunter Douglas Hyde und die Countess Markiewicz.
.

Robert O´Dwyer: „Eithne“/ Kozert in Dublin 1910 Besetzungsliste und Details/ Foto Opera Theatre Company
Die Aufführungen am Gaiety Theatre im Mai 1910 wurden von der Kritik sogar mit noch mehr Hochachtung bedacht und der Erfolg übertraf selbst den vom Vorjahr in der Rotunda. Die Irish Times schrieb: „Die Oper wurde begeistert aufgenommen und Mr. O’Dwyer erschien etliche Male mit den Direktoren auf der Bühne, um den Applaus nach dem Ende jeder Szene entgegenzunehmen.“ Obwohl die Gaiety-Vorstellungen nicht abhängig waren von der Fertigstellung der Orchesterpartitur, erwiesen sich die Proben des Jahres 1910 als weitere rasende Erfahrung. In einer interessanten kleinen Anekdote des Freeman’s Journal wird erwähnt, wie O’Dwyer in der Eröffnungsvorstellung 1910 seinen Dirigierstab vergaß: „Der arme Mr. O’Dwyer hat sich mit den Proben etc. beinahe selbst zu Tode gearbeitet, und an diesem Abend wusste er kaum, ob er auf seinem Kopf oder auf seinen Absätzen stand, bevor er das Dirigentenpodium erreichte; und dann bemerkten wir, dass er nun wieder er selbst war. Doch als er im Begriff war, seinen Platz einzunehmen, fiel ihm auf, dass er seinen Dirigierstab vergessen hatte. Der Bühnenmanager rannte hinüber zu einem kleinen Geschäft auf der anderen Straßenseite, kaufte einen Stock für einen Penny, kürzte ihn um ein Stück und übergab ihn Mr. O’Dwyer. Damit dirigierte er die erste Aufführung von Eithne.“
.
Eithne lief vom 16. bis 21. Mai 1910 am Gaiety Theatre, wurde jedoch unterbrochen durch das Begräbnis von König Eduard VII., dass es notwendig machte, das Theater während der beiden letzten Vorstellungen zu schließen. Dies bedingte einen Verlust von 200 Pfund – heute ungefähr 25.000 Euro –, die O’Dwyer selbst bezahlen musste.
Obschon O’Dwyers Großtat mit Eithne ihm eine Professur für irische Musik am University College Dublin verschaffte und seine vorzügliche Reputation in Irland bis zu seinem Tode 1949 fortdauerte, blieben verschiedentliche Bitten um eine Wiederaufnahme von Eithne unerhört. Auch wenn die Aufführungen von 1909 und 1910 tatsächlich sehr positiv aufgenommen worden waren, führten die wenig später verstärkt aufgeworfenen sozialpolitischen Fragen wohl auch dazu, dass das Werk an Popularität einbüßte. Die Opernszene in Dublin im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde hauptsächlich durch einen Appetit auf ausländisches Repertoire gestützt. Nach der Ausrufung der Republik im Jahre 1922 wurde Irlands kulturelle Anschauung zunehmend in sich gekehrt und Kunstmusik stand nur mehr wenig im Zentrum. Einheimische Erfindungen wie Eithne konnten diesem Typus des kulturellen Paradigmas nicht genügen. Gavan Ring ( Übersetzung Daniel Hauser)
.
.

Robert O´Dwyer: „Eithne“/ der Autor und Geschichtswissenschaftler Axel Klein/ Foto website
Dazu auch ein Artikel des Musikwissenschaftlers Axel Klein über Keltizismus in der irischen Oper: Robert O’Dwyers Eithne ist einer der bedeutendsten Beiträge zum Keltizismus in der irischen Musik – ein Trend, der besonders an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verbreitet war und der auf entsprechende Entwicklungen innerhalb der Literatur, des Schauspiels und der bildenden Künste reagierte. Anders als im Falle der meisten anderen Vertreter dieser Kunstgattungen, sind die musikalischen Entsprechungen weitgehend vergessen. Eithne erinnert uns daran, was wir verloren haben. Wir sollten und könnten einen ausgewogeneren Blick auf diese Epoche der irischen Kunst wiederbeleben, indem wir die Zeit und eben die Musik mehr in den Fokus stellten.
Definieren wir Keltizismus für unseren Zweck als einen Rückgriff auf Figuren, Geschichten, Legenden oder Mythen durch einen zeitgenössischen Künstler. Diese sind Teil des gemeinsamen Erbes der früheren Kelten. Im Falle von Irland geht dies oftmals bis lange vor die frühe Christianisierung zurück, bis zu den Legenden der Fianna oder den Ereignissen in den Annalen der vier Meister. Oftmals schlachten solche Werke existierende irische Legenden aus, indes spielen nicht selten halbauthentische oder erfundene Charaktere, die ein keltisches Klischee erschaffen, ebenfalls eine Rolle.
Der Keltizismus in der irischen Oper begann weder mit O’Dwyer noch endete er mit ihm. Sein Ruhm liegt beinahe ausschließlich in Eithne begründet. Die Anfänge des Wiedererwachens der verlorenen keltischen Vergangenheit Irlands beginnt im 18. Jahrhundert. In der Operngattung sind die ersten Werke The Milesian (1777) des in Dublin geborenen Charles Thomas Carter (um 1735-1804) und vielleicht die musikalischen Theaterstücke Genius of Ireland (1784) und The Island of Saints (1785) des eingewanderten italienischen Komponisten und Impresario Tommaso Giordarni (um 1733-1806) – der heute in erster Linie für seine Tenorarie Caro mio ben bekannt ist. Ob die beiden letzteren Werke überhaupt als Opern bezeichnet werden können, ist eine andere Frage, doch sind wir auf sichererem Terrain mit Thomas Simpson Cookes Thierna-na-Oge oder The Prince of the Lakes (1829), anglisiert von Tír na nÓg, dem mythologischen Land der ewigen Jugend. Interessanterweise erfuhren sowohl Carters Milesian als auch Cookes Thierna-na-Oge ihre Aufführungen nicht auf irischen, sondern auf englischen Bühnen.

Robert O´Dwyer: „Eithne“/ der Komponist 1921/ DRG
Cork war der Ort der nächsten irischen keltizistischen Oper. Es handelt sich um Amergen, geschrieben von Paul McSwiney (1856-1890) und erstaufgeführt am 23. Februar 1881 in Cork. Das Werk erregte seinerzeit erhebliches lokales Interesse. Verschiedene Zeitungen berichteten täglich über den Fortgang der Proben, und während der fünf Aufführungen war das Haus „bis auf den letzten Platz besetzt vom Boden bis zur Decke“. McSwineys eigenes Libretto konzentrierte sich auf eine versuchte wikingische Invasion Irlands, die aufgrund des Heldenmutes von Amergen fehlschlägt, der das Leben des irischen Hochkönigs Conaire Mór rettet und zum Dank dafür dessen geliebte Tochter Adela zur Frau erhält.
Kurz nach der Jahrhundertwende erfasste die Welle an keltizistischen Opern ganz Irland. Die erste war Connla of the Golden Hair (1903) von William Harvey Pélissier, einem ziemlich obskuren Komponisten, der um 1873 in Clonmel in der County Tipperary geboren wurde und während des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts in Dublin aktiv war. Das Werk gewann den Kantatenpreis (!) beim Feis Ceoil im Mai 1903, wurde als Resultat dessen gedruckt und verlegt und erlebte eine konzertante Aufführung. Die Publikation zeigt klar Pélissiers Intentionen in Sachen Oper, unter anderem eine sehr detaillierte Liste an Leitmotiven, die von Wagner inspiriert wurden. Das Libretto des Komponisten basiert auf einer alten irischen Erzählung aus dem Königszyklus, ursprünglich genannt Echtrae Chonnlai (Connlas Abenteuer). Es erzählt verschiedene, zunächst erfolglose Versuche verführerischer Elfen, den Opernhelden nach Moy-Mell zu locken, ein mythologisches Elfenland; am Ende sind diese Versuche von Erfolg gekrönt. Geht man von der Partitur aus, handelt es sich keinesfalls um ein schlechtes Werk; es weist einige reizvolle Chöre und ein paar wirklich dramatische Momenten auf, auch wenn die Leitmotividee ein wenig überambitioniert erscheint.
Im Dezember desselben Jahres wurde Muirgheis (1903) von Thomas O’Brien Butler (1861-1915) uraufgeführt, ein Stück mit dem Untertitel „Die erste irische Oper“ mit Verweis auf sein irisches Libretto. Dies entpuppt sich freilich als eine von Thadgh O’Donoghue vorgenommene irische Übersetzung eines englischen Textes von Nora Cheeson und George Moore. Wahrscheinlich war zwar eine irischsprachige Aufführung geplant, doch da die erste (und einzige) Vorstellung auf Englisch gesungen wurde, geht die Ehre, die erste Oper auf Irisch zu sein, tatsächlich an O’Dwyers Eithne. Muirgheis löste eine hochgradig kontroverse Rezeption aus, die sich vor allem mit der Frage beschäftigte, ob die löbliche Idee einer irisch-keltischen Handlung im Einklang zu bringen sei mit einer vergleichsweise unreifen Musik.
Weder O’Dwyers Eithne (1909) noch die einaktige Oper The Tinker and the Fairy (1910, nach Douglas Hyde) von Michele Esposito (1855-1929) können der Unreife bezichtigt werden. Letztere wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls ein lohnendes Werk, das nach einer modernen Aufführung verlangte. Der produktivste Komponist keltizistischer Opern war gleichwohl Geoffrey Molyneux Palmer (1882-1957) mit Werken wie Finn Varra Maa (1917), Sruth na Maoile (1923), der komischen Oper Grania Goes (1924) und Deirdre of the Sorrows (1925), der ersten eines beabsichtigten „Cuchulainn-Zyklus“ von drei Opern, der indes aufgrund Palmers schlechtem Gesundheitszustand eingestellt werden musste. Sruth na Maoile war eine weitere vollwertige ernste Oper auf Irisch – und die letzte ihrer Art. Spätere Produktionen von Éamonn Ó Gallchobhair (1906-1982) während der 1940er und 50er Jahre gehörten einem eher leichten Typus an. Axel Klein (Übersetzung von Daniel Hauser)
.
.
Beide Artikel entnahmen wir mit sehr freundlicher Genehmigung der Autoren Gavan Ring und Axel Klein dem Programmheft zur konzertanten Aufführung der Oper 2017 in Dublin. Zu beziehen ist die neue CD (RTE lyric fm 2 CD 158) über den online-shop von rte-lyric und in ausgesuchten Geschäften. Abbildung oben:Edmund Blair Leighton „The End of The Song“ 1902 Wikipedia.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.



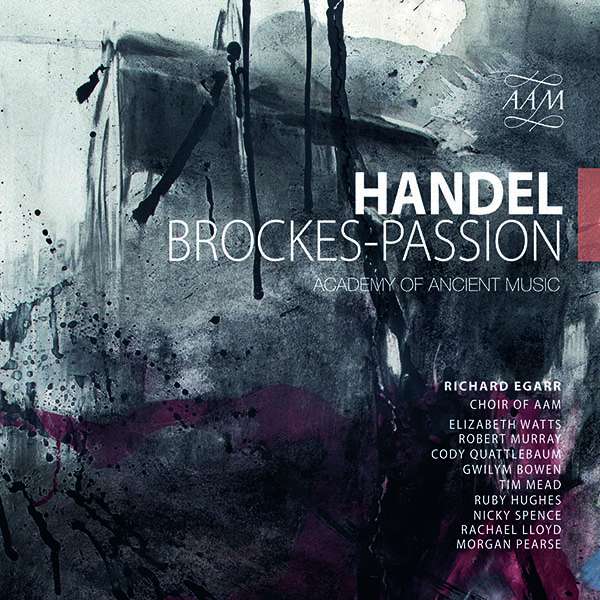


 Die Texte der Auswahl stammen von Victor Hugo, Alphonse de Lamartine und Théophile Gautier, doch auch weniger bekannte Autoren befinden sich darunter, etwa Pierre Barbier, der Sohn von Jules, und die Baronin de La Tombelle. Als Hausbariton von Palazzetto Bru Zane bringt
Die Texte der Auswahl stammen von Victor Hugo, Alphonse de Lamartine und Théophile Gautier, doch auch weniger bekannte Autoren befinden sich darunter, etwa Pierre Barbier, der Sohn von Jules, und die Baronin de La Tombelle. Als Hausbariton von Palazzetto Bru Zane bringt 
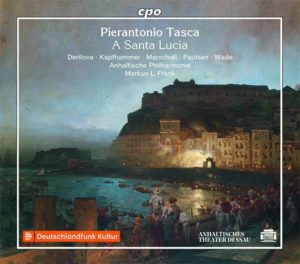 A Santa Lucia
A Santa Lucia






 Das fängt nicht gut an: Auf dem Cover dieser Neuerscheinung ist ein Gemälde zu sehen, das 1929 entstand. Gemalt hat es
Das fängt nicht gut an: Auf dem Cover dieser Neuerscheinung ist ein Gemälde zu sehen, das 1929 entstand. Gemalt hat es 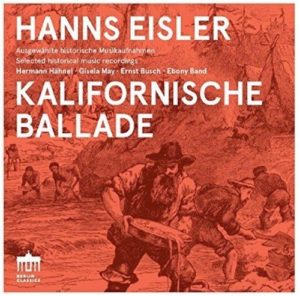
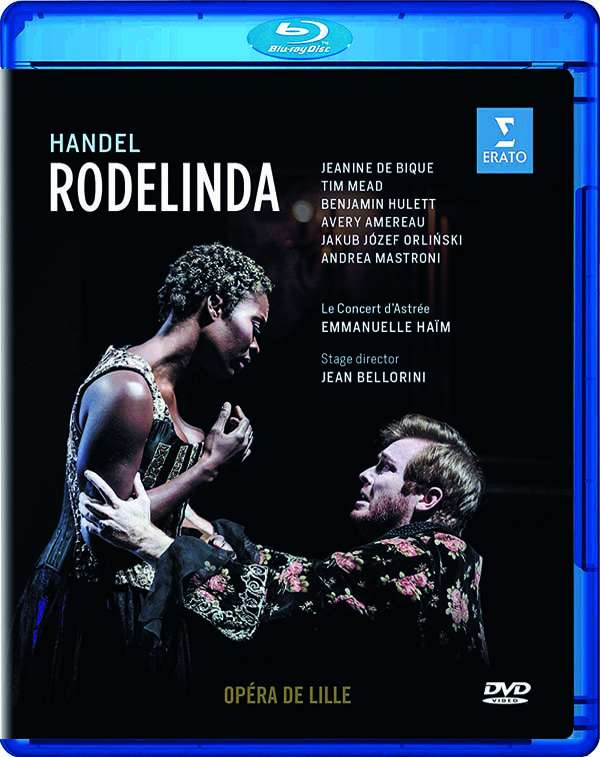


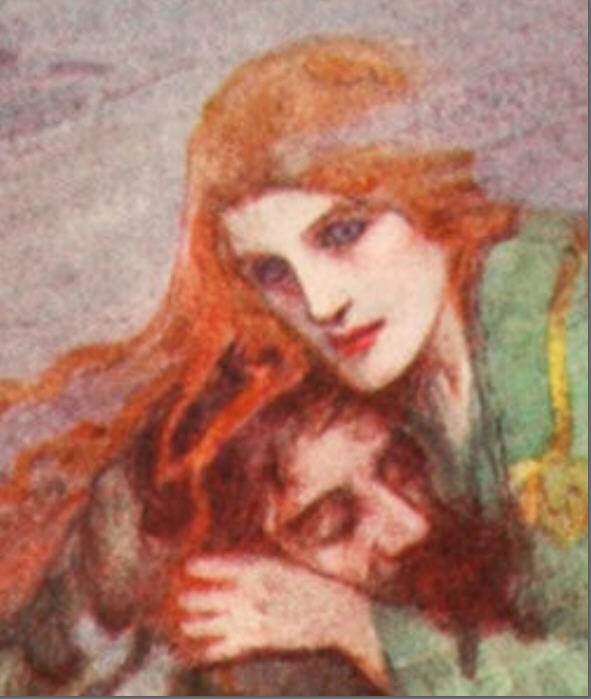








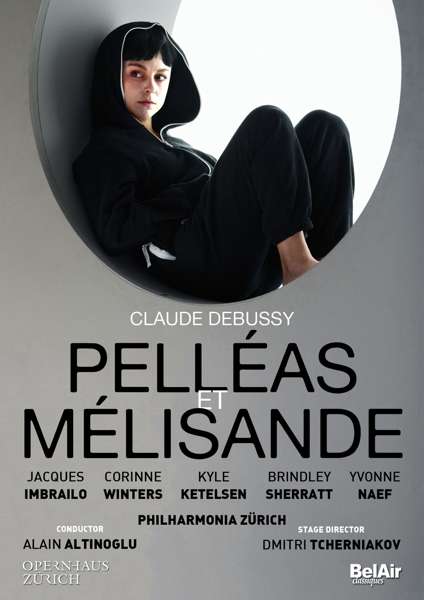



 Ein originelles Konzept erdachte der katalanische Countertenor
Ein originelles Konzept erdachte der katalanische Countertenor