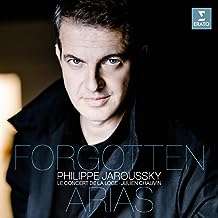.
Die Mezzosopranistin Katharina Kammerloher und der Pianist Johann Blanchard haben aus dem umfangreichem Liedschaffen der französischen Komponistin Cécile Chaminade eine Auswahl (bei MDG) zusammengestellt, die nun als Welt-Ersteinspielung vorliegt. Bei drei Liedern stand ihnen die Geigerin Jiyoon Lee, die erste Konzertmeisterin der Berliner Staatskapelle, zur Seite. Aufgenommen wurde schließlich im stilvollen Konzertsaal der Abtei Marienmünster, einem Ort, die sich für den audiophilen Anspruch des Labels Dabringhaus und Grimm besonders eignet. Stefan Pieper traf sich mit Katharina Kammerloher und Johann Blanchard, beide in Berlin lebend, zum Gespräch nach einem Videodreh im schmucken Palais Lichtenau in Potsdam.
.

Katharina Kammerloher und Johannes Blanchard im Konzert im Palais Lichtenau in Potsdam/Foto Martin Teschner/youtube
Wie sind Sie auf Cécile Chaminade aufmerksam geworden? Johann Blanchard: Ich kannte diese Komponistin schon vorher, mir lag das Notenmaterial vor. Diese Komponistin hat wahnsinnig viel geschrieben und ist danach weitgehend in Vergessenheit geraten. In Frankreich war sie sehr populär. Sie war zum Beispiel die erste Frau, die in die Ehrenlegion aufgenommen worden ist. Insgesamt hat sie circa 200 Klavierstücke komponiert. Ich habe übrigens schon eine Soloplatte gemacht mit ihr. Dass sie auch 150 Lieder geschrieben hat, hatte ich immer im Hinterkopf. Übrigens sind alle Lieder auf dieser CD Ersteinspielungen.
Frau Kammerloher, was bedeuten Ihnen diese Lieder? Ich habe Cécile Chaminade erst durch Johann kennengelernt. Als ich seine beiden CDs mit Klavier- und Kammermusik hörte, fing ich sofort Feuer. Während des Corona-Lockdowns hatte ich viel unverhofft freie Zeit und konnte mich so sehr intensiv in Chaminades umfangreiches Liedschaffen einarbeiten. Das Konzentrat aus dieser Arbeit sind die 22 Lieder dieser CD. Jedes eine Perle. Sie ist eine so feine Komponistin.
Es ist ja vielfach so, dass Komponistinnen und Komponisten auf ein einziges oder wenige bekannte Werke reduziert werden. K. K.: Ich habe früher Oboe studiert und genau diese Erfahrung habe ich bei diesem Instrument gemacht. Du bist eigentlich ständig gefordert, etwas Neues herauszusuchen. So verhält es sich ja auch bei vielen anderen Instrumenten, z.B bei der Bratsche. Dann habe ich Gesang studiert und ich war überwältigt von der Fülle, die sich hier auftut. Das kann man ja alles gar nicht in einem Sänger-Leben singen. Allein das Repertoire von Cécile Chaminade ist so umfangreich, dass wir ohne weiteres sofort eine weitere Platte aufnehmen könnten.
Handelt es sich bei Saison d’amour um einen Zyklus? K. K.: Nein, es handelt sich um meine eigene Zusammenstellung, die ich aufgrund der Texte getroffen habe. Ich finde, sie passen so gut zueinander, das sich wie von selbst eine Geschichte ergibt. Dabei trägt jedes einzelne Lied ja schon eine Geschichte in sich.

Die Komponistin Cécile Chaminade (* 8. August 1857 in Paris; † 13. April 1944 in Monte Carlo)/Wikipedia
Ein roter Faden ist ja wohl der starke Bezug zwischen jahreszeitlichen Impressionen und der Liebe. K. K.: Genau. Die Gedichte, derer sich Chaminade bedient, schöpfen voll aus dem Geist der französischen Romantik mit ihren starken Bezügen zur Natur, wie wir es ja auch in der deutschen Romantik wiederfinden. Oft ist die Rede vom Wald, vom Wind, vom Himmel, vom Meer und so weiter. Chaminade hat ein feines Gespür für Poesie und verleiht jedem einzelnen Gedicht seine ganz eigene, persönliche Tonsprache. Umso reizvoller war es für uns, durch den programmatischen Rahmen eine größere Einheit zu formen. Von zarten Trieben erster Liebe des Frühlings zum heißen, leidenschaftlichen Sommer, von den Verlusten des Herbstes bis hin zum Abschied und dem wehmütigen Rückblick des Winters, um zum Schluss, mit „Portrait“ den Frühling wieder auferstehen zu lassen.
J. B.: Die Zusammenstellung auf dieser CD macht eine große Vielfalt deutlich. Cécile Chaminade war unglaublich kreativ und alles hört sich sehr natürlich an. Sie muss auch eine sehr gute Pianistin gewesen sein.
K. K.: Ich höre schon so manchen Einfluss von Franz Schubert oder Robert Schumann heraus. Ich denke vor allem an ihre besondere Schlichtheit und Intimität, wenn es um die Aussagen eines Liedes geht. Ihr Ego stellte sie hintenan.
Mein erster Höreindruck der CD bestätigt diese Aussage. Mir kommt es so vor, dass sie eben nicht mit zu vielen exaltierten Gesten oder zu viel Dramatik auftrumpft. K. K.: Genauso ist es. Auch wenn mal Schubert oder Schumann oder auch mal etwas Debussy durchschimmert, bleibt sie immer bei sich selbst.
Kann man ihren Personalstil präzise einordnen? J. B.: Er ist auf jeden Fall der französischen Romantik zuzuordnen. Vielleicht in der Nähe zu Saint-Saens. Auf jeden Fall ist da mehr Leichtigkeit als bei den deutschen Romantikern. Es kann aber trotzdem genauso tiefsinnig sein.
J. B.: Die Musik klingt immer etwas silbrig von den Akkorden her. Und ja, wir haben uns für die Aufnahme sehr bemüht, es noch heller und noch silbriger hinzubekommen. Zuerst sind wir vielleicht etwas zu sehr von der deutschen Romantik an die Sache heran gegangen.
Was bedeutet Ihnen die Arbeit an einem solchen Liederprogramm in Ihrem sonstigen Alltag als vielbeschäftigte Opernsängerin? Gibt Ihnen das auch eine Art Ausgleich? K. K.: Was ich an so einem Liedprogramm liebe, ist die Autonomie. Ich kann alles allein zusammen mit meinem Pianisten erarbeiten. Es gibt keinen Regisseur, der mir Vorgaben macht, kein Dirigent gibt mir das Tempo vor. Johann und ich sind hier einfach unsere eigenen Chefs, wir entscheiden, wie wir es machen. Wir sind beide Suchende und lieben es, tief in eine Sache hinein zu gehen. Ich liebe am Lied einfach die Poesie. Diese hohe Kunst, in der großartige Texte in eine komprimierte musikalische Form gebracht werden. Cécile Chaminades Lieder sind ja oft regelrechte Mini-Opern. Ich mache das vor allem, weil ich einen großen Respekt vor der Kunst von Cécile Chaminade habe.
Cécile Chaminade muss ja wirklich eine markante und selbstbewusste Persönlichkeit gewesen sein und wurde auch so wahrgenommen. Was auch nicht selbstverständlich für Komponistinnen in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts war. K. K.: Es war damals wirklich nicht leicht für Frauen – die durften ja nicht mal ans Konservatorium. Cécile Chaminade hat Privatunterricht bekommen. Sie wuchs in einem wohlhabenden Haushalt auf. George Bizet ist bei der Familie regelmäßig ein und ausgegangen. Er hat schon früh ihr überragendes Talent erkannt hatte und sie „Le Petit Mozart“ genannt. Sie war ein unglaublich begabtes Kind und hat sich später als Komponistin durchgesetzt. Sie war Mitglied in einem Komponistenverband. Ebenso hat sie als fabelhafte Pianistin viele Konzerte in ganz Europa gegeben.

Katharina Kammerloher und Johannes Blanchard im Konzert im Palais Lichtenau in Potsdam/Foto Martin Teschner/youtube
J. B.: Was für eine Ausstrahlung Cécile Chaminade hatte, wird auch dadurch deutlich, dass sie in diversen Filmen und Serien, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, vorkommt. Allerdings wurde sie manchmal auch zu sehr als Salonkomponistin abgestempelt. Das trifft aber nicht die ganze Wahrheit. Sie hat vielseitige Musik für viele Menschen geschrieben. Und ihre Etüden und Sonaten sind pianistisch sehr anspruchsvoll.
Und damit haben Sie ja ganz viel erstaunliches Repertoire jenseits des Standardprogramms entdeckbar gemacht. K. K.: Wir wollten bewusst Repertoire aufnehmen, das es bislang noch nicht auf CD gibt. Man tut Komponistinnen und Komponisten ja auch Unrecht, wenn sie im Repertoirebetrieb immer auf eines oder wenige Werke reduziert werden. Ich habe das Gefühl, dass das heutzutage sogar noch viel mehr als früher der Fall ist. Viele Menschen sind weniger neugierig und oft werden Musikstücke nur nach Anzahl der Klicks im Internet ausgewählt. Aber wie soll man auf dieser Basis noch etwas Besonderes, eine wahre Perle entdecken? Das Interview führte Stefan Pieper
.
.
 Sollten etwa im Fahrwasser des mehr oder weniger eindringlichen Bemühens um die Gleichberechtigung der Frauen einschließlich Genderwahnsinns auch kaum oder gar nicht gewürdigte Komponistinnen zu Wort kommen bzw. zu Gehör gebracht werden? Gerade erschienen Auszüge aus den Schriften der englischen Musikerin Ethel Smyth, nun liegt eine CD mit Liedern der französischen Komponistin Cécile Chaminade mit dem Titel Saisons d’amour vor, die der Mezzosopran Katharina Kammerloher eingespielt hat. Gängige Meinung eines Teils der Musikwissenschaftler ist es, dass es einen weiblichen Mozart oder Beethoven nicht gibt, da Frauen daran gehindert wurden, ihr Talent, ja Genie zur Entfaltung zu bringen. Cécile Chaminade wurden keine derartigen Steine in den Weg gelegt, denn der Tochter aus wohlhabendem Pariser Hause wurde zwar nicht der Besuch des Konservatoriums gestattet, wohl aber der Privatunterricht in Komposition, Harmonielehre und Klavierspiel durch einige der renomiertesten Musiklehrer ihrer Zeit. Außerdem verkehrte im Salon ihrer Eltern das musikalische Paris. Bereits mit zwanzig Jahren trat sie öffentlich als Pianistin auf, sie war Mitglied der Société national de musique, die einige ihrer Werke aufführte, ihre Ballettmusik Callirhoe oder die opéra comique La Sévillane und andere Werke erreichten eine gewisse Bekanntheit, und warum sie sich zunehmend der kleinen Form, Klavierstücken und Lieder, widmete, lässt sich nur vermuten. Tatsache aber ist, dass ihre Stücke nicht nur im Konzertsaal, sondern besonders häufig bei Veranstaltungen mit Hausmusik aufgeführt wurden, das Booklet zur CD berichtet von L’anneau d’argent, der 200 000 Mal gedruckt wurde. Chaminade konzertierte nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, ihre Karriere wurde durch den Ersten Weltkrieg nicht nur unter-, sondern abgebrochen. Noch bis 1944 lebte sie zurückgezogen in Monte Carlo.
Sollten etwa im Fahrwasser des mehr oder weniger eindringlichen Bemühens um die Gleichberechtigung der Frauen einschließlich Genderwahnsinns auch kaum oder gar nicht gewürdigte Komponistinnen zu Wort kommen bzw. zu Gehör gebracht werden? Gerade erschienen Auszüge aus den Schriften der englischen Musikerin Ethel Smyth, nun liegt eine CD mit Liedern der französischen Komponistin Cécile Chaminade mit dem Titel Saisons d’amour vor, die der Mezzosopran Katharina Kammerloher eingespielt hat. Gängige Meinung eines Teils der Musikwissenschaftler ist es, dass es einen weiblichen Mozart oder Beethoven nicht gibt, da Frauen daran gehindert wurden, ihr Talent, ja Genie zur Entfaltung zu bringen. Cécile Chaminade wurden keine derartigen Steine in den Weg gelegt, denn der Tochter aus wohlhabendem Pariser Hause wurde zwar nicht der Besuch des Konservatoriums gestattet, wohl aber der Privatunterricht in Komposition, Harmonielehre und Klavierspiel durch einige der renomiertesten Musiklehrer ihrer Zeit. Außerdem verkehrte im Salon ihrer Eltern das musikalische Paris. Bereits mit zwanzig Jahren trat sie öffentlich als Pianistin auf, sie war Mitglied der Société national de musique, die einige ihrer Werke aufführte, ihre Ballettmusik Callirhoe oder die opéra comique La Sévillane und andere Werke erreichten eine gewisse Bekanntheit, und warum sie sich zunehmend der kleinen Form, Klavierstücken und Lieder, widmete, lässt sich nur vermuten. Tatsache aber ist, dass ihre Stücke nicht nur im Konzertsaal, sondern besonders häufig bei Veranstaltungen mit Hausmusik aufgeführt wurden, das Booklet zur CD berichtet von L’anneau d’argent, der 200 000 Mal gedruckt wurde. Chaminade konzertierte nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, ihre Karriere wurde durch den Ersten Weltkrieg nicht nur unter-, sondern abgebrochen. Noch bis 1944 lebte sie zurückgezogen in Monte Carlo.
Die seit vielen Jahren an der Berliner Staatsoper fest engagierte Katharina Kammerloher tat sich bereits des öfteren mit Liederabenden und Aufnahmen von Liedern hervor, und auch bei dieser CD zeigt sich die große Sorgfalt, mit der sie ihre Programme zusammenzustellen pflegt. So ergibt die Reihenfolge quasi eine Geschichte vom Erwachen der Liebe, dem Frühling, über Reifezeit und Welken in Sommer und Herbst bis hin zum Verlust, dem Winter. Die Texte stammen von zeitgenössischen Schriftstellern.
Bereits mit dem ersten Titel, Plaintes d’amour, fällt das schöne Ebenmaß der leicht androgyn klingenden Stimme auf, macht dem Hörer aber auch dir recht verwaschene, sich von Vokal zu Vokal hangelnde Aussprache zu schaffen. Schön wiegt die Stimme sich auf der Melodie, in Avril s’éveille überzeugt sie durch Frische und Beschwingtheit. Schön phrasiert wird in Fragilité, wo der beschriebene Zustand überzeugend vermittelt wird. Wie hingetupft wirken die Töne in Absence, bruchlos steigert sich die Sängerin, was die Lautstärke betrifft, während sie sich in Sérénade Sévillana vom Rhythmus tragen lässt. Voll jugendlicher Beschwingtheit ertönt der Mezzo in Madrigal, energischer und entschiedener und zugleich dunkler in Mon coeur chante, in L Été herrscht flirrender Übermut. Feine Melancholie überschattet Madeleine, die weiche Wehmut der Stimme wird in Chanson naive vom Piano umspielt.
Auch in einem langen Track wie La Fiancée du soldat kann die Spannung gehalten werden, in Roulis des gréves bleibt die Sägerin der Grundstimmung treu und variiert doch zugleich. Ein sehnsüchtiger Ruf nach verlorenem Glück ist Le beau chanteur, mütterliche Klänge werden in Avenir angestimmt, und ganz zart und liebevoll erklingt Jadis!.Infini gewinnt durch den Einsatz der Violine (Jiyoon Lee) noch an süßer Melancholie, einen schönen Jubelton gibt es für Portrait, und der durchweg einfühlsame Begleiter Johann Blanchard am Klavier zeigt hier noch einmal seine Qualitäten.
Das Booklet ist informationsreich in drei Sprachen und hilfreich durch die Liedtexte in Französisch und Englisch (MDG 908 2288-6). Ingrid Wanja



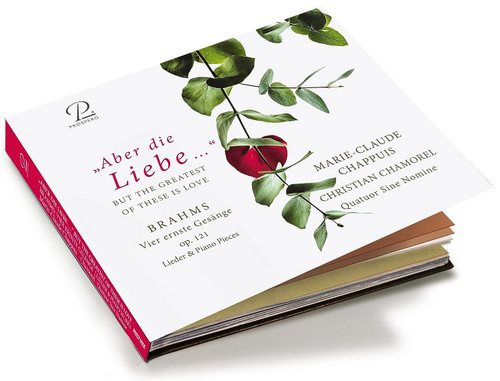 Die weit verbreitete Neigung zu Bearbeitungen ist fast so alt wie das letzte Liederwerk des Komponisten selbst.
Die weit verbreitete Neigung zu Bearbeitungen ist fast so alt wie das letzte Liederwerk des Komponisten selbst. 



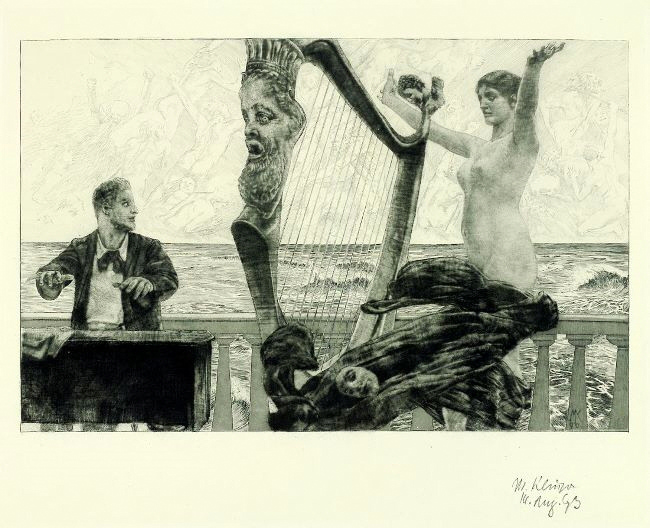


 Wenig bekannt, hatte Klemperer die Chöre der h-Moll-Messe bereits 1961 erstmals für EMI eingespielt, hier mit dem Philharmonia Chorus und dem Philharmonia Orchestra. Die Erstveröffentlichung war erst Jahrzehnte später beim Label Testament erfolgt. Hier nun folgt eine Wiederauflage, die zum Vergleichen anregt. Tempomäßig gibt es kaum Unterschiede, jedoch ist der Klang sechs Jahre früher hörbar unterlegen, so dass dieser Bonus eher von historischem Interesse bleibt und der Gesamtaufnahme keine wirkliche Konkurrenz machen kann. Ungleich berühmter wurde bereits seinerzeit Klemperers Einspielung der
Wenig bekannt, hatte Klemperer die Chöre der h-Moll-Messe bereits 1961 erstmals für EMI eingespielt, hier mit dem Philharmonia Chorus und dem Philharmonia Orchestra. Die Erstveröffentlichung war erst Jahrzehnte später beim Label Testament erfolgt. Hier nun folgt eine Wiederauflage, die zum Vergleichen anregt. Tempomäßig gibt es kaum Unterschiede, jedoch ist der Klang sechs Jahre früher hörbar unterlegen, so dass dieser Bonus eher von historischem Interesse bleibt und der Gesamtaufnahme keine wirkliche Konkurrenz machen kann. Ungleich berühmter wurde bereits seinerzeit Klemperers Einspielung der 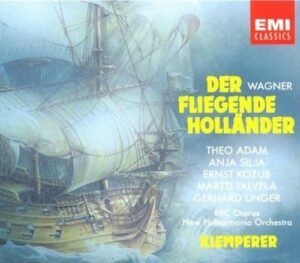 Chronologisch am nächsten sind Klemperers Einspielungen diverser
Chronologisch am nächsten sind Klemperers Einspielungen diverser  Seit langem bewährte Klassiker stellen Klemperers Einspielungen von
Seit langem bewährte Klassiker stellen Klemperers Einspielungen von  Lediglich der erste Aufzug der
Lediglich der erste Aufzug der  Abgerundet wird die Box durch zwei Dokumentationen, zum einen
Abgerundet wird die Box durch zwei Dokumentationen, zum einen 

 Klemperers kaum mehr für möglich gehaltener
Klemperers kaum mehr für möglich gehaltener  Freilich ist eine allzu pauschale Reduzierung des greisen Klemperer auf seine
Freilich ist eine allzu pauschale Reduzierung des greisen Klemperer auf seine  Eine lebenslange Hingabe des Dirigenten galt
Eine lebenslange Hingabe des Dirigenten galt  Vorspiele, Ouvertüren und sonstige Orchestermusik aus den Werken
Vorspiele, Ouvertüren und sonstige Orchestermusik aus den Werken  Auch
Auch  Bei all der überreichlichen Fülle geht darüber beinahe unter, dass
Bei all der überreichlichen Fülle geht darüber beinahe unter, dass 




 Sollten etwa im Fahrwasser des mehr oder weniger eindringlichen Bemühens um die Gleichberechtigung der Frauen einschließlich Genderwahnsinns auch kaum oder gar nicht gewürdigte Komponistinnen zu Wort kommen bzw. zu Gehör gebracht werden? Gerade erschienen Auszüge aus den Schriften der englischen Musikerin
Sollten etwa im Fahrwasser des mehr oder weniger eindringlichen Bemühens um die Gleichberechtigung der Frauen einschließlich Genderwahnsinns auch kaum oder gar nicht gewürdigte Komponistinnen zu Wort kommen bzw. zu Gehör gebracht werden? Gerade erschienen Auszüge aus den Schriften der englischen Musikerin 


 Die beiden Arien des Cavaradossi lassen ein Recondita armonia hören, das ganz auf ein wahrhaft geschmettertes Tosca sei tu hinarbeitet und ein Lucevan le stelle mit schönem Parlando vor Beginn der Arie, mit recht erfolgreichem Bemühen um die für diese Arie so wichtige Agogik, die dann doch wieder abgelöst wird von einem nur auf Überwältigung zielenden Schluss.
Die beiden Arien des Cavaradossi lassen ein Recondita armonia hören, das ganz auf ein wahrhaft geschmettertes Tosca sei tu hinarbeitet und ein Lucevan le stelle mit schönem Parlando vor Beginn der Arie, mit recht erfolgreichem Bemühen um die für diese Arie so wichtige Agogik, die dann doch wieder abgelöst wird von einem nur auf Überwältigung zielenden Schluss.
 Unangemessen mutet heute der Text zu Schumanns Zyklus an und dürfte Feministinnen auf die Barrikaden treiben, nachdem bereits Storm und Mörike die Chamisso-Gedichte peinlich fanden. Bonstridge möchte den Zyklus bald selbst singen, wäre damit aber nicht der erste Sänger, und leitet die Berechtigung dazu unter anderem daraus ab, dass Schumann hin- und hergerissen war zwischen männlichem Überlegenheitsgefühl und dem Bewusstsein, gegenüber seiner Gattin der geistig und künstlerisch Unterlegene zu sein. Das bringt den Autor dazu, in Robert Schumann selbst den Protagonisten des Zyklus‘ zu sehen, woraus zwangsläufig das Vorhaben erwächst, nach Matthias Goerne und Roderick Williams nun selbst diese Lieder zu singen. Mit der Überschreitung der Geschlechtergrenzen hätten allerdings Tenöre und Baritone viel weniger Neuland zu betreten als Sängerinnen mit der Eroberung von Schöner Müllerin und Winterreise.
Unangemessen mutet heute der Text zu Schumanns Zyklus an und dürfte Feministinnen auf die Barrikaden treiben, nachdem bereits Storm und Mörike die Chamisso-Gedichte peinlich fanden. Bonstridge möchte den Zyklus bald selbst singen, wäre damit aber nicht der erste Sänger, und leitet die Berechtigung dazu unter anderem daraus ab, dass Schumann hin- und hergerissen war zwischen männlichem Überlegenheitsgefühl und dem Bewusstsein, gegenüber seiner Gattin der geistig und künstlerisch Unterlegene zu sein. Das bringt den Autor dazu, in Robert Schumann selbst den Protagonisten des Zyklus‘ zu sehen, woraus zwangsläufig das Vorhaben erwächst, nach Matthias Goerne und Roderick Williams nun selbst diese Lieder zu singen. Mit der Überschreitung der Geschlechtergrenzen hätten allerdings Tenöre und Baritone viel weniger Neuland zu betreten als Sängerinnen mit der Eroberung von Schöner Müllerin und Winterreise.