.
Als ich zum ersten Mal hörte, dass Cherubini einen Ali-Baba komponiert hat, kam mir das so vor, als gäbe es von Wagner einen Gestiefelten Kater. Ich Kleingläubiger. Und nun zeigt die Scala in Mailand das Werk nach 55 Jahren Pause wieder (Première am 1.9., besuchte Vorstellung am 9.9.) – wie schon 1963 in italienischer Übersetzung. Denn auch Cherubinis letzte Oper ist natürlich für Paris entstanden, 1833, unter Verwendung des 40 Jahre zuvor komponierten Materials seines unvollendeten Koukourgi. Ursprünglich war Ali-Baba für die Opéra Comique gedacht, aber Cherubini begann, dem künstlerischen Niveau des Hauses zu misstrauen, arbeitete atypisch langsam an der Oper und brachte sie schließlich an der Académie Royale de Musique (vulgo: der Opéra) unter. Und so kommt es, dass Ali-Baba als komische Oper Cherubinis längste geworden ist (2h 15 reine Spielzeit in Milano), keine Sprechteile enthält, dafür aber aus der Grand Opéra bekannte Elemente wie große Chorszenen oder zwei Ballette enthält.
Cherubinis Verhältnis zu seinem musikdramatischen Nesthäkchen scheint zumindest durchzogen gewesen zu sein: Er wohnte der Generalprobe bei, aber keiner der elf Aufführungen. Halévy berichtet in seinen Mémoiren, der Komponist habe über die Oper gesagt: „Sie ist zu alt für ein langes Leben – sie ist schon vierzigjährig zur Welt gekommen.“ Und in der Tat – nach drei Produktionen in den 1830erjahren in Deutschland blieb Ali-Baba bis zur erwähnten Scala-Serie von vier Aufführungen 1963 ungespielt; 2010 gab’s an der Opéra du Rhin eine auf eine knappe Stunde gekürzte Kinderopernversion, in der sich das Werk nur schemenhaft erahnen ließ. Die Aufnahme der Uraufführung, wie man aus dem ausgesprochen gelungenen Programmheft der Scala erfährt, war so negativ auch wieder nicht; allgemein wurde offenbar die Produktion sehr gelobt, die mit einer Starbesetzung prunken konnte (darunter Rossinis Erfolgstenor Adolphe Nourrit und die nachmals legendäre Marie-Cornélie Falcon noch in der Dienerinnenrolle), während die Musik (wie auch 1963) eher lauwarm aufgenommen wurde. Einerseits wurde sie als altmodisch empfunden; Mendelssohn andererseits bemängelte, dass Cherubini dem leichten Grundton lärmige Schlüsse und dramatische Wendungen nach Manier der aufkommenden Grand Opéra aufgepfropft habe. Auch „eine komische Oper, der es von Anfang bis Ende an Komik mangelt“ konnte man in einer Rezension von 1963 lesen.
.

Cherubinis „Ali Baba“ an der Mailänder Scala/ Szene/ Foto wie auch oben © Marco Brescia & Rudy Amisano Teatro alla Scala
Ich konnte diese Vorbehalte im Verlaufe des Abends zwar nachvollziehen, aber dennoch hinterließ die (von Strasbourg abgesehen) Erstbegegnung mit Ali-Baba bei mir einen richtig guten Eindruck. Zwar hab ich hinterher keine Melodie daraus auf der Straße gesummt (pfeifen kann ich ohnehin nicht), aber ich habe eine beschwingte, abwechslungsreiche Oper gehört, deren Musik in ihren Stimmungen und Umschwüngen der Handlung folgt. In dramatischen und bedrohlichen Momenten, die es in dem nicht so harmlosen Märchen ja durchaus gibt, erinnert man sich leicht daran, dass die Medea vom selben Komponisten stammt, ansonsten herrscht ein anderer, heiterer Stil vor. Auch scheint mir (ich bin freilich kein Spezialist fürs frühe 19. Jahrhundert), dass das Stück sich stilistisch im Umfeld von Auber oder Lortzing gar nicht so fremd und altmodisch ausmacht. In formaler Hinsicht finde ich es sogar verblüffend modern für seine Zeit: Es gibt außer je einer Arie für den Tenor im Prolog und einer sehr schönen für den Sopran im 3. Akt kaum Solonummern (eine Soloszene für den Titelhelden in der Schatzhöhle, die das Modell Cavatina-Caballetta noch durchschimmern lässt). Der Rest besteht größtenteils aus ineinander übergehenden Duo- bis Ensembleszenen als Bauteilen, ist also eher schon durchkomponiert. Wie hier längere Szenen musikdramaturgisch gebaut sind, ist überraschend nahe etwa bei Teilen von Falstaff oder beim Momusakt der Bohème, bei allen stilistischen Unterschieden. So kommt auch die Handlung meist effizient voran, obgleich retardierende Momente wie die Ballette vorhanden sind. Besonders originell ist der Beginn des 3. Aktes in der Schatzhöhle: Ein Trio dreier Räuber, die im Schlaf sprechen (fast muss man an die Turandot-Minister denken – ist es Zufall, dass einer der Räuber – Calaf heißt?).
.
Das Libretto unterscheidet sich von der bekannten Geschichte in einigen Punkten. Mélesville und (natürlich) Scribe haben den Märchenhelden Ali Baba aufgeteilt: Der arme verliebte junge Mann, der per Zufall Zeuge der Zauberhöhlenöffnung wird, heißt Nadir und ist selbstverständlich Tenor. Ali-Baba ist Bass, reicher Händler und der Vater von Nadirs geliebter Delia. Erst als Nadir urplötzlich sagenhaft reich ist, willigt Ali-Baba in die Heirat ein – jedenfalls vorübergehend, denn eigentlich wollte er Delia dem Zollkommandanten Aboul-Hassan zur Frau geben, damit der beim Kaffeeschmuggel des Schwiegervaters beide Augen zudrückt. In der Oper ist es also Ali-Baba, der Nadir das Geheimnis abringt und bei seinem Eindringen in die Schatzhöhle das Zauberwort vergisst (und den Zettel, auf dem er es notiert hat, als Fackel anzündet). Anders als den gierigen Stiefbruder im Märchen bringen ihn die heimkehrenden Räuber aber nicht um, sondern „begleiten“ ihn in seinen Palast zu seinen Schätzen. Am Ende bleibt doch etwas von der originalen Brutalität erhalten: Die Räuber lassen sich in Kaffeesäcken in den Palast schmuggeln – Aboul-Hassan rächt sich aus Wut darüber, dass er Delia nicht heiraten kann, indem er diese Säcke als vermeintliche Schmuggelware verbrennt.

Cherubinis „Ali Baba“ an der Mailänder Scala/ Szene/ Foto wie auch oben © Marco Brescia & Rudy Amisano Teatro alla Scala
Für die diesjährige Opernproduktion der Accademia Teatro alla Scala wurde mit Liliana Cavani wieder eine renommierte Regisseurin engagiert, die die Rarität librettogetreu, mit dichter, frischer Personenregie weitgehend frei von leeren Posen inszeniert hat. Ein Coup gelingt ihr schon bei der Ouvertüre – da hebt sich der Vorhang über einem altehrwürdigen Bibliothekslesesaal, grüne Pultlampen inclusive, drei heutige Studenten in Studien vertieft (nachmals Nadir, Ali-Baba und Aboul-Hassan), bis der Auftritt einer Studentin (Delia) Unruhe in den Raum bringt. Nadir liest „Ali Baba“, was ihr Interesse weckt. Die folgenden vier Akte samt Prolog spielen dann in zeitlos orientalischer Kulisse (nur die Höhle ist ein geheimnisvoller perlweißer Würfel in der Wüste, der Sesam-Mechanismus also von Menschenhand). Allen diesen Bühnenbildern von Leila Fteita ist ihre große Schönheit gemeinsam, ich konnte mich nicht satt sehen – und die Kostüme von Irene Monti stehen ihnen nicht nach. Der Bogen zur Bibliothek ist geschlagen, wenn am Ende das junge Paar in heutiger Kleidung auf dem Motorrad ins neue Glück davon fährt. Einzig der letzte Akt weist ein paar kleinere Längen und lose Enden auf – das zweite Ballett ist aber immerhin kurz und hier mit Wassermelonen erfrischend gestaltet. Was genau mit den drei Chefräubern geschieht, die nicht in den Säcken waren, blieb für mich unklar, sie gehen links ab, aber ob sie gefasst werden, konnte man zumindest von meinem Platz aus nicht sehen.
.
Angemessen im Zentrum des spielfreudigen Ensembles (mit Ausnahme von Aboul-Hassan die Alternativbesetzung zur Première) steht Paolo Ingrasciotta als liebenswürdiges Schlitzohr Ali-Baba, dessen Geldgier seiner Intelligenz gern ein Bein stellt – wenn er z.B. selbst unter Todesgefahr den Räubern noch den mittellosen Familienvater vorzuspielen versucht. Ausgesprochen natürliches Spiel reich an richtig dosierten kleinen Gesten und nie aufgesetzter Komik verbindet sich mit einem warmen, kantabel und wendig geführten Bass von guter Diktion zu einem überaus gelungenen Rollenportrait. Ebenbürtiger Buffopartner ist ihm Eugenio di Lieto als Aboul-Hassan, der den Kontrast zwischen der Autorität seiner Uniform und seinen persönlichen Missgeschicken und -erfolgen köstlich ausspielt – ist einer von den beiden auf der Bühne, ist er das Zentrum des Geschehens, sind sie beide da, sprühen die Funken zwischen ihnen, höchst vergnüglich! In der Höhe wirkt Di Lietos ebenfalls schöntimbrierter Bass noch etwas hohl-dröhnend, was aber auch nicht weiter stört.
Enkeleda Kamani ist Delias großer Arie als Gefangene der Räuber sowohl musikalisch-technisch als auch im Ausdruck gewachsen und führt ihren leuchtenden Sopran auch sonst souverän durch die Partie. Sowohl dem ausgeglichenen Timbre als auch der Figur kann sie genug Biss beimischen, dass die Tochter und Geliebte im Geschehen präsent bleibt – das Libretto gäbe ihr eben abgesehen von der verzweifelten Arie eher wenig Profil oder gar Gelegenheit zur Komik, diese Sängerin weiß sich da aber zu helfen und erfreut darstellerisch schon im Bibliotheksvorspiel.
Hun Kim gefällt als ihr geliebter Nadir mit hellem, zwar nicht farbenreichem, aber schön gerundetem Tenor, den er mit der geforderten Virtuosität, aber auch mit berührendem Ausdruck führen kann; einzig in der unteren hohen Lage büßt der Klang gelegentlich etwas an Stabilität ein, die Extremhöhe sitzt aber wieder sicher und mit Schmelz. Besonders zu loben ist die gute Verständlichkeit. Szenisch ist er so liebenswert und witzig, dass man Delia gut verstehen kann, wenn sie ihn dem traditioneller „männlichen“ Aboul-Hassan vorzieht; den Niedergeschlagenen spielt er mit einer feinen Balance aus Komik und Schmerz, den Entschlossenen nimmt man ihm auch ab. Einzig im 2. Akt beim Aufruf zur Befreiung seiner Geliebten fehlt es ihm vielleicht etwas an Körperspannung – aber er glaubt da ja auch noch, sie sei nur von Aboul-Hassan entführt worden, nicht von den Räubern.
Auch wenn die Rollen unterschiedlich groß sind, kann doch jeder und jede wenigstens ein-, zweimal die Stimme zeigen. Docente preparatore della compagnia di canto ist, nach Beendigung ihrer eigenen großen Karriere, Luciana D’Intino, und das Niveau der diesjährigen Accademia ist zweifellos ausgezeichnet.
Unter den Räubern hat Rocco Cavalluzzi das nötige Charisma für den Hauptmann Ours-Kan und einen entsprechend potenten Bass, der nur in der Höhe etwas aus dem Fokus rutschen kann; ausgezeichnet auch seine beiden Adlaten, der baumlange Thamar von Gustavo Castillo, der mit seinem spektakulären schwarzen Bass verblüffend mühelos in die sehr hohen Regionen des Sesamo, apriti steigt, und der kleinere Chuan Wang als schmieriger Calaf mit präsentem Tenor und vor allem lebendigem Spiel, dem es auch gelingt, seine wankende Loyalität Ours-Kan gegenüber plastisch auszuspielen. Marika Spadafino bringt rollendeckend als Delias Sklavin Morgiane herbere Töne und engagiertes Spiel ein; am wenigsten zu singen hat Ramiro Maturana als Majordomus Phaor, aber auch das klingt gut. Der Coro dell’accademia Teatro alla Scala unter Alberto Malazzi ist ebenfalls eine Hörfreude und hat (wenigstens die Männer) einen Umzugsbonus verdient.
Auch das Orchester setzt sich aus Mitgliedern der Accademia zusammen, was mir erst bei der nochmaligen Besetzungslektüre nach der Aufführung aufgefallen ist. Paolo Carignani am Pult führt mit ihnen ein beredtes Plaidoyer für die Musik, betont die abwechslungsreiche Instrumentation (inclusive dezenter Orientalismen wie dem Triangel) und begleitet in der Regel sorgsam die Sängerinnen und Sänger; die Ouvertüre kommt hier schon als Überwältigungsstrategie daher, schmissig und straff-brillant – was mir dabei (und das gilt für den ganzen Abend) aber etwas auf der Strecke zu bleiben scheint, ist Eleganz, die Cherubinis Musik, so scheint mir, auch besäße. Sei’s drum, so bleibt für ein nächstes Theater, das sich das Stück vornimmt, noch Verbesserungspotential. Samuel Zinsli
.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.







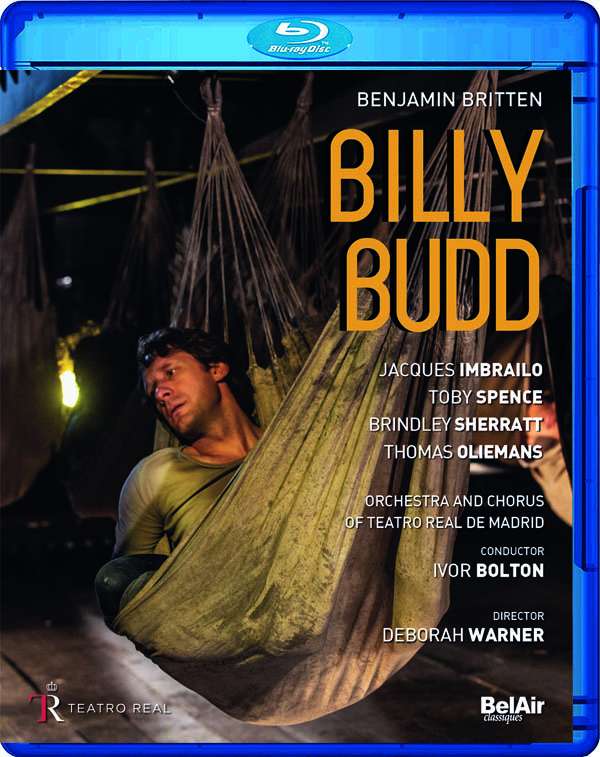

 Gibt es auf Flemings Platte einen Duettpartner, hat Bryn Terfel auf seiner neuen CD
Gibt es auf Flemings Platte einen Duettpartner, hat Bryn Terfel auf seiner neuen CD 
























