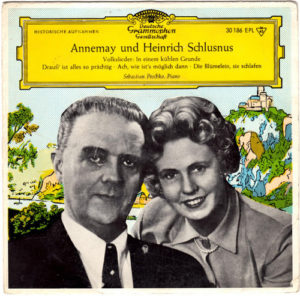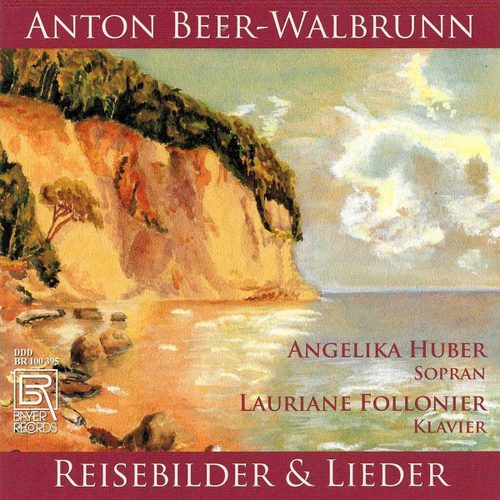.
Wieder einmal widmete sich das Münchner Rundfunkorchester einem ebenso seltenen wie verdienstvollen Operntitel in einer konzertanten Aufführung im Mai 2019. Diesmal – nach Ausflügen in die französische Opernwelt jüngst beim Palazetto Bru Zane dokumentiert und nach Bruchs Loreley (bei cpo) sowie anderen Werken – dirigiert Ivan Repusic die Komische Oper Ero der Schelm (Originaltitel kroatisch Ero s onoga svijeta) von Jakov Gotovac (* 11. Oktober 1895 in Split – † 16. Oktober 1982 in Zagreb/ Uraufführung am 2. November 1935 im Kroatischen Nationaltheater Zagreb unter der Leitung des Komponisten). Es sangen in München erwartungsgemäß kroatische Kräfte: Valentina Fijačko Kobić, Sopran (Djula), Jelena Kordić, Mezzosopran (Doma), Tomislav Mužek, Tenor (Ero) Ljubomir Puškarić, Bariton (Mlinar Sima), Ivica Čikeš, Bass (Gazda Marko), der Kroatische Rundfunkchor, als Bayerisches Kind der Knabensopran Christoph Immler und das Ganze eben unter Ivan Repušić am Pult des Münchner Rundfunkorchesters.
.
Was für eine Ehrenrettung dieses nur gelegentlich im Ausland aufgeführten Komponisten, dessen heitere Oper sich ein-zweimal in deutschen Rundfunkarchiven findet (Liane Synek und andere machten sich darüber her), und der auch im heimischen Kroatien nur mit zwei älteren Einspielungen und einem TV-Film vertreten ist, wenngleich Ero an der Adria so etwas wie eine Nationaloper ist und von Split über Zagreb bis Rijeka gern gespielt wird, in buten Kostümen namentlich vor Touristen. Ich erinnere mich an Aufführungen im schönen Helmer & Fellner-Opernhaus von Zagreb, an einen bunte, sehr folkloristisch ausgestattete Darbietung noch zu Tito-Zeiten. Mütterliche, stark gebaute Damen in teppichartigen Folklore-Bekleidungen trugen an einer wippenden Bambusstange Maiskolben über die Bühne, mehrfach. Verstanden hatten wir gar nichts, aber es war ein unvergesslicher Abend. Die Fotos jüngerer kroatischer Aufführungen deuten auf eine ungebrochene Stilistik der bunten Teppiche und prallen Dorfszenen bis heute hin.
Gotovac ist neben Ivan Zajc der große nationale Komponist Kroatiens, wie Florian Heurich im nachstehenden Artikel ausführt (den wir mit großem Dank an den Autor und das Müncher Rundfunkorchester aus deren Programmheft für die konzertante Aufführung im Mai 2019 entnommen haben). Und es ist gut und richtig, dass wir uns nicht nur dem internationalen, zu sattsam bekannten Opernkanon widmen, sondern eben auch die Musik unserer europäischen Nachbarn kennen lernen und ehren. „Mehr davon!“, ruft der begeisterte Europäer. G. H.
.
.

„Ero s onoga svijeta“/ Szene aus der Aufführung am Kroatischen Nationaltheater Zagreb/ Foto HNK/ Mara Bratos/ Foto oben Szene aus der gleichnamigen Oper in Split/ HNS Split
Ein Wort zum Erwachen des kroatischen Bewusstseins: Das Phänomen einer nationalen Schule in der Musik ging in Kroatien einher mit einer allgemein nationalkroatischen Bewegung in Literatur, Kunst und Kultur, der sogenannten Illyrischen Bewegung. Zur Zeit der k. und k. Herrschaft wandte man sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert etwa durch Dichtung in der eigenen Sprache gegen eine Dominanz des Deutschen bzw. des Ungarischen in der Kultur, die durch das Habsburgerreich kam. 1840 wurde in Zagreb die erste Illyrische Musikgesellschaft gegründet, mit dem Ziel, die kroatische Musik auf akademischer Ebene zu fördern. Im Bereich der Oper schuf der Komponist Vatroslav Lisinski daraufhin mit Ljubav i zloba (Liebe und Arglist, 1846) das erste Musiktheaterwerk in kroatischer Sprache, eine in Split spielende Liebesintrige mit einer noch weitgehend vom italienischen Stil geprägten Musik. Als eigentliche Nationaloper schrieb schließlich Ivan Zajc 1876 mit Nikola Šubić Zrinjski ein historisches Werk über den gleichnamigen Freiheitshelden, der im 16. Jahrhundert gegen die türkischen Belagerer kämpfte − eine Oper, in der nun auch musikalisch ein nationales Idiom realisiert wurde. 1860 wurde das Kroatische Nationaltheater in Zagreb gegründet, 1870 die dazugehörende Opernkompanie, deren Leiter Zajc wurde.

„Ero der Schelm“/ Plakat für das Gastspiel der Zagreber Oper in Berlin 1943/ Klasika.hr/ Marija Barbieri
Jakov Gotovac setzte diese mit Lisinski begonnene und mit Zajc gefestigte Strömung der kroatischen Nationalmusik in der nächsten Generation fort, zu einer Zeit, als das Nationale jedoch nicht mehr als Abgrenzung von fremden kulturellen Einflüssen verstanden wurde (die k. und k. Herrschaft auf dem Balkan war mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen), sondern als Identitätsmerkmal des neuen Jugoslawien. Hier wurde gerade eine Musik mit ausgeprägten Volksmusikelementen und nationalen Themen besonders gefördert und oft auch ideologisch aufgeladen im Sinne einer Einheit stiftenden Größe. Dank ihres folkloristischen Einschlags, der auf die Klangsprache des 20. Jahrhunderts trifft, haben sich indessen viele dieser Werke bis heute ihre emotionale Überzeugungskraft bewahrt und sind lohnende Entdeckungen in einem weitgehend unbekannten Repertoire.
Als einer der wichtigsten Komponisten des früheren Jugoslawien hat der Kroate Jakov Gotovac mit Ero der Schelm (Originaltitel kroatisch Ero s onoga svijeta) eine Oper geschaffen, die schon bei ihrer Uraufführung 1935 am Kroatischen Nationaltheater Zagreb vom Publikum begeistert aufgenommen wurde und die dann zu einer Art kroatischen Nationaloper geworden ist. Mit inzwischen über 700 Aufführungen ist Ero der Schelm immer noch im Repertoire des Zagreber Opernhauses und steht regelmäßig auf dem Spielplan. Das Sujet, eine heitere Episode aus dem ländlichen Leben in Dalmatien, die bauernschlaue Hauptfigur, ein Volkstypus dieser Region, und Gotovacs Musik voller Lokalkolorit, voller Melodien und Rhythmen des Balkans haben zur großen Popularität dieser Oper vor allem in Osteuropa, aber auch weit darüber hinaus beigetragen.

„Ero s onoga svijeta“/ Szene mit Josip Gosic und Sonja Mottl-Dula 1957 / Foto Klasika.hr/ Marija Barbieri
Jakov Gotovac wurde am 11. Oktober 1895 in Split in Dalmatien geboren. Auf Wunsch seines Vaters musste er zunächst Recht studieren, ging dann aber im Alter von fünfundzwanzig Jahren nach Wien und nahm sein Musikstudium bei dem Komponisten und Pädagogen Joseph Marx auf. Seine musikalische Karriere begann in Šibenik an der kroatischen Adriaküste, wo er in der dortigen Philharmonischen Gesellschaft tätig war. 1923 wurde er als Dirigent an die Oper von Zagreb berufen, wo er bis 1957 blieb; daneben leitete er mehrere der in Zagreb beheimateten Chorgesellschaften und Gesangsvereine. Jakov Gotovac starb im Jahr 1982 in Zagreb, sein Leben umspannt also die Zeit von der ausgehenden k. und k. Herrschaft auf dem Balkan über das Königreich Jugoslawien zwischen den beiden Weltkriegen bis hin zum sozialistischen Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg.
Gotovacs erste Werke sind Lieder und Chorkompositionen, in denen sich schon eine stark nationale Note zeigt. Diese setzt sich in seinen Orchesterstücken wie etwa einem Symphonischen Kolo fort. Der Kolo ist ein typischer Reigentanz des Balkans und zugleich einer der Rhythmen, die in Ero der Schelm eine zentrale Rolle spielen. Auch Gotovacs weitere Bühnenwerke schöpfen aus dem Volksleben und der Geschichte des Balkans und insbesondere Kroatiens, etwa seine Musik zu der Pastorale Dubravka (1928) des kroatischen Barockdichters Ivan Gundulić, seine Oper Morana (1930) nach einer bosnischen Volkslegende, die tragische Oper Kamenik (Der Steinbruch, 1946), das historische Musikdrama Mila Gojsalića (1951) über eine kroatische Volksheldin und Märtyrerin während der Türkenherrschaft auf dem Balkan, das Singspiel Đerdan (Die Halskette, 1954/1955), die Opernlegende Dalmaro (1958) und der Einakter Stanac (Ein harter Felsen, 1959).

Mit seinem Nationalstil in Musik und Inhalt traf Gotovac genau den Trend, der das Musikleben des Landes seinerzeit beherrschte. Sowohl während des Königreichs Jugoslawien als auch während der sozialistischen Republik Jugoslawien waren die Künste stark national geprägt, nicht zuletzt um eine Einheit dieses Vielvölkerstaates zu suggerieren. In seiner Kompositionsweise fügt sich Gotovac jedoch nahtlos in die Linie der nationalen Schulen ein, wie sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts gerade die osteuropäische Musik prägten. Was in Russland mit Glinka und Borodin oder in Tschechien mit Smetana begonnen hatte und dann von Dvořák und Janáček weitergeführt wurde, setzte Gotovac sozusagen in dritter Genration in seinem eigenen Land fort. Insbesondere mit Janáček verbinden ihn einige Charakteristika in der Klangsprache, etwa wenn gerade durch den Rückgriff auf die alte Folklore ein Weg in die Moderne gewiesen wird. Allerdings werden von Gotovac die kroatischen Melodien und Rhythmen wesentlich direkter zitiert und in die Werke eingearbeitet als bei seinem tschechischen Kollegen. In Bezug auf Ero der Schelm liegt aber auch der Vergleich mit Smetanas Verkaufter Braut nahe, obschon die beiden Werke rund siebzig Jahre auseinanderliegen. In beiden Stücken geht es darum, wie im bäuerlichen Milieu ein listiger Mann durch einen Trick seine Geliebte für sich gewinnen und alle anderen überlisten kann. Sehr ähnlich sind Schauplatz, Figurenspektrum und die musikalische Milieuschilderung.

„Ero s onoga svijeta“/ Szene aus dem Film 1982/ OBA
Gerade in Gotovacs Bühnenwerken zeigt sich ein breites inhaltliches Spektrum, das von literarischen Quellen über historische Epen bis hin zu Volksdichtung, Legenden und heiteren Schwänken reicht. Dadurch bringt er Kultur, Brauchtum und Geschichte seines Landes in vielen verschiedenen Facetten und Ausformulierungen auf die Bühne. Dies spiegelt sich auch in einer großen musikalischen Bandbreite von einfachen Liedformen und Tänzen bis hin zu großen Arien, Chornummern und einem spätromantisch inspirierten Klangreichtum wider.
.
In der zwischen 1926 und 1927 komponierten komischen Oper Ero der Schelm bringt Gotovac einen Volkscharakter auf die Bühne, der in vielen Erzählungen und Legenden auftaucht, Archetypus des gewitzten und freien Menschenverstandes. Der Name ist abgeleitet von Hero, der Koseform des Wortes „Hercegovac“, also Herzegowiner, da die Leute aus der Herzegowina als besonders schafsinnige und listige Menschen galten. Die der Oper zugrundeliegende Volkserzählung dreht sich um die Streiche eines Bauernburschen während der Türkenherrschaft auf dem Balkan, der insbesondere die fremden Machthaber immer wieder hinters Licht führen und sich mit List und Tücke aus jeglicher Bedrängnis herausretten konnte. Damit ist dieser Ero so etwas wie die kroatische Variante eines Till Eulenspiegel oder Nasreddin Hodscha. Gerade letzterer, diese komische Figur aus dem türkischen Kulturkreis, ist auch auf dem Balkan sehr populär, und so wird Ero zu einer Art Gegenstück zu Nasreddin Hodscha aus der kroatischen Kultur, die ursprünglich in dieser Region beheimatet war, bevor die Türken kamen.
Gotovac und sein Librettist Milan Begović strichen jedoch alle türkischen Elemente aus dieser Erzählung und verlegten die Geschichte ins Hinterland von Dalmatien nahe der Grenze zur Herzegowina, wo Begović geboren wurde. Diese Gegend im Dinaragebirge galt als besonders traditionsbewusst; die kroatische Folklore hatte sich in dieser Region sehr unverfälscht erhalten und wurde noch mit Leidenschaft gepflegt. Und Ero als solcher existiert bei Gotovac und Begović gar nicht, sondern ist eigentlich Mića, der Sohn eines reichen Gutsbesitzers, der unter falschem Namen die Liebe des Dorfmädchens Đula gewinnen will und allen anderen weismacht, er komme vom Himmel und überbringe die Grüße der verstorbenen Angehörigen. Dieses Motiv eines vom Himmel Gefallenen hat Begović aus einem Fastnachtspiel von Hans Sachs, Der farent Schueler ins Paradeis, übernommen, das ihm neben den Quellen aus dem kroatischen Volksgut als literarische Vorlage diente.

Die bislang einzige CD-Aufnahme in der Originalsprache ist ein Mitschnitt vom Zagreber Theater 1962 mit Marianna Radev, Branca Oblak-Stilinovic und Josip Góstic unter Leitung des Komponisten, aber es gibt noch ein-zwei frühere LP-Aufnahmen auf Jugoton und verschiedene Rundfunkmitschnitte.
„Eine Volksoper soll klar und gesund auf Melodie und Rhythmik der Volksmusik aufbauen. Sie soll Melodie und Harmonie mit einer reichen Orchesterpalette malen und echten Volkshumor mit Lied und Tanz zu einem harmonischen Ganzen vereinen“, so formulierte Gotovac sein künstlerisches Credo, wie er es in Ero der Schelm verwirklichte. Dabei bediente er sich trotz der stark folkloristischen Anklänge, den vielfach ganz unmittelbaren rhythmischen Strukturen und der sich breit entfaltenden Melodik einer gemäßigt modernen Klangsprache, die sich vor allem in den rezitativischen Passagen und den Orchesterüberleitungen bemerkbar macht. Hier verleihen die Instrumentierung und insbesondere das gezielt eingesetzte Schlagwerk der Musik eine expressive Note. Während die Folklore in solchen Momenten eher als Kolorit zu spüren ist, zitiert sie Gotovac an anderen Stellen ganz direkt, etwa im liedhaften Chor der Dorfmädchen, mit dem die Oper beginnt und in den sich Đulas sehnsuchtsvoller Gesang mischt, in den weiteren Chorszenen, in Mićas Auftrittslied, in dem er sich als vom Himmel gefallener Ero ausgibt, oder im lyrischen Duett von Đula und Mića im I. Aufzug. Die Szene zwischen Mića und Doma, in der dieser ihr Geld abluchst (angeblich für ihren verstorbenen Mann im Himmel), hat einen betont komödiantischen Charakter, während dem Chorfinale des I. Aufzugs durch seinen stampfenden Rhythmus sogar etwas Aggressives anhaftet.

„Ero s onoga svijeta“ am Kroatisches Nationaltheater Jakov Gotovac in Osijek / Szene/ KNO
Der II. Aufzug beginnt mit einem Lied des Müllers Sima, worauf wenig später ein Lamento Đulas folgt, in dem sie in einer weit ausladenden Arie den Tod ihrer Mutter beklagt. Im Verlauf dieses Aufzugs, in dem Mića mit Sima die Kleider tauscht, imitieren ein kreisender Rhythmus im Orchester und hämmerndes Schlagwerk immer wieder das Rotieren der Mühle − ein Effekt, den zuvor Janáček in ähnlicher Weise in Jenufa angewandt hat. Auf Mićas ariose Ausbrüche folgt ein weiteres Liebesduett mit Đula.Im III. Aufzug herrscht schließlich Fest- und Tanzstimmung vor. In die Jahrmarktsatmosphäre mit ihren Volkstänzen sind immer wieder rezitativische Abschnitte und lyrische Passagen eingearbeitet, wie Đulas Szene, die in ein großes Ensemble überleitet, oder Mićas finales Triumphlied. Die Oper endet jedoch mit einer breit angelegten, fast zehnminütigen Tanzszene, einem Kolo, als Sinnbild der kroatischen Musik und Folklore. Dieser Kreistanz, der in seiner ursprünglichen Form in Kroatien, Bosnien und Serbien, aber auch in anderen Regionen des Balkans sehr populär ist, gipfelt in einem großen Chorfinale, mit dem das Paar Mića und Đula gefeiert wird.
.

Der Autor: Florian Heurich ist freier Autor und Musikjournalist, schreibt und produziert Radiofeatures und Reportagen für BR-Klassik und gestaltet das Online-Format Opern.TV sowie die Audio-Podcasts der Bayerischen Staatsoper. Dabei versucht er immer seine Opernleidenschaft, seine Reiselust nach Asien und Lateinamerika und seine Arbeit unter einen Hut zu bringen/ Quelle Bayr. Staatsoper
Im Nebeneinander von eher einfachen Liedformen und größer angelegten Arien, Duetten und Ensembles mischt sich der slawische Volkston überdies mit dem Schmelz der großen Oper italienischer Provenienz. Auch dies ein Hinweis auf einen der vielen kulturellen Einflüsse auf dem Balkan, da die kroatische Adriaküste lange Zeit von der Dogenrepublik Venedig beherrscht wurde.
Vor allem aber schwingt in der Volksmusik des Balkans, wie sie Gotovac verwendet, die Musik des Orients mit. Viele hundert Jahre Osmanisches Reich auf dem Balkan haben auch musikalische Spuren hinterlassen. Auf harmonischer Seite kommt dies etwa durch die „orientalische Tonleiter“ zum Ausdruck, die durch zwei übermäßige Sekundschritte charakterisiert ist. Dadurch bekommt die Musik etwas „Exotisches“. Auch in Ero der Schelm sind solche Klänge von entscheidender Bedeutung, das Thema des Marko etwa fußt vollständig auf solchen Harmonien.
Ero der Schelm begründete den Ruhm von Jakov Gotovac in seinem Heimatland und in anderen Ländern Osteuropas. Gotovac traf damit genau den Nerv seiner Zeit im noch jungen Jugoslawien, sodass dieses Werk zu einer der populärsten Opern Kroatiens und des Balkans wurde und mit seinem besonderen Kolorit und seiner originellen, über den reinen Folklorismus hinausgehenden Musik auch das internationale Publikum begeisterte. Florian Heurich
.
.
Dank an den Autor Florian Heurich und Doris Sennefelder für die Genehmigung zu Übernahme des Artikels aus dem Programmheft des Münchner Rundfunkorchesters zur konzertanten Aufführung am 19. Mai 2019.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.
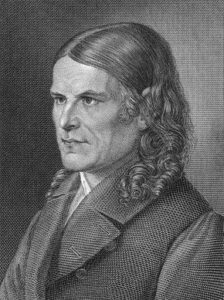











 Bei der ältesten in der Box inkludierten Aufnahme handelt es sich um die Ouvertüre zur Verkauften Braut von Smetana aus Leningrad 1937. Hier ist sogar ein Vergleich möglich, ist doch auch eine (russisch gesungene) Gesamtaufnahme dieses Werkes von 1949 aus dem Moskauer Bolschoi-Theater enthalten. Sicherlich keine besonders idiomatische Angelegenheit, doch trösten das inspirierte Dirigat und das gute Sängerensemble (darunter Elisabeta Schumilowa, Georgi Nelepp, Anatole Orfenow und Nikolai Schtschelgolkow) darüber hinweg. Der Klang ist selbst in der 1937er Einspielung durchaus erträglich, wie übrigens in der gesamten Kollektion, in der etwa die Hälfte aus Monoaufnahmen besteht.
Bei der ältesten in der Box inkludierten Aufnahme handelt es sich um die Ouvertüre zur Verkauften Braut von Smetana aus Leningrad 1937. Hier ist sogar ein Vergleich möglich, ist doch auch eine (russisch gesungene) Gesamtaufnahme dieses Werkes von 1949 aus dem Moskauer Bolschoi-Theater enthalten. Sicherlich keine besonders idiomatische Angelegenheit, doch trösten das inspirierte Dirigat und das gute Sängerensemble (darunter Elisabeta Schumilowa, Georgi Nelepp, Anatole Orfenow und Nikolai Schtschelgolkow) darüber hinweg. Der Klang ist selbst in der 1937er Einspielung durchaus erträglich, wie übrigens in der gesamten Kollektion, in der etwa die Hälfte aus Monoaufnahmen besteht.














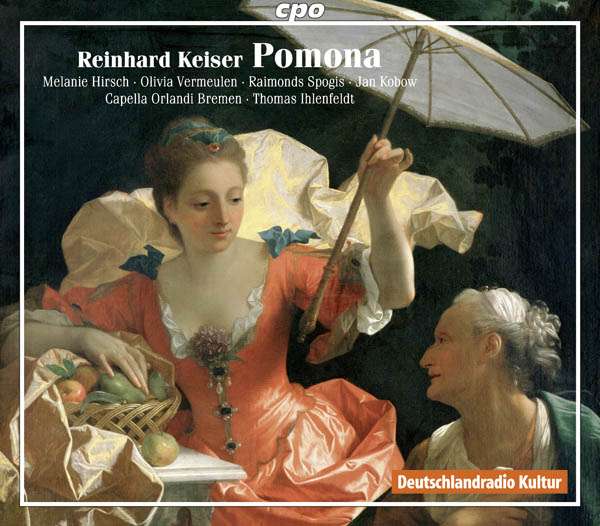








 Louis-Nicolas Clérambault
Louis-Nicolas Clérambault