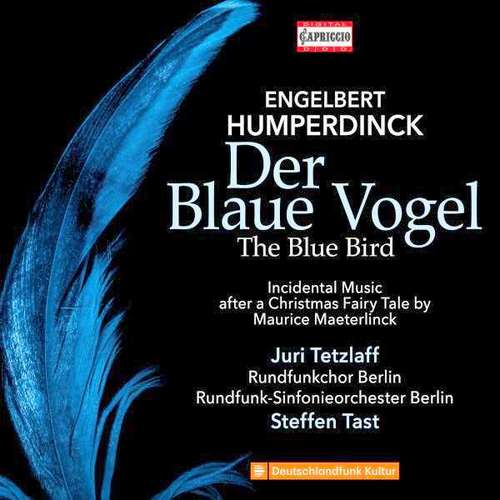.
Wieder einmal überraschte die Oper Bonn mit einer Sensation und modernen Erstaufführung: Alberto Franchettis Asrael, eine „musikalische Legende in vier Akten“ (Libretto von Ferdinando Fontana, Uraufführung am 11.02.1888 am Teatro Municipale di Reggio nell’Emilia mit einer Illustren Besetzung, die unter anderem den polnischen Tenor Ladislao Mierzwinski, die Sopranistin Virginia Damerini sowie den Basss-Bariton Lodovico Contini aufwies; es dirigierte der Komponist selbst). Franchetti und sein Umfeld der Jahrhundertwende sind ja ein Lieblingsthema des Bonner Operndirektors Andreas Meyer, der bereits zuvor in Berlin als dortiger Chefdramaturg der DOB Franchettis Germania zu einer vielbeachteten Aufmerksamkeit verhalf, aber auch Gnecchis Cassandra und anderes mehr fand durch ihn den Weg auf die Bühne. In letzter Zeit staunten Fans über Meyerbeers Feldlager in Schlesien oder Franckensteins Li-Tai-Pe auf dem BonnerTheater – wahrlich eine bedeutende Repertoireerweiterung.

Alberto Franchettis „Asrael“: Poster der Premiere am Teatro Comunale in Reggio Emilia/ Archivio Storico Ricordi
Jedem Interessierten rate ich den Kauf des ungemein vielseitigen Programmheftes an, denn die dortigen Aufsätze musikhistorischer Fachkräfte machen spannende Lektüre (das Ganze als Bestandteil der Serie Fokus’33 / Forschungsreise zu den Ursachen von Verschwinden und Verbleiben, Band 6 und in Teilen mehrsprachig). Reich bebildert mit den entzückenden Figurinen aus dem Liebig-Bilder-Programm finden sich Beiträge von Barbara Dallheimer, Alessia Ferraresi, Anselm Gerhard, Richard Erkens (einem der wichtigen Franchetti-Spezialisten), Hans Joachim Wagner sowie Emanuele D´Angelo, ungemein lohnend.
.
Vorab ein kurzer Blick auf den Komponisten, der erst durch seine Germania an der DOB einem breiteren deutschen Publikum bekannt wurde und der bis dahin eher im Umfeld Puccinis mitlief (was ihm Unrecht tut). Alberto Franchettis Vater war der Großgrundbesitzer Baron Raimondo Franchetti, seine Mutter Sara Louise von Rothschild entstammte der Bankiersdynastie Rothschild. Der Vater lehnte zunächst Franchettis musikalische Studien ab. Doch er begann dennoch ein Musikstudium, zunächst in Turin, später in Venedig, wohin seine Familie übersiedelt war. Seine Lehrer waren Nicolò Coccon (1826–1903) in Harmonielehre und Fortunato Magi (1838–1882) in Kontrapunkt. Mit zwanzig Jahren ging er nach München. Hier studierte er bei Josef Rheinberger und anschließend in Dresden bei Felix Draeseke und Edmund Kretschmer. Seine Abschlussarbeit in Dresden war die viersätzige Symphonie e-Moll. Er arbeitete in verschiedenen oberitalienischen Städten als Musiklehrer und Komponist. Im Jahr 1888 fand die Uraufführung seiner ersten Oper Asrael statt (im Plot dem Dämon Dargomyschkis nicht unähnlich: Der gefallene Engel Asrael wird durch die reine Liebe seiner Mit-Engelin nach Höllenfahrt und Erden-Ausschweifungen dem Himmel zurückgegeben, Happy-end). Zur 400-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas erhielt Franchetti auf Empfehlung Giuseppe Verdis den Kompositionsauftrag für eine Kolumbus-Oper in Genua. Nach Cristoforo Colombo (uraufgeführt 1892) entstanden noch Fior d’Alpe (1894), Il Signor di Pourceaugnac (1897), Germania (UA 11. März 1902 unter Arturo Toscanini), La Figlia di Jorio (Libretto: D’Annunzio) (1906), Notte di Leggenda (1915) und Glauco (1922). Zwischen 1926 und 1928 war er Direktor des Konservatoriums von Florenz.

Alberto Franchettis „Asrael“: Pietro Mascagni, Alberto Franchetti und Giacomo Puccini/ Wikipedia
Franchetti gehörte zum Verehrerkreis von Richard Wagner und war – neben anderen Ehrenämtern – Vorsitzender der Wagner-Gesellschaft Bologna.
Er war zweimal verheiratet. 1888 heiratete er Margherita Levi, von der er 1897 wieder geschieden wurde. Zu diesem Zweck war Franchetti für einige Jahre deutscher Staatsbürger geworden, weil in seinem Heimatland eine Scheidung nicht möglich war.
Seine Opern wurden auf der ganzen Welt gespielt (so auch in Hamburg). Im Dritten Reich erhielten seine Werke wegen Franchettis jüdischer Abstammung Aufführungsverbot. Auch in Italien verschlechterte sich seine Situation durch die Einführung der italienischen Rassengesetze ab 1938. So zog er sich 1934 aus der Öffentlichkeit nach Viareggio zurück, wo er 1942 vereinsamt starb. (Wikipedia)
.

Franchettis „Asrael“: Ladislao Mierzwinski sang die Titelrolle in der Uraufführung/ Ipernity
Zu den Dokumenten: 1992 erschien in einer CD-Produktion des Hessischen Rundfunks eine Gesamtaufnahme der Oper Christoforo Colombo mit Renato Bruson in der Titelrolle (Koch). Eine Aufführung derselben Oper in Montpellier von 1992 gab es in einer Sonderpressung des Archivio Sonoro del Teatro Municipale di Reggio Emilia (mit der wunderbaren Michele Lagrange und einem wirklich bewegenden Paolo Coni, bei Discorps antiquarisch). Germania nahm die rührige RAI bereits 1951 auf und ist als großer Querschnitt auf „grauen“ LPs erschienen. 1985 gab es die Oper in New York konzertant (Sammler haben das). 2006 brachte die Deutsche Oper Berlin das Werk heraus, eine Produktion, die auch auf DVD bei Capriccio veröffentlicht wurde (als Pressebeilage gab es besagten alten RAI-Mitschnitt). Die RAI nahm sich weiterer seiner Opern an: 1988 die Figlia di Iorio, dto Ausschnitte aus seinem Glauco. Sinfonisches und Kammermusik findet sich bei Bongiovanni, Naxos und anderen Firmen. Nun hoffen wir, dass Asrael nicht nur im Radio wiedergegeben wird sondern auch seinen Weg auf die CD findet…
.

Franchettis „Asrael“: Bühnenbild zum 3. Akt der Urauffühgrung/ Archivio Storico Ricordi
Soweit Kurzes zum Komponisten und seinen greifbaren Dokumenten. Nachfolgend ein Auszug (der Schluss) aus dem Artikel von Richard Erkens („Von der Hölle durch die Welt zum Himmel – Franchettis Gesellenstück ›de luxe‹ von 1888“) im erwähnten Bonner Programmheft zur Aufführung am 16. Oktober 2022. G. H.
.
.
Szenisch fragwürdig und kurzschlüssig: Rolf Fath über die Bonner Aufführung. Es sei das schönste Opernhaus der Region, versicherte uns kürzlich noch die Leiterin des Theatermuseums des Teatro Municipale in Reggio Emilia. Schließlich sei es, im Gegensatz zu den anderen Bühnen in der Umgebung, beispielsweise dem prächtigen Teatro Regio im nicht mal 30 Kilometer entfernten Parma, von den Bürgern der Stadt errichtet worden. Der Bau am Rande der Altstadt mit seinen markanten zwölf rustikalen Säulen, den auf vier Ränge verteilten 106 Logen und einer Galerie wurde 1857 eröffnet. In der Spielzeit 1887/1888 übernahm Baron Raimondo Franchetti die Leitung des Hauses, um die Begleitumstände für den Bühnenerstling seines ältesten Sohnes so vorteilhaft als nur möglich zu gestalten. Wenn Alberto schon Komponist werden wollte, sollte ihm der Weg zum Erfolg in jeder Hinsicht geebnet werden. Zunächst in seiner Geburtsstadt Turin, dann in Venedig, wohin die Franchettis 1871 in ihren aus dem 16. Jahrhundert stammenden, von Arrigo Boitos älterem Bruder Camillo im neogotischen Stil umgewandelten Palazzo Cavalli-Franchetti zogen, erhielt Alberto Franchetti seinen ersten Musikunterricht, bevor dem 20jährigen ab 1860 der Aufenthalt in München und der Unterricht bei Josef Rheinberger und anschließend in Dresden bei Felix Dreaseke ermöglicht wurde. Vater Raimondo managte die Karriere seines Sohnes so umsichtig wie seine landwirtschaftlichen Betriebe im Veneto, bei Mantua, Florenz und Reggio Emilia und bot das Beste und Teuerste auf, um einen Premierenerfolg zu sichern, dabei vorsichtig genug, es nicht an einer ersten Bühne zu wagen, sondern in der Provinz. Das fiel dem zwei Jahre nach seiner Heirat mit einer Wiener Rothschild-Erbin in den erblichen Adelsstand erhobenen zweitreichsten Mann Italiens nicht schwer.

Franchettis „Asrael“ an der Oper Bonn/ Szene/ Foto Thilo Beu
Die Widmung „A mio padre“ begleitet denn auch die Produktion der Oper Bonn, die den Asrael erstmals seit hundert Jahren wieder auf die Bühne holt und mit Albertos artiger Dankadresse auf dem Zwischenvorhang jeden Akt der gar nicht so artigen Inszenierung von Cristopher Alden beginnt. Alberto enttäuschte nicht und setzte seinerseits auf der Bühne für den Kampf zwischen Gut und Böse, sprich den Pakt des Engels Asrael mit Luzifer, Himmel und Hölle in Bewegung. Chöre der Dämonen, verdammten Seelen, Engel, Cherubim, Seraphim, Heiligen, Jungfrauen, Märtyrer und Patriarchen umrahmen die im 13. Jahrhundert spielende und auf der 1832 in Paris publizierten Erzählung Asraël et Nephta. Histoire de province von Samuel-Henri Berthoud basierende Leggenda, deren erster Akt aus der Hölle in den Himmel schwenkt, während die weiteren drei Akte in Flandern spielen. Dort stößt Asrael auf die heiratsunlustige Prinzessin Lidoria, die ihre Verehrer durch eine unlösbare Aufgabe à la Turandot in die Flucht schlägt. Asrael löst die Aufgaben, verschmäht aber die Prinzessin. Als nächste erscheint die Zigeunerin Loretta, eine Verwandte der Carmen, die sich ihrerseits in Asrael verliebt. Schließlich taucht Nefta in Gestalt von Schwester Clothilde auf; mit Nefta lebte Asrael im Himmel, bevor sich Asrael gegen Luzifer wandte. Die Suche nach der Geliebten Nefta ist der Motor seines Handelns. Die Frist für den Pakt mit dem Teufel ist fast abgelaufen, als Asrael im Kloster mit Schwester Clothilde das „Ave Maria“ betet, worauf sich der Himmel öffnet. Asrael und Clothilde, in der er nun endlich Nefta erkennt, dürfen als liebende Engel in den Himmel zurückkehren. Asrael: „Ich kehre zur ewigen Freude zurück! Ich kehre zu meinen Brüdern zurück! Du bist nun mein für immer! Du, Nefta, bist mein Himmel!“. Dazu die schlichte Bühnenanweisung: „Der Altar und die Madonnenstatue leuchten plötzlich in hellstem Licht: es regnet Blumen. – Apotheose“.
Wie soll man das inszenieren? Christopher Alden, dessen Peter Grimes und Tristan und Isolde mir zuletzt in Karlsruhe ausgesprochen gut gefielen, entzog sich dem Himmelfahrtskommando durch eine banale Familienaufstellung. Kein großes Spektakel, sondern Tristesse im ranzig geworden Palais (Bühne: Charles Edwards), wo der Kriegsveteran seine Frau schikaniert und ihre Harfe zertrümmert, worauf sie den Freitod wählt und fortan als Maria durch die Handlung geistert, der die drei Töchter merkwürdig behandelt und dem Sohn die Engelsflügel stutzt, ihn drillt und in den Krieg schickt. Eine Tochter umgibt sich als Künstlerin an der Staffelei mit schmucken Soldaten, die andere verteidigt an der Schreibmaschine die Rechte der Frau und setzt sich für La revolta femminile ein, die dritte, Nefta, wandert schließlich aus der Dachstube als Rotkreuzschwester aufs Schlachtfeld. Warum Alden die Kriegsmetapher wählt, die bei der Gleichsetzung des Vates mit Luzifer und dem Bild der Hölle als „Hölle des Krieges“ noch plausibel wirkt, will sich nicht erschließen. Der Erste Weltkrieg, die Schlachtszenen, die Soldaten und Gewehre sind kaum mehr als wohlfeile Accessoires, ebenso unnötig, wie der Gang durch die Etagen der Villa vom Dachgeschoss-Himmel in die Keller-Hölle und in den Salon, wo Asrael ein kindisches Ritterspiel aufführt und der alte Vater mit Gehhilfe und später im Rollstuhl zunehmend dahindämmert und schließlich am Ende mit den Trauerkränzen des Chores zu Grabe getragen wird.

Franchettis „Asrael“ an der Oper Bonn/ Szene/ Foto Thilo Beu
In Asrael spielt alles hinein, was sich Mitglieder der Giovane scuola und Scapigliatura erdachten, um der Agonie zu entgehen, in welche die italienische Oper nach Verdis Aida zu verfallen schien. Nicht zuletzt der Wagnerismo, dessen der in Deutschland ausgebildete Franchetti verdächtig war, wobei Wagnerismo in Italien gleichbeutend mit einer tragendenden ausgedehnten Rolle des Orchesters war. Von alledem hat Franchettis Oper etwas, auch von der französischen Grand opéra, der Faszination an Übersinnlichem und der Begeisterung für deutsches Mittelalter, dem frühen Wagner, etwa des Lohengrin und Tannhäuser, vom Mystischen des Parsifal, den er in Bayreuth erlebte. Alles auf dem Boden der italienischen Melodik. Anselm Weber resümiert im 230-Seiten-Programmheft, Franchettis Partitur müsse „als eine der gelungensten Opern des italienischen Fin-de-siècle gelten und damit als Markstein in der Operngeschichte des späten 19. Jahrhunderts. Trotz aller ihrer Qualitäten eignet ihm als Erstlingswerk manche Unwucht, gleichwohl fasziniert auch fast 135 Jahre nach der Uraufführung die Sorgfalt der Ausarbeitung und der Schmelz der melodischen Erfindung“. Vor allem war Asrael ein grande spettacolo, dessen Erfolg weitreichend, aber erstaunlich kurz war. Asraels Höhenflug – allerletzte Aufführungen 1925/26 in Genua und Treviso – war zur Zeit des Ersten Weltkriegs vorüber und er war längst vergessen, als Franchetti, der sich zunehmend von der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte,1942 in Viareggio starb. Wegen seiner jüdischen Abstammung hatten seine Werke ab 1933 in Deutschland Aufführungsverbot, ebenso in Italien durch die Einführung der italienischen Rassengesetze ab 1938.
Das grande spettacolo, dem sich die Bühne trotzig entzog, lieferte der 30jährige Hermes Helfricht, der die Musik – mit dem „eigens für die Bonner Produktion erstelltem Material“ – mit dem Beethoven Orchester derart mit Herzblut erfüllte und mit Leidenschaft agierte, dabei neben den Solisten auf der Bühne hingebungsvoll die im ersten Rang platzierten Chöre (Chor des Theaters Bonn und Extrachor) und die in den Seitenbalkonen aufgestellten Fanfaren organisierte, dass man in Momenten gerne glauben wollte, dass es sich um großartige Musik handelt. Am besten – etwa in den „Pape Satan, Pape Satan, Aleppe“-Chören, den schneidenden Bläsersignalen oder in den Duetten Asraels mit Loretta „Soavi accenti, d’amor frementi!“ und mit Nefta/Clotilde „L’idea torva, infernal“ – ist Asrael, wenn er sich als exakte Mefistofele-Kopie gibt. Die schillernden Vor- und Zwischenmusiken und das zeremonielle Stimmungsgezwischer sind gekonnt gemacht, nehmen die späteren Schwarzwald-Impressionen in Nella Foresta Nera vorweg, üppige Vorjahrhundertwendmusik, doch ohne dramatische Entwicklung, oft geradezu zähbreiig, überwältigend nur in der Ballung und Schichtung der Chöre: Massierung des Klangs statt dramatischer Entwicklung.

Franchettis „Asrael“ an der Oper Bonn/ Szene/ Foto Thilo Beu
Wie in den Wiederentdeckungen der letzten Jahre, darunter Faccios Amleto, Boitos Nerone und letztlich auch Giordanos Siberia, die im Frühjahr von Bregenz nach Bonn transferiert wird, schwingt der Gesang selten arios aus, herrscht ein rezitativisch markantes Sing-Agieren vor, unbequem oder undankbar geschrieben für die Stimmen. Tamara Gura scheint sich mit der Tessitur der Lidoria nicht wohl zu fühlen und kann nichts aus der Prinzessin von Brabant machen, die als Turandot-Vorläuferin doch zu hoch gehandelt wird. Der (stumme) Hausvater übernimmt auch die kleinen Episodenrollen des Luzifers und des Königs von Brabant, wodurch Pavel Kudinov mit verschlucktem Bass vor allem darstellerisch punkten kann. Mit leuchtenden Farben, feurigem Elan und festem Mezzosopran macht Khatuna Mikaberidze aus der Bohemienne Loretta so etwas wie eine Figur, sie hat denn mit der Arie, in der sie zu Beginn des dritten Aktes vom Leben der Zigeuner singt, auch eine der dankbarsten Nummern. Mit glockig dunklem, teilweise etwas unruhigem Sopran singt Svetlana Kasyan die Nefta/ Clotilde; eine gewisse veristische Schärfe und Nervosität sind nicht unrecht für die Partie. Keinen guten Tag hatte Peter Auty. Ein paar hübsche lyrische Passagen und die Leichtigkeit in der Überganslage mögen ihn für kleinere italienische Partien qualifizieren. Doch am Premierenabend mühte er sich als blutloser Asrael mit verstocktem Tenor, ohne Glanz und Strahl in der Stimme, durch eine Partie, die bedeutend mehr stimmliches Rückgrat verlangt (16. 10. 22). Rolf Fath
.
.

Franchettis „Asrael“: Bühnenbild zur Urauffühgrung/ Archivio Storico Ricordi
Richard Erkens zur Oper selbst: Asrael als Momentaufnahme. Franchettis Debütwerk von 1888 ist ein prall gefüllter Kosmos all dessen, was das europäische Musiktheater der 1880er Jahre beinhaltete, zu bieten hatte, bieten wollte – eine Momentaufnahme. Genau daraufhin war Franchettis musiktheatraler Startschuss angelegt. Der synoptische Charakter des Werks ist Konzept, eine Aufstellung des Möglichen, eine Zusammenschau musikdramatischer Ausdrucksoptionen. Der familiäre Hintergrund des Komponisten, seine musikästhetische Orientierung und die Exklusivität des Entstehungskontexts sind historische Erklärungen dafür. Die Aneignungsleistung Franchettis und sein kompositorisches Vermögen, diese opulenten Bilder adäquat in Musik zu setzen, sind bemerkenswert, für ein Debütwerk sogar außergewöhnlich. Die Partitur ist auf einer konsistenten Stilhöhe geschrieben, sie schwächelt nicht und bedurfte daher auch keiner grundlegenden Revision nach der Uraufführung – wie so manch andere Erstlinge von Kollegen. Dies war förderlich für den sofortigen Nachspielerfolg außerhalb des ›Exklusivraumes‹ Reggio Emilia. Die wenigen Modifikationen, die Franchetti für Folgeproduktionen vornahm, fallen kaum ins Gewicht. Somit gelang ihm ein Gesellenstück, das eine international rezipierte Opernnovität wurde, was kaum einer derjenigen Komponisten erreichte, die noch heute in aller Munde sind. Der historische Erfolg von Asrael spiegelt somit unmittelbar auch die Geschmacksnerven einer prosperierenden wie sozial brüchigen Zeit, die – wie unsere – unablässig auf ästhetische Veränderungen und Novitäten anspringt. Daher kann ein Werk, stark gebunden an historische Aktualität, nach vielen Jahrzehnten ausbleibender Aktivierung wieder aktuelle Funken versprühen. Warum aber Asrael noch kein Meisterstück ist, das einen nachhaltigen, zeitenthobenen Charakter besitzt? – Franchetti komponierte es anschließend mit Cristoforo Colombo.

Franchettis „Asrael“: Giuseppe Russitano in der Titelpartie/ Milward Adams Photograph Collection/ historicaltenors
Wie kaum ein anderes Bühnenwerk dieser Epoche ließe sich Asrael erklären, indem man Opern, dramatische Beziehungskonstellationen oder Figurentypen aufruft, die mit gutem Recht als Vorbilder gelten können. Der szenische wie dramaturgische Zitatcharakter des Werks ist so dicht, dass er nicht als ästhetische Verlegenheit, sondern als konzeptionelle Struktur gelesen werden muss. Franchetti und (und sein Librettist Ferdinando) Fontana eigneten sich gleichsam alles an, was bis Mitte der 1880er Jahre als neu, innovativ und effektsicher gelten konnte. Anders formuliert: sie boten alles auf, was sich an szenischen und dramatischen Wirkmitteln bewährt hatte im Sinne eines fast synoptischen Konstruktionsprinzips von Musiktheater. Auf diese Weise wurde inhaltlich eingelöst, was Franchetti durch den exklusiven Produktionshintergrund seines Operndebüts ermöglicht wurde, nämlich ein Gesellenstück de luxe zu komponieren, das den Beweis antrat, sich der europäischen Diversität musiktheatraler Formen bemächtigt zu haben.
Asrael als Opernsynopse: So wurde mit »Teufelspakt« und »Seelenhandel« ein alter literarischer Topos aktiviert und auf die eher seltenen Vertragspartner von Teufel und Dämon umgemünzt. Für das Figurenprofil der selbstbewusst liebenden Loretta stand die exotische Carmen Patin, die 1875 in Paris einen Skandal auslöste. Die zum kurzen, magischen »Blickkampf« umfunktionierte Rätselprobe bei der Brautwerbung der männerscheuen Königstochter Lidoria ist dem Turandot-Stoff entlehnt, durch Gozzi und Schiller bearbeitet und längst popularisiert. Er gelangte bereits durch Puccinis Lehrer Antonio Bazzini 1867 als Turanda auf die Bühne der Mailänder Scala. Der unbekannte Fremde, der plötzlich vor das instabile Gefüge eines Hofstaates tritt und die legitime Thronerbin erotisch herausfordert, verweist auch auf den ersten Lohengrin-Akt. Und die Ahnung um eine verheimlichte, wahre Identität des Fremden im Verein mit Zweifeln an der Aufrichtigkeit seiner Liebesbekundung sind gleichfalls Elsa- und Ortrud-Themen, die auf Loretta und Lidoria übertragen wurden. Sie motivieren die eigentliche, auf den dritten Akt beschränkte Intrigenhandlung. Das abendliche Stimmungsbild des Zigeunerlagers am Fluss, der Liebesnacht vorangestellt, ist eine Referenz an das breite Repertoire exotistischer Szenen, ohne die die Oper im 19. Jahrhundert nicht zu denken ist. Der metaphysische Kampf zwischen Gut und Böse, den die kontrastierenden Chöre im dritten Finale über dem verwundeten Asrael gleichsam stellvertretend führen, steht im Erbe des wankelmütigen, unentschiedenen Antihelden, wie ihn Scribe und Meyerbeer in der Figur des Robert entworfen hatten. Und nicht zuletzt erscheint der Klosterakt als eine dramaturgische Inversion jener berühmten Nonnenszene aus Robert le diable, indem Schwester Clotilde Asrael zum Guten verführt, nicht zur Freveltat wie die zuvor von den Toten erweckte, sündige Geister-Äbtissin Hélène. Hier wie dort ist es eine Statue (der Hl. Rosalie bzw. der Madonna), an welcher sich der dramatische Höhepunkt vollzieht. Wenn schließlich in Asrael die Klostermauern zusammenbrechen, ist ein weiterer szenischer Topos aufgerufen, nämlich ein sogenanntes Katastrophenfinale, meist durch zusammenbrechende Steinarchitektur oder Feuer- und Weltenbrände realisiert – ein typischer Schaueffekt historischer Opern dieses Jahrhunderts. Hier bleibt er hintergründig, führt nicht in den Untergang, sondern wird zum Rückprospekt von Transzendenz und Weltüberwindung, da der (private) Konflikt des Engelspaars glücklich gelöst ist: Asrael und Nefta erkennen sich wieder, um sie herum wird es abermals paradiesisch.
Motivisches Komponieren und Klangdramaturgie: Franchettis frühe Auseinandersetzung mit dem Werk Wagners machte zwangsläufig die Technik motivischen Komponierens auch für Asrael bedeutsam. Natürlich brauchte es nicht Wagner, um eine motivgebundene Opernmusik kennenzulernen, denn das war in französischen Operngenres seit langem als erinnerungsmotivisches Verfahren etabliert: ein charakteristisches Motiv erhält für die Hörenden eine feste Bedeutung und ›erinnert‹ bei jedem weiteren Erklingen an diese. Neu war für die italienische Operngeschichte, und dafür stellt Asrael ein herausragendes Beispiel dar, dass die Anzahl solcher dramengebundenen Motive sprunghaft anstieg, komplexer wurde, sich ein ganzes Motivnetz bildete. Mit der Traumszene des dritten Akts ist eine dramatisch zentrale Passage gegeben, in welcher tatsächlich der gesamte musikalische Satz, also alles, was klingt, aus semantisch eindeutig bestimmbaren Motiven gebildet ist und mit zusätzlicher Bedeutung ›aufgeladen‹ wird. Damit war Franchetti einer der ersten in Italien – neben Luigi Mancinellis in seiner glücklosen Isora di Provenza (Bologna 1884) –, die das strenge leitmotivische Verfahren Wagners in Ansätzen imitierten. Denn hierbei wird auch die musikalische Form durch Motive gebildet, ohne in ein konventionelles Formgerüst lediglich ›eingehängt‹ zu sein. In der Traumszene wird das Orchester zum autonomen Kommentator des Bühnengeschehens, es weiß ›mehr‹ als die Protagnisten und verdichtet den Sinngehalt des Ganzen – ein wirklicher »Beziehungszauber«, wie Thomas Mann formulierte. Einem unmittelbaren Vergleich zu Wagners Motivik im Ring mag diese Stelle kaum standhalten, dennoch bewies Franchetti musikdramatisches Feingefühl: Die verschleierten Erinnerungen Asraels an Nefta, sein wahres Gefühlsleben, das er träumend an Loretta verrät, werden über das musikalische Motivnetz sprechend.

Franchettis „Asrael“/ Liebig/ Archivio Storico Ricordi
Was die Traumszene verdichtet, durchzieht sonst als offenes, lockeres Motivgewebe die gesamte Partitur – genauer: verbindet sich als zusätzliche semantische Schicht mit einem musikalischen Satz, dessen Bauprinzip weiterhin die geschlossene Form ist, also Arie, Duett, Ensemble oder Chorpassage kennt. Durch elaborierte Überleitungen sind diese miteinander verbunden, subtil verschmolzen. Der Eindruck konventioneller Vertrautheit vieler Passagen liegt an der weitgehend regelmäßigen Periodenstruktur, welche gerade die Melodiebögen Franchettis zu klassisch anmutenden Kantilenen formt. Ein kompositorisches Aufbrechen traditioneller Periodizität, ein Sprengen von Linien und Proportionen hin zu einer musikalischen Prosa gibt es – wie auch in vielen anderen Partituren dieses Jahrzehnts – nur in Ansätzen. Der ›Hörzugang‹ ist bei aller formalen Vielfalt, allem harmonisch-melodischem Reichtum und üppigem Schauangebot dadurch ›niedrigschwellig‹: kein verrätseltes Klanglabyrinth drängt sich auf, Franchetti spricht eine ausbalancierte, feinsinnige wie eloquente musikalische Sprache.
Die personen- und situationsgebundenen Motive sind leicht wahrnehmbar. Franchetti komponierte kein assoziierendes Motivnetz, das sich erst nach analytischer Arbeit erschließt, sondern verband sie als deutlich voneinander abgesetzte musikalische Chiffren mit den vertrauten Formmodellen. Alle wichtigen Personen und für das Drama relevanten Themen treten als Motivplastik hervor. In derber Intervallstruktur und harmonischer Instabilität ist das ›Dämon‹-Motiv gleich am Beginn der Höllenszene hörbar und erhält spätestens bei der chorischen Exklamation »Pape Satan, Aleppe!« seine feste Sinnzuschreibung. Es wird sich meist in den tiefen Orchesterstimmen immer dann hineinschlängeln, wenn auf Asraels dämonische Identität bzw. die Macht des Bösen verwiesen wird. Komplementär dazu erklingt das Nefta-Motiv als lyrische Kantilene in harmonischer Geschlossenheit nicht erst bei ihrem Auftritt im Himmelsbild, sondern bereits als melodisch-fragmentiertes Vorzitat im Klagemonolog Asraels, in welchem er sich an das für immer verloren geglaubte Paradies erinnert. Lidoria, Königstochter und Schwarzkünstlerin, erhält zu Beginn des zweiten Akts ein prägend-pochendes Motiv, das im erzählenden Chorrefrain der Bauern auch textlich auf sie bezogen ist (»All’arte magica Lidoria diè«). Im Weiteren steht es auch für den irdischen Gegenzauber, der Asrael im dritten Finalbild schwächen wird. Lorettas tänzerische Motivfloskel über einem Polacca-Rhythmus mit Staccatobegleitung und einem stereotypisch ›zigeunerischen‹ Klangidiom aus kleiner Flöte, Schellentrommel und Kastagnetten ist musikalische Anverwandlung der exotistischen Carmen-Welt, der sie entspringt.

Franchettis „Asrael“/ Liebig/ Archivio Storico Ricordi
Die Motive ließen sich noch weiter aufschlüsseln und den dualistischen Sphären von Höllen- und Himmelsraum zuordnen: chromatische Dichte und tänzerisch-rauschhafte Gestik für das dämonische Unten, harmonische Balance und schwebender Klangvokal für das göttliche Oben. Mit der Verwandlungsmusik zwischen Höllen- und Himmelsbild des ersten Akts, gleichsam eine Nibelheimfahrt von Wotan und Loge aus Wagners Rheingold in Gegenrichtung, komponierte Franchetti eine imaginär-musikalische ›Kamerafahrt‹ zwischen den Welttheaterebenen, die dem Orchesterklang Wagners, besonders des Tannhäusers, abgehört erscheint. Den massiven Instrumentalpassagen besonders der Höllen- und Erdensphäre stehen die vokalen, nahezu statischen Fernklang-Gebilde der sich bis zu zwölf Stimmen auffächernden Himmelschöre gegenüber. Ähnliche Sakralklänge sind bekannt aus Boitos Mefistofele und Wagners Parsifal, doch nicht zuletzt lässt sich hier auch der Rheinberger-Schüler vernehmen. Wenn Schwester Clotilde als dritte Partei in die irdischen Konflikte eingreift, hebt Franchetti die Klangsphären voneinander ab und lässt – wie im zweiten Finale – die noch unerkannte Engelsgattin mit einer schwerelosen Klanggloriole zwischen die streitenden Erd- und Dämonenarmeen treten. Franchetti setzt auf klangliche Kontrastdramaturgie, nicht auf Zwischen- oder Grautöne.

Franchettis „Asrael“: der Librettist Ferdinando Fontana und Giacomo Puccini/ Wikipedia
Neues in Altes integrieren: Duette und Ensembles: Die Kombination aus Motivnetz und konventionellem Formgerüst spiegelt das synthetische Konzept von Asrael auch auf musikalischer Ebene. Die chorischen Erzähllieder am Beginn der Lidoria- und Loretta-Handlung (zweiter und dritter Akt) beschwören einen Romanzenton, der für das Jahr 1888 bereits aus der Zeit gefallen scheint, aber vor dem Hintergrund des so präsenten Verdi’schen Œuvres in Italien, der dieses Idiom kaum bediente, als ästhetisch unverbraucht und neu wirken konnte. Franchettis vielleicht beeindruckendste Integrationsleistung ist das große Ensemble am Ende des zweiten Akts, welches ganz nach der dramaturgischen Logik von Schock und Stillstand gebaut ist wie viele Finali mit kontemplativem Ensemble. Asrael weist den Brautring Lidorias nicht nur zurück – Ehe ohne wahre Liebe könne nicht sein –, sondern wirft ihn der Königstochter, begleitet vom markant hervortretenden Ring-Motiv, gar noch vor die Füße. Nicht weniger plötzlich tritt Schwester Clotilde dazwischen und beschwichtigt die kampfbereiten Parteien. Nun endlich ist Raum für Reflexion und emotionale Selbstklärung im sogenannten pezzo concertato gegeben (»De’ suoi detti il suon mi parve«): Clotilde/Nefta erkennt Asrael wieder, Asrael entflammt in Begierde zu Loretta, diese, nicht weniger erotisiert, ersinnt einen Fluchtplan, Lidoria ahnt das dämonische Wesen des Fremden, der König beklagt den erbenlosen Zustand seines Staates, während die verschiedenen Chorgruppen (Nonnen, Ritter, Bauern, Flusszigeuner) aus der Warte ihrer sozialen Zugehörigkeit heraus die Situation kommentieren.

Franchettis „Asrael“: Leon Gritzinger in der Titelrolle in einer Aufführung in Hamburg/ Ipernity
Das Ensemble ist große Klangmassierung und individuelle Ausdifferenzierung zugleich. Franchetti monierte geschickt zwei wichtige Motive in den geschlossenen musikalischen Satz hinein, die zunächst nur suggestiv zu hören waren, nun aber bedeutsam werden. Mit Lidorias Einsatz (»No, il rossor sulla mia fronte«) erklingt ihr zweites, sich expressiv-schlängelndes Personalmotiv deutlich und prägnant, das ihren stolzen ›Turandot‹-Charakter nach schmachvoller Niederlage abbildet. Und Asrael lässt sich mit einer leidenschaftlich aufschwingenden Kantilene vernehmen, die seine Augenblickslust auf Loretta als körperlichen Drang und begehrliches Schmachten ausdrückt (»Di Loretta negli sguardi«). Wie Verdi in seinem zeitgleich komponierten Spätwerk Otello das Finale des dritten Akts durch simultane Aktionsebenen bereicherte, ist auch Franchettis Frühwerk ein Beispiel von Bemächtigung und Skepsis gegenüber einer Konvention, deren geschlossene Form, absolute Statik und Handlungslosigkeit zunehmend als problematisch empfunden wurde. Franchettis Erneuerungsansatz in Asrael war eine motivische Durchdringung, die zu individueller Modellierungen innerhalb der Klangmassierung führte.

Franchettis „Asrael“: der Autor des Artikels, der Musikwissenschaftler Richard Erkens, zu seiner Biographie s. nachstehend
Das eigentliche Drama der Leidenschaften und Emotionen vollzieht sich im dritten Akt in einer Folge von Duoszenen. Die Crux dabei: in dieser Liebesnacht findet nicht das ›richtige‹ Paar zueinander, ihre Störung am Ende wird durch die ›uneigentliche‹ Spannung herbeigeführt, die Loretta spürt. Eifersucht ist der Motor ihrer Handlung, doch den Zündfaden der Intrige hatte zuvor Lidoria ausgelegt, als sie der Asrael erwartenden Loretta auflauerte. Ihrer Vorfreude auf körperliche Glücksmomente mischt Lidoria die Angst vor Vernichtung und Tod bei, motivisch in sich verästelnden Orchesterstimmen gespiegelt, und reicht ihr doch zugleich auch ein magisches Gegenmittel für den Notfall. Loretta wird in dieser Szenenfolge zur eigentlichen Identitätsfigur des Dramas. Sie zeigt menschliche Regungen, Sehnsüchte und Hoffnungen, denen Franchetti in der vorgeschalteten lyrischen Soloszene (»Io t’amo… sapere non bramo«) einen adäquaten musikalischen Ausdruck zu geben verstand. Wenn Asrael dann endlich erscheint, verdichtet sich der musikalische Satz, als wollten sich nun tristanhafte Klangwellen im ekstatischen Rausch auftürmen. Die drängende Kantilene Asraels aus dem Finalensemble wird jetzt als ›Liebesmotiv‹ zum signifikanten melodischen Ereignis, eingebettet in einen orchestralen Satz, der tatsächlich Wagners Tristan-Welt abgehört und ausschnitthaft imitiert erscheint. Die liegenden, synkopisch-rhythmisierten Klangflächen der Streicher zu Lorettas Worten »Quando lo sguardo mio« sind gleichsam die italienische Vorankündigung von »O sink hernieder, Nacht der Liebe«. Denn erst im Juni 1888 konnte man in Bologna Tristan und Isolde erstmals südlich der Alpen hören – ein halbes Jahr nach Asrael. Richard Erkens
.
.

Franchettis „Asrael“/ Das Teatro Valli, 1895 das Teatro Municipale Reggio Emilia/ Wikipedia
Dazu noch ein Augenzeugenbericht eines Musikkritikers anlässlich der Premiere in Reggio Emilia: Ein großer Abend im Teatro Valli/ Reggio Emilia: Asrael, eine Oper von Baron Alberto Franchetti – Ein Bericht von Pio Benizzi, La grande serata di Asrael, aus „Interessi Locali“, Bologna, 20. Februar 1888. Pünktlich um 8 Uhr betritt Maestro Alberto Franchetti das Dirigentenpult und wird von einem allgemeinen, lang anhaltenden Applaus begrüßt. Dann herrscht eine tiefe, feierliche Stille, die die Bedeutung des bevorstehenden großen Ereignisses treffend wiedergibt. Das Vorspiel, das sorgfältig und exquisit ausgearbeitet ist und eine wunderbare Wirkung hat, deutet die beiden Hauptthemen der Oper an: das infernalische, das mit einer schrillen – wirklich infernalischen – Trompetenstimme verblüffend dargestellt wird, und das ätherische, das an die Szene im Paradies erinnert. Am Ende des Vorspiels bricht ein allgemeiner Beifall aus, der natürlich wiederum den Vorboten des großen, ohrenbetäubenden Beifalls darstellt, mit dem der neue Glanz der Oper gefeiert wird.
Das Urteil war feierlich, imposant, enthusiastisch, mit einstimmigem Votum und führte zu einer so glorreichen Bescheinigung der Verdienste, dass nicht nur der junge Maestro Franchetti, sondern auch jeder andere Maestro, selbst ein erfahrener und nicht neu in den glanzvollen Triumphen der Kunst, geehrt wurde. Asrael hat seinem Komponisten zweifellos einen hervorragenden Platz unter den erlesensten Kennern der musikalischen Oper gesichert; und diesen hervorragenden Platz – das möchten wir in hohem Maße bekräftigen – hat sich Baron Franchetti nicht mit den Millionen, deren glücklicher und immer noch beneideter Besitzer er ist, erobert, sondern durch eine nie laue Beständigkeit in Studium und Arbeit. Es ist bedauerlich, dass es nicht viele Menschen gibt, die sich, nachdem sie mit einem auffälligen Geburtsrecht und einem beträchtlichen Einkommen geboren wurden, mit einer solchen Liebe und Beharrlichkeit der Kultur der Wissenschaften und der Künste widmen, und aus diesem Grund ist der am Abend des 11. Februar 1888 für den jungen Baron Alberto Franchetti verhängte Triumph noch immer eine besondere Erwähnung wert, weil es weit über den Kreis dessen hinausgeht, was heute eine Sitte, ja die Bildung des Landes ausmacht – zumindest würde das edelste Beispiel Franchettis zahlreiche und wie er, würdige Nachahmer finden!

Franchettis „Asrael“/ Zeitschriften-Illustration der Schluss-Szene/ L´Opera italiana illustrata 1903/ Archiv Heinsen
Der Beginn des künstlerischen Lebens von Maestro Alberto Franchetti war triumphal, prächtig und schmeichelhaft. Aber die Kunst ist selbstsüchtig und ruht sich nicht auf den Verheißungen der Morgenröte aus, wie üppig sie auch sein mag, sie beansprucht für sich den ganzen Tag ihrer Verehrer und einen einzigartigen und triumphalen Arbeitstag. Baron Franchetti hat die Faser, den Einfallsreichtum, das Genie und das Studium, um die anspruchsvollen Hoffnungen der Kunst nicht zu enttäuschen, und Baron Franchetti lächelt strahlend auf die Zukunft des Künstlers. Und wie könnte Alberto Franchetti nicht über diese aufstrebende Zukunft eines Künstlers lächeln, wenn die Zukunft selbst von dem edlen Fräulein Margherita Levi geleitet wird, die mit den rosigen Knoten des Hymen im Begriff ist, ihre eigene mit ihrer Existenz zu identifizieren? Wir schmeicheln nicht, aber wir schreiben die Wahrheit, weil sie eine tief verwurzelte Überzeugung nahelegt. Haben Aristokratie, Geburt, Volkszählung, Tugend und Genie jemals zu einer glücklicheren und homogeneren Einheit verschmolzen, wie sie uns das höchst liebenswürdige und noble Paar Margherita Levi und Alberto Franchetti bietet?… Wir glauben nicht. Pio Benizzi/ Übersetzung DeepL Translate
.
.
Richard Erkens Artikel ist ein Auszug aus seinem Beitrag im Bonner Programmheft („Von der Hölle durch die Welt zum Himmel – Franchettis Gesellenstück ›de luxe‹ von 1888“), den wir mit großem Dank an den Autor übernahmen. Zum Autor: Richard Erkens studierte Theater-, Musik- und Literaturwissenschaft an der Universität Bayreuth, dann an der Freien Universität Berlin. Dort promovierte er 2010 mit einer Monografie über Alberto Franchetti: Werkstudien zur italienischen Oper der langen Jahrhundertwende. Bis 2015 war er Leitender Konzert- und Musikdramaturg sowie Stellvertreter der Operndirektion am Theater Lübeck. Danach wechselte er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom, wo er u. a. Quellenstudien für sein Habilitationsprojekt über den Opern-Impresario im Italien des frühen 18. Jahrhunderts betrieb. Ab 2020 folgten weitere Stationen als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, eine zweisemestrige Vertretungsprofessor am Institut für Musikwissenschaft Weimar- Jena und aktuell ein Fritz-Thyssen-Stipendium am Deutschen Studienzentrum in Venedig. Als freier Kulturjournalist schrieb er Aufführungskritiken und führte Interviews für Fachmagazine. Das von ihm herausgegebene Puccini Handbuch (Stuttgart/ Kassel 2017) wurde in der Kritikerumfrage der Opernwelt als ≫Opernbuch des Jahres≪ ausgezeichnet. (Biographie Programmheft Bonn)
Der Artikel von Pio Benizzi stammt von der Website der Comune di Reggio Emilia Eventi a Reggio Emilia.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie hier.








 Meine milde Kritik gilt dem von mir stets geschätzten Dirigenten
Meine milde Kritik gilt dem von mir stets geschätzten Dirigenten  Sänger sind heute die Crux vieler moderner Aufnahmen oder Aufführungen.
Sänger sind heute die Crux vieler moderner Aufnahmen oder Aufführungen. Kaum etwas hört man zum ersten Mal – so gibt´s auch hier weitere,
Kaum etwas hört man zum ersten Mal – so gibt´s auch hier weitere,  Andere Mitschnitte wie etwa das nur auf
Andere Mitschnitte wie etwa das nur auf  Die wirkliche
Die wirkliche 









 PS.: Allerdings muss auch klargestellt werden, dass heutige
PS.: Allerdings muss auch klargestellt werden, dass heutige 




 Als hätte man es geahnt, dass die Zeisl-Wiederentdeckung weitergehen wird, findet sich auch auf der mit der Heymann- und Gilbert- Zeile
Als hätte man es geahnt, dass die Zeisl-Wiederentdeckung weitergehen wird, findet sich auch auf der mit der Heymann- und Gilbert- Zeile Vor einigen Jahren gab es unter dem Titel
Vor einigen Jahren gab es unter dem Titel  Unter dem Titel
Unter dem Titel