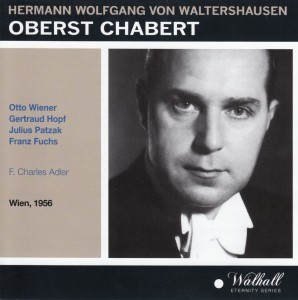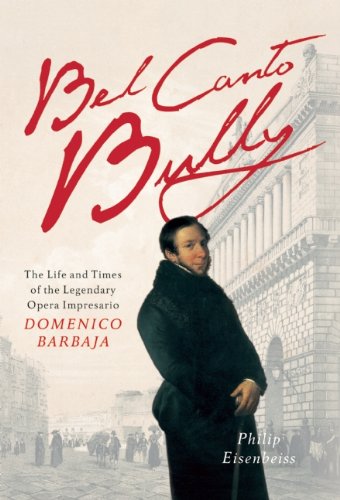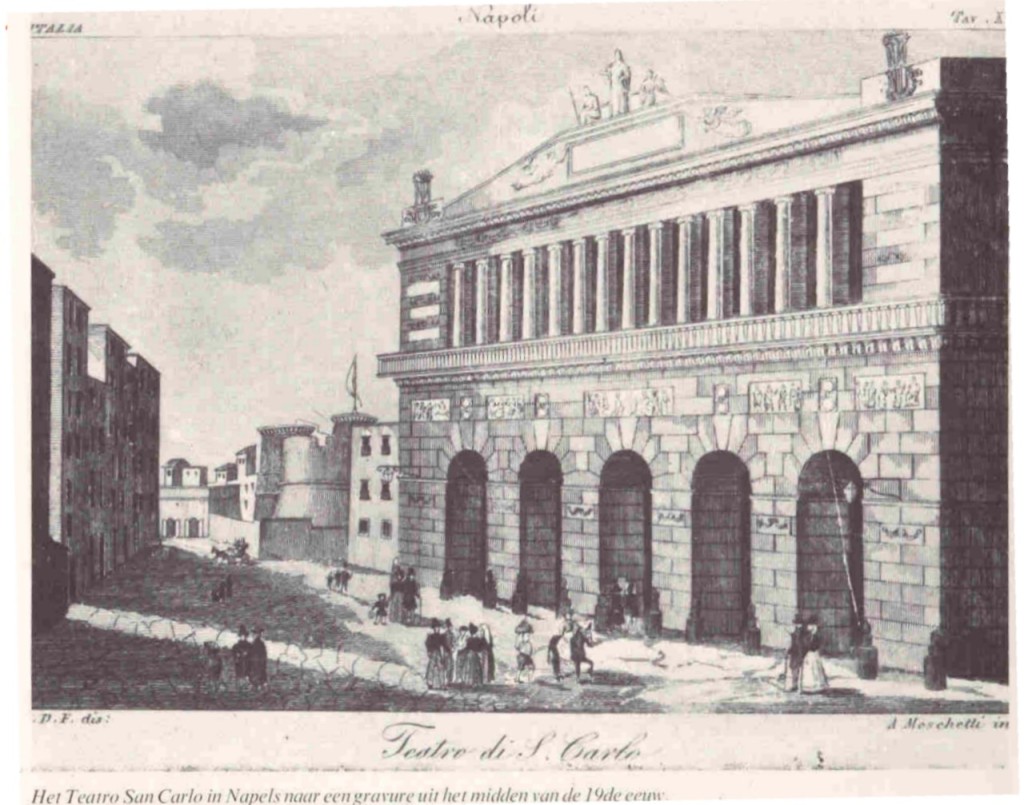Sie haben einmal erwähnt, dass die Entscheidung, den Figaro einzuspielen, erst nach Jahren des Durchdenkens und Erforschens all seiner Aspekte gefallen sei. Was hat Sie dazu bewegt, sich diesem Projekt mit solcher Intensität zu widmen?

Teodor Corretzis bei der Aufnahme in Perm/Anton Zavyalov/Sony
Eigentlich war es eine Figaro-Aufführung, die wir vor zehn Jahren in einem Moskauer Hospiz spielten, für eine Gruppe todkranker Patienten. Sie war als eine Feier des Lebens gedacht, und ich werde nie vergessen, wie die Musik auf dieses Publikum wirkte, dem das Stück, wie ich glaube, vollkommen unbekannt war. Beim Dirigieren ging mir ständig durch den Kopf: »Stell dir vor – sterben, ohne dieses Meisterwerk gehört zu haben.« Was aber, wenn wir alle in dieser Gefahr sind, selbst wenn wir mit dem Werk durch Aufnahmen und Aufführungen sehr vertraut sind? Was, wenn das Studium von Mozarts Partitur eigentlich etwas ganz anderes zu Tage fördert als das, womit unsere Ohren vertraut sind?
Aber es ist doch eine der bekanntesten Opern überhaupt. Es gibt unzählige Aufführungen und fast 200 Aufnahmen davon… Und so muss das auch sein, denn wir sprechen hier von dem größten Musiker, der je gelebt hat. Figaro, Così und Don Giovanni stellen das Höchste dar, wozu sein Genie fähig war. Und trotzdem, ich sage es noch einmal, ist es praktisch unmöglich, diese Musik so zu hören, wie er sie niedergeschrieben hat. (…) Denn was wir zu hören gewohnt sind, wurzelt in der Operntradition des 20. Jahrhunderts, und dieser Tradition ging es um die Vereinfachung des Materials. Es wurde akzeptiert, dass die Orchester immer lässiger mit rhythmischen und dynamischen Feinheiten umgingen. Die Solisten gewöhnten sich daran, den Notentext sozusagen annäherungsweise zu singen. Und es klingt sehr fein! Doch die Musik bleibt in der ersten Phase ihrer Erkennbarkeit stecken. Sie gelangt nicht auf jene Ebene von Präzision und Tiefe, auf der sich der volle Reichtum von Mozarts Genie offenbart. Diese Musik ist so perfekt, ob in ihrer Form, ihrer Ensembletechnik, der Harmonik, Dramaturgie oder Orchestrierung, dass sie immer »klingt«. (…) Das ist die Falle: Mozarts Werk klingt immer groß, und deshalb ignorieren viele Interpreten die Details.

und noch einmal ein Aufnahmefoto in Perm/Anton Zavyalov/Sony
Der Gesangstechnik des 20. Jahrhunderts mit ihren mächtigen Stimmen wollte vor allem großes Klangvolumen, um die immer größeren Theater füllen zu können. Verloren ging dabei die Idee von der Stimme als einer Palette von Klangfarben, die es erst erlaubt, dem Publikum das Werk vollständig darzustellen. Die Fähigkeit etwa eines Sängers, selbst einfache rhythmische Figuren wie Sechzehntel, Triolen oder Punktierungen auszuführen, galt als zweitrangig und wurde nicht mehr gründlich unterrichtet. Aber ohne diese Präzision hört das Publikum nichts als eine müde Annäherung an das wirklich Komponierte. Die Magie geht verloren.
(…) Die Radikalität meiner Aufnahme liegt in ihrer Präzision. Aber Präzision ist nicht Pedanterie. Im Gegenteil, sie eröffnet eine neue Welt der Freiheit und Improvisation. Nur durch strikteste Disziplin setzt man den wahren Duft dieser Musik frei, erweckt sie zu wirklichem Leben, erzeugt diese Farben, die auf der Bühne unmöglich sind. Darum haben wir so viel Zeit im Studio verbracht: Weil wir uns bis an unsere Grenzen und über sie hinaus gefordert haben, um zu einem neuen Verständnis dieses Werkes zu gelangen. Das ist das Privileg einer kompromisslosen Studio-Aufnahme.

Simone Kermes singt die Contessa/Pressefoto zur Solo-CD „Belcanto“/c. Gregor-Hohenberg/Sony
Sie hätten sich vielen anderen zentralen Meisterwerken der Musikgeschichte auf dieselbe Weise nähern können. Warum Figaro? Weil Mozart für mich von allen Komponisten der modernste ist und sein Figaro uns auf einzigartige Weise die mögliche Rolle der Oper in unserem heutigen Leben begreiflich machen kann. Ich glaube, dass diese Einzigartigkeit zwei Fundamente hat: einen revolutionären Geist und tiefe Spiritualität. Einerseits war die Oper nur den höchsten Schichten der Gesellschaft zugänglich. Andererseits unterwanderte die Handlung des Figaro die Konventionen des Genres, weil sie völlig inakzeptabel war für diese Schichten, die in Heuchelei lebten. In der Zeit, als Figaro entstand, wurden revolutionäre Ideen in Europa zum integralen Bestandteil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens, erzeugten vage Träume von einer neuen Renaissance des Lebens und der Kunst. So ist Mozarts Musik einerseits perfekt und von derselben großen Symmetrie erfüllt wie ein prächtiges Schloss im klassizistischen Stil. Gleichzeitig aber ist sie so revolutionär, dass sich an den Wänden der Raffinesse und des Moralismus Risse und Schäden zeigen. Dieser zerstörerischen Kraft, diesem Protest der Autoren verdankt das Werk seine ewige Relevanz.
Le nozze di Figaro enthält viele Skandale und Provokationen: Die heuchlerische Falschheit des Grafen, der öffentlich dem feudalen »ius primae noctis« entsagt, es aber bei Susanna ganz unverhohlen einfordert; das schockierende Durcheinander, das schließlich dazu führt, dass sich eine Gräfin und ihre Zofe nicht mehr voneinander unterscheiden lassen; die Intrige von Marcellina, die auf der Begleichung einer Schuld oder der Heirat besteht. All das sind Situationen, die im 18. Jahrhundert sehr wahrscheinlich an der Tagesordnung, nie aber so deutlich dargestellt worden waren – am allerwenigsten auf der Bühne eines Hoftheaters.

Teodor Corretzis/Robert Kittel/Sony
Der Notentext selbst bietet viele provokante Momente. Die erste Provokation passiert bereits in den allerersten Takten der Ouvertüre. Wer immer sie hört, ist absolut sicher, dass diese erste Phrase aus einer klassisch-symmetrischen Periode von acht Takten besteht, doch in Wirklichkeit sind es nur sieben. Nach nur sieben Takten bekommen wir zu spüren, wie Mozart sein Publikum erstaunen will, wie er alles um sich herum mit seinem Humor, seinem Zynismus und seiner Beseeltheit durchdringt.
Die Spiritualität durchzieht die gesamte Oper. Ohne dass sie in der Handlung offen dargestellt würde, ist sie ständig präsent. Mozart ist ein wahrer Alchimist, ein Mensch, der in einem gewöhnlichen Stein das Juwel sieht, das anderen Menschen verborgen bleibt, und der das eine in das andere verwandeln kann. Seine Betrachtungsweise geht viel weiter als alles, was wir uns auf der Basis des Librettos oder der konkreten Entstehungszeit der Oper vorzustellen vermögen.
Im Verlauf der Oper begegnen wir sämtlichen Typen und Phasen der menschlichen Entwicklung. Mozart untersucht unsere einfachen Lebensgeschichten durch seine Figuren, die allesamt in ihre unentwirrbaren, durch Vernunft nicht zu lösenden Situationen verwickelt sind. In der antiken Tragödie, wenn die Menschen die Verwicklungen ihrer eigenen Schicksale nicht aufzulösen vermochten, erschien manchmal ein deus ex machina, um ihren Dramen die entscheidende Wendung zu geben. Mozart aber lässt keine Gottheit eingreifen, sondern wird stattdessen selbst zum Gefäß einer göttlichen Harmonie. (…) Mozart braucht keinen deus ex machina. Er fordert die Menschen einfach auf zu schweigen, damit sie die Stimme der göttlichen Harmonie hören können. Sie ist immer da, mitten im Gebrüll und Geheul der Welt, und sie kann die Hölle des menschlichen Daseins in ein Paradies verwandeln. Diese Musik zeigt uns den Weg zur Wahrheit, und zugleich sagt sie uns, was wir alles loslassen müssen, um ans Ziel zu gelangen. Wir ahnen, dass sie recht hat, und wir ahnen, wie hart es sein wird, ihr zu folgen. (…)

Szene aus „Così fan tutte“ am Opernhaus Perm unter Teodor Corretzis/Anton Zavyalos/Opernhaus Perm
Die Klanglandschaft, in der diese Aufnahme das zum Ausdruck bringt, wird vielen Hörern sehr ungewöhnlich erscheinen. Besonders radikal ist wohl der Gesangsstil, den Sie mit den Sängern für diese Wiedergabe entwickelt haben – zum Beispiel im extrem sparsamen Gebrauch des Vibrato. Ich wollte eine Opernaufnahme machen, in der so wenig »opernhaft« gesungen wird wie nie zuvor. Es ging mir um einen Gesang von größter Intimität, der von Herzen kommt und direkt zu Herzen geht. Zum Vibrato: Jeder Ton hat sein natürliches, für ihn richtiges Vibrato. Die wahre sängerische Kunst besteht darin, dieses zu erkennen und zu unterstützen. Das Nonstop-Vibrato des 20. Jahrhunderts zerstört nur die Reinheit der Intonation und macht den Klang sowohl schwerer als auch schwächer. Und ich vermute, dass unsere Verzierungen für heutige Ohren das größte Überraschungselement sein werden. Man bekommt sie eben in der Regel gar nicht zu hören. Weil diese Ornamente in der Partitur nicht niedergeschrieben sind, wissen heute viele Interpreten nicht, was sie zu tun haben, und verzichten oft einfach darauf. Dabei wissen wir sehr genau, dass von den Sängern der Mozart-Zeit kunstvolle abbellimenti erwartet wurden und eine Aufführung ohne sie einfach inakzeptabel gewesen wäre. Solche Darbietungen können merkwürdig leer und mitunter sogar kalt klingen, denn wenn Mozart seine Noten schrieb, setzte er die spätere Ornamentierung voraus. Können wir uns ein Violinkonzert vorstellen, in dem keine Kadenz gespielt würde, nur weil der Komponist keine geliefert hat? Aber wir haben auch genügend Zeugnisse über damalige Sänger, deren Wahl bei Verzierungen von Zeitgenossen als geschmacklos kritisiert wurde. Wie finden wir also einen Stil, der dem entspricht, was Mozart hätte hören wollen?
Die Wahl der Ornamente, die Sie hier hören, basiert auf musikalischem Material, das in den 1770er- und 1780er-Jahren entstanden ist. Manches hat Mozart selbst für vokale oder instrumentale Stücke geschrieben, einiges stammt von Musikern, die mit ihm spielten oder arbeiteten, einiges von anderen Zeitgenossen. Den Rest habe ich selbst auf der Grundlage dieser historischen Materialien geschrieben. Die Quellen stehen jedermann zur Verfügung. Die Frage ist nur, wie man sie auf kreative Weise verwendet. (…) Ich halte die ganzen Diskussionen über die historische Authentizität musikalischer Darbietungen für sinnlos. Wir können die historische Wahrheit der Klänge, die Mozart hörte, ebenso wenig kennen wie wir seine Haut berühren können. MusicAeterna sucht die Instrumente dem jeweiligen Repertoire entsprechend aus. Bei Mozart verwenden wir Originalinstrumente oder moderne Kopien solcher Instrumente. Also Darmsaiten, barocke Bögen, Naturhörner, historische Holzblasinstrumente, barocke Pauken, ein Hammerklavier und so weiter und so fort. Ich verwende diese Instrumente nicht, weil ich glaube, dass sie mich einer historischen Wahrheit näher brächten, sondern weil sie mir die Lebendigkeit, die Reaktionsschnelligkeit, den straffen, festen, scharf definierten Klang liefern, der den ganzen Reiz dieser Musik ausdrückt. Ich verwende sie, weil sie besser klingen. Wäre ich der Meinung, diese Musik klingt besser auf elektrischen Gitarren, würde ich sie auf elektrischen Gitarren spielen. (…)
 Wenn ich mir den idealen Orchesterklang vorstelle, träume ich von einem Orchester vom Anfang des 18. Jahrhunderts, das aber schon vertraut ist mit dem Stil und den Instrumenten der Klassik und den Aufführungen von Mozarts Musik, der ein halbes Jahrhundert später komponierte. Ich halte unsere Art, Mozarts Werke zu interpretieren, nicht deshalb für progressiv, weil sie in die Zukunft blickt, sondern weil sie in die Zeit vor Mozart zurückschaut, in welcher er selbst seine Anregungen fand. Ob es uns gefällt oder nicht – wir erleben Mozarts Musik durch das Prisma der Post-Romantik und ihres Moralisierens. Wenn wir also einige Elemente benutzen, die schon aus der Mode gekommen waren, als Mozart dieses Werk schrieb, dann wird deswegen daraus keine Barockmusik, sondern sie tragen dazu bei, in Köpfen des 21. Jahrhunderts eine gewisse Balance /wischen Vergangenheit und Zukunft wiederherzustellen.
Wenn ich mir den idealen Orchesterklang vorstelle, träume ich von einem Orchester vom Anfang des 18. Jahrhunderts, das aber schon vertraut ist mit dem Stil und den Instrumenten der Klassik und den Aufführungen von Mozarts Musik, der ein halbes Jahrhundert später komponierte. Ich halte unsere Art, Mozarts Werke zu interpretieren, nicht deshalb für progressiv, weil sie in die Zukunft blickt, sondern weil sie in die Zeit vor Mozart zurückschaut, in welcher er selbst seine Anregungen fand. Ob es uns gefällt oder nicht – wir erleben Mozarts Musik durch das Prisma der Post-Romantik und ihres Moralisierens. Wenn wir also einige Elemente benutzen, die schon aus der Mode gekommen waren, als Mozart dieses Werk schrieb, dann wird deswegen daraus keine Barockmusik, sondern sie tragen dazu bei, in Köpfen des 21. Jahrhunderts eine gewisse Balance /wischen Vergangenheit und Zukunft wiederherzustellen.
Eines der sofort bemerkbaren Kennzeichen dieser Aufnahme sind die auffallend scharfen dynamischen Kontraste. Erwarten Sie Kritik wegen übertriebener Effekthascherei? Die ganze Vorstellung, die wir heute von Dynamik haben, entstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und es wurde seither immer schlimmer – fast so, als wollte man vor zuviel Emotion davonlaufen. Die 1980er-Jahre mit ihrem »objektiven Klang« – diese unausgesprochene Idee von der Klassik als einer sicheren Zone, wo alles hübsch ist und angenehm und nichts wehtut… Aber klassische Musik ist extrem. Ihr Geist ist viel wilder und rücksichtsloser, als wir das im 20. Jahrhundert zu würdigen gelernt haben. (…) Mein dynamischer Ansatz besteht also darin, das 20. Jahrhundert abzuschütteln und starke, lineare Kontraste zu erzeugen. Ich bin sicher, dass sich einige Menschen darüber wundern werden, weil sie an die moderate Dynamik gewöhnt sind, in der forte oft ein bisschen zu leise genommen wird und piano ein bisschen zu laut. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass es alleine von forte bis piano vier Hauptstufen gibt (forte, mezzoforte, mezzopiano, piano), die ihrerseits wieder eigene Abstufungen haben. Bei unserer Arbeit wurde die größtmögliche Sorgfalt auf diese Nuancen verwandt, um sie von Vokalensemble und Orchester in absoluter Synchronizität hören zu können.

Blick in den Zuschauersaal der Permer Staatsopr mit Ballett/Tschaikowsky-Staatsoper Perm
Für uns war dieses Projekt sehr wichtig, so schwierig und schmerzhaft es auch war. Es gibt so viele Aufnahmen, die den allgemeinen Geist von Mozarts Musik vermitteln. Eine neue Einspielung hat nur dann Sinn, wenn man dem Publikum damit die Möglichkeit gibt, die ganze Magie zu erfahren, die in dieser Partitur steckt. Ich habe diese Aufnahme gemacht, weil ich zeigen wollte, was möglich ist, wenn man die Fabrikmentalität des Klassik-Mainstreams meidet. Mein Credo ist, dass jede Aufführung, die man gestaltet, wie eine Schwangerschaft sein muss. Man muss träumen und man muss warten. Bis die Zeit gekommen ist, in der man das Wunder geschehen sieht. Wer nicht so in der Musik lebt, der verfehlt ihre zentrale Idee. Musik ist kein Beruf, und es geht darin nicht um Reproduktion. Musik ist eine Mission.
Das Gespräch führte Marc de Mauny, Direktor der Tschaikowsky-Staatsoper, Perm, und wir entnahmen es mit sehr starken Kürzungen der außerordentlich üppigen Beilage zur neuen Aufnahme bei Sony (mit Simone Kermes, Andrei Bondarenko, Fanie Antenetou, Christian van Horn, Mary-Ellen Nesi, Maria Forsström, Nikolai Loskutin u. a.; MusicAeterna und Orchester/Chor des Opernhauses Perm; Dirigent – Teodor Curretzis), wo bereits in diesem Jahr Così fan tutte und im nächsten Don Giovanni folgen werden. Eine Rezension der neuen Einspielung nimmt der Kollege Peter Sommeregger in diesen Seiten vor. Redaktion G. H.



 Und offenbar liegt eine solche Gestaltung im derzeitigen Trend, denn auch die neue CD des Italieners Filippo Mineccia bei Pan Classics (PC 10297 im Vertrieb von note 1 music) mit dem Titel Alto Arias würde man eher ins Pop-Regal einordnen. Sie zeigt den Sänger Zähne fletschend mit kurz rasiertem Schädel und offenem schwarzem Military-Jackett wie einen Skinhead, was einen seriösen Musikliebhaber eigentlich abstoßen dürfte. Und die Stimme gleicht diesen optischen Vorbehalt nicht aus, sie klingt oft unangenehm krähend und schneidend in der Höhe. Einzig das Programm, 14 Arien aus Opern und Oratorien sowie einer Serenata von Leonardo Vinci, die der Komponist ausnahmslos für die Altstimme schrieb, ist bei dieser Ausgabe von Interesse. Und auch das begleitende Ensemble, Stile Galante unter Stefano Aresi, erweist sich als versierter und inspirierender Partner für den Solisten. Der italienische Komponist und einer der größten Konkurrenten von Nicola Porpora ist seit der sensationellen Veröffentlichung seines Artaserse bei Virgin mit nicht weniger als fünf Altisten/Sopranisten, an die hinsichtlich der gesanglichen Virtuosität horrende Anforderungen gestellt werden, wieder aktuell im Gespräch. Auch bei dieser Auswahl, die mit der Arie „Bella pace“ aus der Oper Gismondo re di Polonia beginnt, ist solch exorbitante Gesangskunst unabdingbar, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Und offenbar liegt eine solche Gestaltung im derzeitigen Trend, denn auch die neue CD des Italieners Filippo Mineccia bei Pan Classics (PC 10297 im Vertrieb von note 1 music) mit dem Titel Alto Arias würde man eher ins Pop-Regal einordnen. Sie zeigt den Sänger Zähne fletschend mit kurz rasiertem Schädel und offenem schwarzem Military-Jackett wie einen Skinhead, was einen seriösen Musikliebhaber eigentlich abstoßen dürfte. Und die Stimme gleicht diesen optischen Vorbehalt nicht aus, sie klingt oft unangenehm krähend und schneidend in der Höhe. Einzig das Programm, 14 Arien aus Opern und Oratorien sowie einer Serenata von Leonardo Vinci, die der Komponist ausnahmslos für die Altstimme schrieb, ist bei dieser Ausgabe von Interesse. Und auch das begleitende Ensemble, Stile Galante unter Stefano Aresi, erweist sich als versierter und inspirierender Partner für den Solisten. Der italienische Komponist und einer der größten Konkurrenten von Nicola Porpora ist seit der sensationellen Veröffentlichung seines Artaserse bei Virgin mit nicht weniger als fünf Altisten/Sopranisten, an die hinsichtlich der gesanglichen Virtuosität horrende Anforderungen gestellt werden, wieder aktuell im Gespräch. Auch bei dieser Auswahl, die mit der Arie „Bella pace“ aus der Oper Gismondo re di Polonia beginnt, ist solch exorbitante Gesangskunst unabdingbar, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.











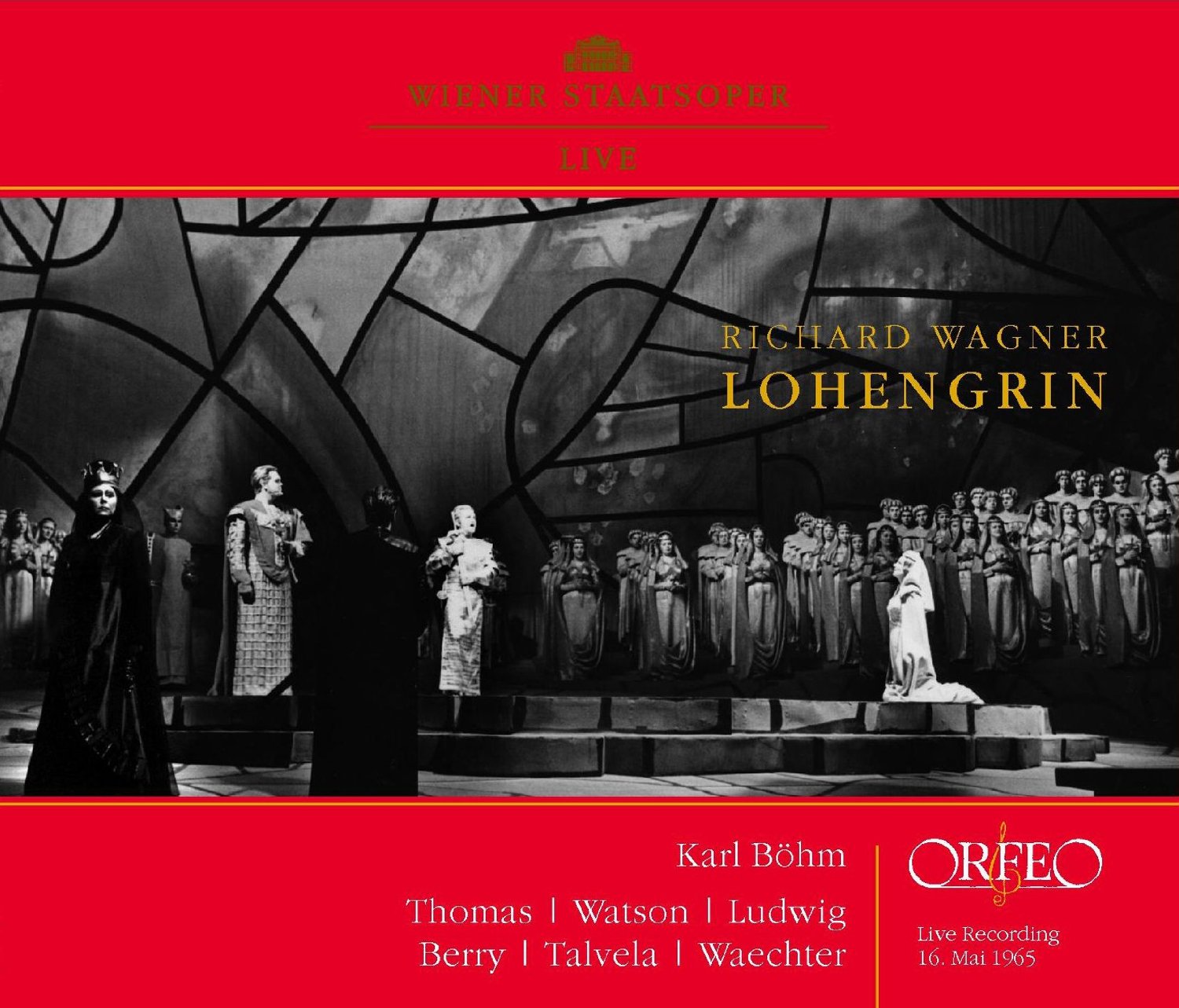




 Eine andere wichtige Facette ihres Wirkens waren Lieder von Hanns Eisler, die sie auch live bei Auftritten im Ausland vorgetragen hat. Der Komponist selbst schätze ihre Intelligenz, ihre Anmut, aber auch ihre Härte und ihren Ernst. „Dazu kamen echter Fleiß und der Wille, es immer besser zu machen, der gute Ehrgeiz, der vorwärts treibt“, so Eisler über die Arnold. Während das Füchslein als Film überdauert hat, ist ihre Violetta in Verdis La Traviata – das berühmte Gegenstück ihrer langen Karriere – als Ganzes nur in der Erinnerung von Zeitzeugen und in Beschreibungen bewahrt. Es dürfte keinen Mitschnitt geben. Dabei soll sie weniger durch ihre stimmlichen Mittel, die auch begrenzt gewesen sind, als vielmehr durch ihre Ausstrahlung zu einer Wahrhaftigkeit gelangt sein, die das Publikum tief bewegte und erschütterte.
Eine andere wichtige Facette ihres Wirkens waren Lieder von Hanns Eisler, die sie auch live bei Auftritten im Ausland vorgetragen hat. Der Komponist selbst schätze ihre Intelligenz, ihre Anmut, aber auch ihre Härte und ihren Ernst. „Dazu kamen echter Fleiß und der Wille, es immer besser zu machen, der gute Ehrgeiz, der vorwärts treibt“, so Eisler über die Arnold. Während das Füchslein als Film überdauert hat, ist ihre Violetta in Verdis La Traviata – das berühmte Gegenstück ihrer langen Karriere – als Ganzes nur in der Erinnerung von Zeitzeugen und in Beschreibungen bewahrt. Es dürfte keinen Mitschnitt geben. Dabei soll sie weniger durch ihre stimmlichen Mittel, die auch begrenzt gewesen sind, als vielmehr durch ihre Ausstrahlung zu einer Wahrhaftigkeit gelangt sein, die das Publikum tief bewegte und erschütterte.