Mit Hanna Ludwig, eminente Gesangspädagogin, ehemalige Professorin am Salzburger Mozarteum, berühmte Mezzospranistin und Liedersängerin von Gnaden, habe ich eine geliebte Freundin verloren. Am 10. 1. 1918 wurde sie geboren – und zum Hundertjährigen möchte ich sie noch einmal ehren. Sie starb bereits 2014 (am 10. 3. laut Grabstein auf dem Waldfriedhof im bayerischen Traunstein) , aber wir hatten ihren Tod in operalounge.de damals nicht gewürdigt. Was mich grämt. Denn diese große, ebenso charmante wie ernsthafte Frau verdient auch bei uns einen Nachruf, eine Würdigung für die lange und tiefe Freundschaft, die wir miteinander hatten, und für die Spuren lassende Tätigkeit am Mozarteum und später als private Lehrerin im reizenden, geheimnisvollen und hochindividuell mit Curiosa gefüllten Haus in der Hegigasse Nr. 7, wo ein klarer Bach durch den Garten murmelte und ein Garten-Pavillon zum Schreiben und Verweilen einlud. Festspielgäste machten gerne den Weg über den Mönchsberg zu ihr oder zurück. Gäste schliefen wie im Paradies ebenerdig neben dem geschmackvoll-persönlich eingerichteten Salon. Stets abends mit einem Zettel auf dem Kopfkissen, der eine Lebensweisheit aus Indien oder Asien enthielt. Und nachts gaben der Kühlschrank und die gut bestückte kleine Kammer unter der Treppe Alkoholisches vom Besten preis.

Hanna Ludwig: Bewegungsunterricht in der Hegigasse 7/ Ludwig
Ach Hanna! Wenn sie anfing: „Bub´, schau mal…“ begannen Unterhaltungen ohne Ende, gab es bilderreiche Erzählungen von Auftritten in Bayreuth, in Asien und Arabien (wohin sie ihr Herz verloren hatte und von ihren Schülern als „meine Kinder“ sprach), in beiden Amerikas und der Welt. Diese Liederabende! Um den ganzen Globus. Die schreckliche Geschichte, als sie nach einem Sturz stundenlang bewegungslos gelähmt in einem Moskauer Badezimmer lag und keine Hilfe kam. Da aktivierte sie ihre machtvollen spirituellen Kräfte, ihr Über-Ich, denn sie glaubte fest an diese esotherische Alternative des materiellen Seins.
Hannas Gesangskarriere wurde, nach Glanz in Düsseldorf, Bayreuth und den Häusern der Welt, jäh durch einen Überfall beendet, bei dem sie gewürgt wurde und die Gesangsstimme verlor. Aber als Pädagogin erklomm sie ganz andere Gipfel, hatte einen weitreichenden Namen für ihr Reparieren von angegriffenen Stimmen, auch solche mitten in einer Karriere. Marilyn Horne war bei ihr zu Gast, die Namensschwester Christa Ludwig suchte ihren Rat ebenso wie viele, viele andere renommierte Sänger. Ähnlich wie ihre – von mir ebenfalls langjährig geliebte – Berliner Kollegin Ira Hartmann-Dressler kannte sie das Geheimnis, wie man Stimmen wieder aufbaut, festigt, repariert. Und ihre Schüler – Diana Damrau ist eine davon – profitierten von ihrem reichen Wissen.

Hanna Ludwig in ihrem Salzburger Garten, rechts Geerd Heinsen/Foto GH
Wer Hanna Ludwig kannte, weiß, dass man sie nicht mit wenigen Worten beschreiben kann – Hanna war ein Gesamterlebnis. Ihre ungebrochene Art, ihre unverblümte Redeweise, ihre mannigfaltigen Interessen, ihre unüberwindlich positive Einstellung zum Leben machten sie zu einem der ungewöhnlichsten Menschen, denen ich begegnet bin. Sie war gütig, stets freundlich, liebevoll, mitteilsam und immer an dem interessiert, was einen bedrückte oder durch den Kopf ging, am Lustig-Guten ebenso wie am weniger Lustigen, eben eine mütterliche Freundin, ein mentaler Sparring-Partner, eine Therapeutin (Dieses Porträt wird offensichtlich eine Liebeserklärung!).
Ich habe viel mit ihr gesprochen und in der Salzburger Hegigasse 7 oft bei ihr gewohnt – das Alter schien ihr lange nichts anzuhaben, denn kaum jemand war wie sie so tatkräftig-jung geblieben. Wer sie mit energischem Schritt und ebenso energischen Bewegungen sah, konnte sich kaum vorstellen, dass es 70 oder 80 oder mehr Jahre waren, die die im oberpfälzischen Lauterbach geborene Sängerin für sich in Anspruch nehmen konnte. So wie sie aus der Bewegung (und aus der meditativen Selbstversenkung) lebte, so wichtig fand sie die Hilfestellung für Sänger, musikdramatischen Unterricht anzubieten; und die Zahl derjenigen, denen sie damit geholfen und deren Stimmen sie „repariert“ hat, ist Legion (und es sind berühmte Namen darunter).

Hanna Ludwig:Eboli/ Sammlung Ludwig
Hanna Ludwig konnte auf eine interessante und bewegte eigene Karriere als Altistin/Mezzosopranistin zurück blicken. Angefangen hat sie als Studentin bei der ebenfalls berühmten Mezzosopranistin Luise Willer und bei der Pädagogin Franziska Martienssen-Lohmann in Hamburg, bei Herbert Erlenwein und vor allem auch bei Rudolf Hartmann. Ihr erstes Engagement führte sie als 1. dramatische Altistin nach Koblenz, dann nach Freiburg; sieben Jahre war sie Solistin bei den Bayreuther Festspielen unter so eminenten Dirigenten wie Knappertsbusch, Keilberth, von Karajan, Sawallisch u. a. und im Kreise illustrer Kollegen. In diese Zeit fällt auch ihr Festengagement an der Deutschen Oper am Rhein, Düsseldorf, und an den Städtischen Bühnen Köln. Zudem führten sie schon früh in ihrer Karriere begonnene Liederabende – denn sie galt als eine der klassischen Vertreterinnen des vor allem deutschen Liedes – nach Persien und Indien, nach Hong-Kong, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Burma, auf die Philippinen, nach Japan und Amerika (beide). Ihre Opernengagements folgten als Einzelverpflichtungen oder als Gesamtgastspiele dieser Route, namentlich ihre Auftritte mit der Wiener Staatsoper, den Salzburger Festspielen, der Mailänder Scala, dem Fenice in Venedig, dem Liceo in Barcelona, in Amsterdam, Dublin, Zürich, Genf unter Dirigenten von Solti bis Sawallisch, von Kempe bis Klemperer.

Hanna Ludwig und Indira Ghandi 1957/ Foto Roland Ropers Archiv/ Sammlung Ludwig
Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, (weitgehend Live-) Schallplatten zeugen von einer ebenso reichen wie bewegten Tätigkeit in buchstäblich jedem wichtigen Musikzentrum der Welt. Wobei sie nicht wirklich reichlich auf Dokumenten vertreten ist – Melodram hatte mal ein Klappalbum von ihr herausgebracht mit Auszügen aus ihren Bayreuth- und Rundfunkauftritten (Rheingold, Walküre, Parsifal); Gala hatte ihre Schanktochter in den Königskindern neben Peter Anders veröffentlicht, Walhall ihre 3. Dame in der Zauberflöte unter Keilberth, Adelaide neben Anny Schlemms Arabella und ein Meermädchen im Oberon erneut unter Keilberth; bei EMI gibt es Eine Nacht in Venedig unter Ackermann, bei DG die Stimme der Mutter in Hoffmanns Erzählungen sowie darin auch, nun bei BNF, Giulietta neben William McAlpine. Ein Blick zu Amazon zeigt sie in den vielen kleinen Partien, in denen sie überliefert ist, ihre wichtigen Rollen fehlen.

Hanna Ludwig: Orpheus/ Sammlung Ludwig
Ab 1968 zog sie sich von der Bühne zurück und konzentrierte sich auf ihre immer stärker werdende Lehrtätigkeit, für die sie sich einen immer bekannter werdenden Namen gemacht hatte. Sie wurde Professorin am Hindemith-Konservatorium in Ankara für Gesang und musikdramatische Darstellung, Professorin und Leiterin künstlerischer Ausbildungsklassen am prestigereichen Mozarteum in Salzburg, dort zur Hochschulprofessorin ernannt und später emeritiert. Sie weitete dann ihre Tätigkeit wiederholt auf die Philippinen aus, wo sie in Manila über Jahre Meisterklassen abhielt (und dort ebenfalls hochgelobt wurde – überhaupt konnte sie mit ihren Ehrenauszeichnungen einen ganzen Schrank füllen, nicht zu vergessen den beeindruckenden Orden eines indischen Maharadschas in Form eines kostbaren Ringes, den wir unter Gelächter hinter dem Kühlschrank in der Küche hervorfischten – was für ein Brummer). Sie arbeitete als Pädagogin in Hong-Kong, an der Vadstena Akademie in Schweden, in Oslo und Esverum in Norwegen, erneut wiederum in Salzburg am Mozarteum, bei der Jury der Herbert-von-Karajan-Stiftung in Salzburg und mit großem Erfolg mit Meisterklassen, so bei der Richard-Strauss-Stiftung und des Münchner TonkünstlerVerbandes.

Hanna Ludwig: am Klavier in der Hegigasse 7/ Foto Lindner/ Sammlung Ludwig
Hanna Ludwig war ein Gesamterlebnis. Wer noch das Glück gehabt hatte, ihre nachdrücklichen Bühnenfiguren zu erleben – vom elegant-frechen Octavian über eine ungewöhnliche Carmen, Clairon, Fricka oder Brangäne bis hin zur gespenstischen Gräfin in Pique Dame und vielen anderen Rollen (nicht zu vergessen ihre Kundry) -, dem kam der Übergang zur intensiven, Gesamtkunst-Werkliches anstrebenden Pädagogin gar nicht so verschieden vor. Hanna Ludwig legte immer schon, namentlich als Sängerin selbst, größten Wert auf die Umsetzung des Wortes in die musikalischen Valeurs, auf die exemplarische Diktion, auf einen wirklich erfüllten und erfühlten Gesang (der auf einer perfekten Technik basieren muss). Der beste Weg, eine Stimme zu entfalten, ging für sie über die Psyche. Wie sie in einem früheren Interview sagte: „Der stimmliche Entwicklungsprozess ist ein organischer Wachstumsvorgang und greift tief in den menschlichen Bereich. Singen ist mehr als nur Stimmproduktion. Aus Stimmbesitzern müssen Sänger und aus Sängern dann Sängerdarsteller werden, d.h. Künstler. Die Kunst, vor allem der Dienst an der Kunst, muss im Mittelpunkt stehen. Nur durch unbedingte Hingabe an die Musik, durch hohe Disziplin und ständig neue geduldige Lernbereitschaft können die jungen Sänger vorwärts kommen. Lust und Liebe zum Theater müssen die Grundlage zu großen künstlerischen Taten sein. Schwung, Begeisterung und Mut sollen mittrainiert werden! “ Wer konnte das besser als Hanna Ludwig!
Ach Hanna! Wie Du mir fehlst! Ich blicke auf das schöne Rötelportrait von Dir an meiner Wand der Diven und höre dein fränkisches Lachen, sehe Dich in Deiner großen Beweglichkeit durch den Garten rennen, sehe Dich in Ausgehuniform mit Turban auf dem grauen Kopf und der eleganten Seidenstola um die Schultern. Du fehlst mir, und nicht nur mir. Ruhe in Frieden. Du wirst geliebt. Geerd Heinsen

Hanna Ludwig: Probenarbeit rnit dem Tenor Timothy Jenkins
für dessen ersten Parsifal an der Met 1983/ Sammlung Ludwig
Und dazu ein historisches Gespräch mit der Gesangspädagogin Hanna Ludwig anlässlich ihres 80. Geburtstags – natürlich geht’s um´s Singen. Ein bisschen sehr ernst oder „humorlos“ vielleicht, ein bisschen sehr apodiktisch, aber sie war eben unbedingt in ihren Forderungen an sich selbst und ihre Schüler. Da gab es nichts Leichtfertiges. Und es hätte sie gefreut, ihre Ausführungen dazu noch einmal öffentlich selber vorzutragen.
Nun also: Auf der Bühne warst Du wohl das, was man eine Vollblutkünstlerin nennt. Deine Interpretationen des Octavian, des Orpheus, des Komponisten bleiben ebenso wie Deine Carmen, Eboli , Brangäne, Ortrud oder Kundry unvergessen für alle, die Dich gesehen haben – wie ältere Operngänger immer wieder betonen. Konntest Du aus der großen Fülle Deiner Erfahrungen als Bühnen- und Konzertsängerin eine bestimmte Lehrmethode entwickeln, oder gibt es bei Dir keine sogenannte Methode? Ich möchte jedem Schüler den individuellen Weg zu seiner sängerischen und künstlerischen Selbstverwirklichung zeigen und habe für meine Lehrweise herausgefunden, dass der Weg zum Sänger und Sängerdarsteller am effektivsten über die Dreiheit sängerische Bildung (Stimmtechnik), Künstlerbildung und Persönlichkeitsbildung als Einheit führt. Zunächst möchte ich sagen, was ich unter sängerischer Bildung verstehe. Ich finde, die Überbewertung des Begriffes Technik sollte mehr zurückgenommen werden, denn der Begriff Technik an sich ist leblos. Da der Stimmentfaltungs-Prozess jedoch organischer Natur ist, müssen wir die sogenannte Stimm-Technik musizierend zum Leben erwecken . Die eigene innere Musizierfreude und Musizierleidenschaft muss spürbar und hörbar werden und auf den Zuhörer überspringen . Der ganze Mensch muss sich in der Präsenz, d. h. bewusst sängerisch-musikalisch und sprachlich zum Ausdruck bringen. Ich nenne es musizierende Technik .

Hanna Ludwig: Carmen mit Jess Thomas/ Sammlung Ludwig
Verbunden mit der musizierenden Technik ist die Sprache. Es liegt mir sehr daran, dass die Schüler Sinn und Eigenart der jeweiligen Sprache erkennen und erfassen. Am besten jedoch ist es, wenn sie sich in sie verlieben, dann verlieben sie sich auch in die Vokale und Konsonanten und gleichzeitig in die dazugehörige Musik. Das gilt natürlich nicht nur für die Oper, sondern vor allem auch für das Lied und das Oratorium. So wird die Begeisterung für die Sprache, verbunden mit der Musik, zur Kraftquelle und zum Animator der sängerischen und darstellerischen Aufgaben. Dies konnte ich besonders bei meinen Spezialkursen für das deutsche Fach erfahren, als ich die Solisten der National Opera Oslo für Meistersinger, Salome und Entführung sowie die schwedischen Sänger in Stockholm für Tannhäuser vorbereitete. Auch an der MET in New York, wo ich mit dem amerikanischen Heldentenor Timothy Jenkins stimmlich und darstellerisch die Partie des Parsifal erarbeitete, machte ich dieselbe Erfahrung: Je mehr ich den Sänger von seinen Sprachschwierigkeiten ablenkte und ihn in die Musizier- und Sprachfreude hineinlockte, desto besser gelang es mir, ihn für Wagner-Partien in Wort und Musik zu begeistern und ihm dadurch zum Erfolg zu verhelfen .
Eine große, wenn nicht die wichtigste Rolle spielt dabei die Kunst der Phrasierung. Jede Phrase muss voraushörend erlebt und mit musikalischem Leben erfüllt werden. Phrasierung heißt also immer, in der Empfindung des permanenten Fortsetzens bleiben. Dadurch erneuert sich die Phrase in sich selbst, da sie jedem Ton immer wieder dieselbe Kraft innerhalb des musikalischen Ablaufes sichert. Dieser Vorstellung gleicht sich der Atemvorgang an, das heißt, er erneuert sich in der gleichen Weise. Souveräne Atembeherrschung heißt von der Überzeugung auszugehen, dass der Atem stetig und in unendlicher Fülle vorhanden ist, permanent zur Verfügung steht und jederzeit von der musikalischen Phrasengestaltung abgerufen werden kann. Um den großen Anforderungen unseres heutigen Musiktheaters gewachsen zu sein, muss also zur schönen Stimme und musikalischen Intelligenz vor allem auch der geistige Gestaltungswille hinzukommen. Nur aus diesem Zusammenspiel kann schöpferische Interpretation erwachsen, und damit haben wir das Thema Künstlerbildung erreicht.

Hanna Ludwig: „Rheingold“ mit Elisabeth Schwarzkopf und Hertha Töpper/ Sammlung Ludwig
Wir wissen alle, was ein Künstler leisten soll, was von ihm erwartet wird, und dennoch – auch das wissen wir – ist es unendlich schwierig, einen Künstler heranzubilden. Man redet sich dann oft auf die mangelnde Persönlichkeit heraus und erklärt, die stimmlich-musikalische Begabung allein sei noch nicht genug . Aber wie kann man eine Persönlichkeit fordern, wenn man sie nicht vorher bildet? Singen muss mehr sein als nur Stimmproduktion. Die Kunst, vor allem aber der Dienst an der Kunst muss dem Lernenden eindringlich nahegelegt werden. Nur durch unbedingte Hingabe an die Musik, durch Selbstdisziplin und ständig neue geduldige Lernbereitschaft kann der junge Sänger das nötige Rüstzeug erhalten, um sicher zu werden und erfolgreich zu sein. Wie leicht wird er sonst Opfer des zermürbenden Konzert- und Theateralltags, wenn er ihm nicht das entgegenhalten kann, was den Künstler ausmacht – die Verantwortung: der Kunst, sich selbst und dem Publikum gegenüber.
Im Mittelpunkt muss also die Persönlichkeitsbildung stehen . Wenn ich erwarte, dass der Künstler zwischen Kunstwerk und Publikum vermitteln soll, und wenn ich verlange, dass durch den Sänger das Kunstwerk aus seiner allgemeingültigen, damit aber abstrakten Bedeutung immer wieder neu zum ergreifenden , überzeugenden und besonderen Erlebnis wird, muss hinter dem Künstler unbedingt die menschliche und geistige Persönlichkeit stehen .

Hanna Ludwigs Grabstätte im bayerischen Traunstein (Waldfriedhof 83278 Traunstein, Wasserburger Straße 94)/ mit Dank an Karl Georg Hart
Wie gehen Deine Schüler auf all diese Forderungen ein? Anfangs sind sie natürlich ein wenig überrascht, da sie es gewohnt sind, mehr von der Vorstellung einer mechanisch und automatisch funktionierenden Gesangstechnik auszugehen . Wenn sie es aber nach einiger Zeit erfasst haben, die technischen Funktionen des Gesangsinstrumentes mit all seinen physischen und psychischen Aspekten spielerisch zu handhaben, macht es ihnen große Freude, den eigentlich müheloseren Weg zu ihrer sängerischen Selbstverwirklichung zu erlernen und zu gehen. Rückblickend darf ich feststellen, dass vielen meiner deutschen wie auch ausländischen Schüler der Sprung auf die Konzert- oder Opernbühne gelungen ist. Sechs russische Sänger zum Beispiel, die ich vor einigen Jahren direkt vom Tschaikowsky-Konservatorium Moskau nach Salzburg holte und die ich lehrte, forderte und förderte, fanden bereits nach einem Jahr Engagements an hervorragenden deutschen und Schweizer Bühnen.
Ein Wort zum Schluss: Ob rasche Karriere oder langsamer Aufstieg – gleichviel. Von unseren jungen Nachwuchssängern, ihrem Können, ihrer Persönlichkeit, ihrer Phantasie und künstlerischen Gestaltungskraft wird es abhängen, ob die Kunstgattung Oper auch in künftigen Generationen ihre lebendige musikalisch-dramatische Faszination ausstrahlen kann. (Das Gespräch führte Geerd Heinsen, 1998)
(Foto oben Hanna Ludwig als Octavian/ Sammlung Ludwig; alle weiteren hier verwendeten Fotos stammen aus der Sammlung von Hanna Ludwig und können – soweit nicht genannt – den Fotografen nicht mehr zugeordnet werden; wir bitten um Entschuldigung, dass wir wegen der langen vergangenen Zeit im Einzelfall nicht um Genehmigung anfragen konnten.)
 Konzeptionell schlüssiger ist die Robert Schumann gewidmete CD angelegt, die ebenfalls bei Capriccio herausgekommen ist (C5172). Wieder begleitet Charles Spencer. Sie enthält die Lieder auf zwölf Gedichte von Justinus Kerner Op. 35, die sechs Vertonungen von Nikolaus Lenau, einschließlich das „Requiem“, das Schumann nach neuesten Forschungen nicht auf die – wie es im Booklet heißt – „anonyme Übersetzung eines alten Lateinischen Gedichts von Heloise und Abelard“ komponierte sondern im Werk des Schriftstellers, Übersetzers und Notars Lebrecht Dreves fand. Diese Gruppe trägt die Bezeichnung Op. 90. Dazwischen sind die Lieder „Es leuchtet meine Liebe“, „Mein Wagen rollet langsam“ und „Belsazar“, allesamt von Heinrich Heine gedichtet, gruppiert. Wenngleich die Ballade „Belsazar“ in dieser Aufnahme nicht ganz fünf Minuten beansprucht, gilt sie als die umfangreichste Liedkomposition Schumanns. Edelmann trägt sie ganz vorzüglich und spannungsreich vor. Sie hätte noch viel länger dauern können. Er ist auch diesmal sehr gut zu verstehen. Mir scheint, dass ihm das erzählerische Element, wie es Balladen eigen ist, mehr liegt als malerische Lyrik. Sein robuster Bariton kommt dabei besser zur Geltung. Nach Schubert und Schumann nun Johannes Brahms.
Konzeptionell schlüssiger ist die Robert Schumann gewidmete CD angelegt, die ebenfalls bei Capriccio herausgekommen ist (C5172). Wieder begleitet Charles Spencer. Sie enthält die Lieder auf zwölf Gedichte von Justinus Kerner Op. 35, die sechs Vertonungen von Nikolaus Lenau, einschließlich das „Requiem“, das Schumann nach neuesten Forschungen nicht auf die – wie es im Booklet heißt – „anonyme Übersetzung eines alten Lateinischen Gedichts von Heloise und Abelard“ komponierte sondern im Werk des Schriftstellers, Übersetzers und Notars Lebrecht Dreves fand. Diese Gruppe trägt die Bezeichnung Op. 90. Dazwischen sind die Lieder „Es leuchtet meine Liebe“, „Mein Wagen rollet langsam“ und „Belsazar“, allesamt von Heinrich Heine gedichtet, gruppiert. Wenngleich die Ballade „Belsazar“ in dieser Aufnahme nicht ganz fünf Minuten beansprucht, gilt sie als die umfangreichste Liedkomposition Schumanns. Edelmann trägt sie ganz vorzüglich und spannungsreich vor. Sie hätte noch viel länger dauern können. Er ist auch diesmal sehr gut zu verstehen. Mir scheint, dass ihm das erzählerische Element, wie es Balladen eigen ist, mehr liegt als malerische Lyrik. Sein robuster Bariton kommt dabei besser zur Geltung. Nach Schubert und Schumann nun Johannes Brahms. In einer Box bietet Capriccio auf drei CDs Die schöne Magelone an (C5225). Warum so umfangreich? Zunächst sind die fünfzehn Lieder so, wie sie der Komponist als Zyklus verstanden wissen wollte, separat zu hören. Zum anderen werden die selben Aufnahmen in verbindende und – was viel wichtiger ist – erklärenden Prosatexte aus der „Wundersamen Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence“, die Ludwig Tieck nach einem alten Volksbuch neu erzählt hat, eingebunden. Brahms wollte diese Verknüpfung nicht und lehnte einen entsprechenden Vorschlag seines weitblickenden Verlegers ab. Für ihn sollten die Lieder, die er Romanzen nannte, für sich stehen. Er war seit frühester Jugend mit dem Werk Tiecks vertraut. Brahms irrte, indem er seine eigene literarische Bildung auch beim Publikum voraussetze. Wer die Prosatexte von Tieck nicht im Gedächtnis mit sich trägt, kann den Romanzen nicht in dem Maße folgen, wie es notwendig ist. Sie nehmen immer wieder direkten Bezug zum Ganzen. Deshalb wurde bei Einspielungen und im Konzert gern die Mischform gewählt. Dietrich Fischer-Dieskau und Brigitte Fassbaender – um zwei Interpreten zu nennen – haben sogar gesungen und gesprochen. Bei Paul Armin Edelmann tritt die österreichische Schauspielerin Julia Stemberger als Erzählerin in Erscheinung. Sie versieht die Erzählungen mit einem geheimnisvollen Hauch, was sehr passend ist für diese romantischen Dichtungen. Es macht Spaß, ihr zuzuhören. Edelmann bewegt sich mit seinem Vortrag auch in diesem Duktus. Eines geht über ins andere. Und es ist überhaupt nicht zu spüren, dass die Sprechtexte mit zwei Jahren Abstand gesondert produziert wurden. Capriccio ist eine empfehlenswerte Edition gelungen. Rüdiger Winter
In einer Box bietet Capriccio auf drei CDs Die schöne Magelone an (C5225). Warum so umfangreich? Zunächst sind die fünfzehn Lieder so, wie sie der Komponist als Zyklus verstanden wissen wollte, separat zu hören. Zum anderen werden die selben Aufnahmen in verbindende und – was viel wichtiger ist – erklärenden Prosatexte aus der „Wundersamen Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence“, die Ludwig Tieck nach einem alten Volksbuch neu erzählt hat, eingebunden. Brahms wollte diese Verknüpfung nicht und lehnte einen entsprechenden Vorschlag seines weitblickenden Verlegers ab. Für ihn sollten die Lieder, die er Romanzen nannte, für sich stehen. Er war seit frühester Jugend mit dem Werk Tiecks vertraut. Brahms irrte, indem er seine eigene literarische Bildung auch beim Publikum voraussetze. Wer die Prosatexte von Tieck nicht im Gedächtnis mit sich trägt, kann den Romanzen nicht in dem Maße folgen, wie es notwendig ist. Sie nehmen immer wieder direkten Bezug zum Ganzen. Deshalb wurde bei Einspielungen und im Konzert gern die Mischform gewählt. Dietrich Fischer-Dieskau und Brigitte Fassbaender – um zwei Interpreten zu nennen – haben sogar gesungen und gesprochen. Bei Paul Armin Edelmann tritt die österreichische Schauspielerin Julia Stemberger als Erzählerin in Erscheinung. Sie versieht die Erzählungen mit einem geheimnisvollen Hauch, was sehr passend ist für diese romantischen Dichtungen. Es macht Spaß, ihr zuzuhören. Edelmann bewegt sich mit seinem Vortrag auch in diesem Duktus. Eines geht über ins andere. Und es ist überhaupt nicht zu spüren, dass die Sprechtexte mit zwei Jahren Abstand gesondert produziert wurden. Capriccio ist eine empfehlenswerte Edition gelungen. Rüdiger Winter 


 Soziale Distinktion spielte bereits in den „Saalschlachten in Oper und Konzert in Großbritannien des 19. Jahrhunderts“ (
Soziale Distinktion spielte bereits in den „Saalschlachten in Oper und Konzert in Großbritannien des 19. Jahrhunderts“ (






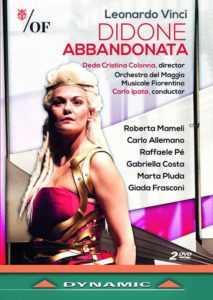
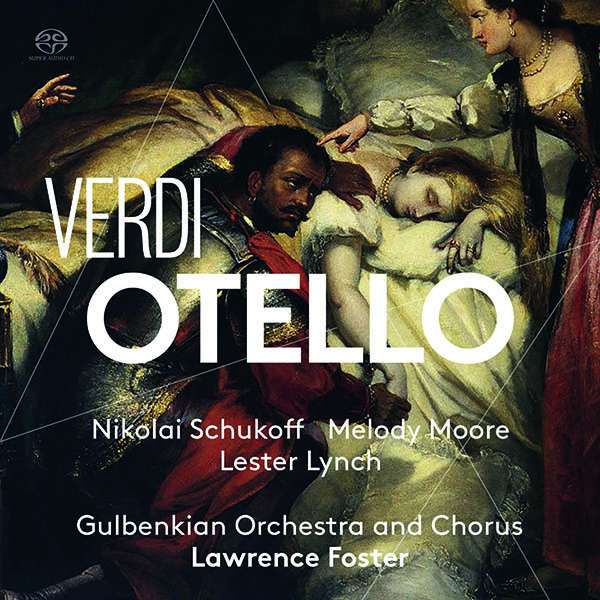
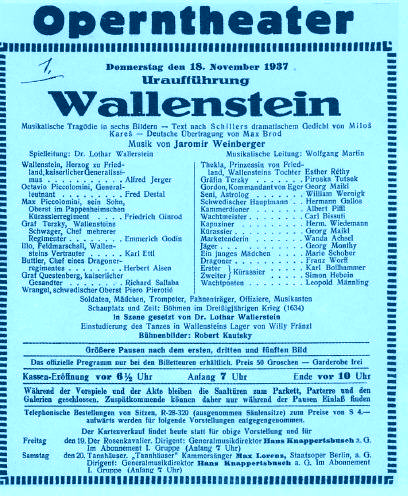








 Der litauische Bariton darf auch im Rigoletto mitwirken und ist hier ein beachtlicher
Der litauische Bariton darf auch im Rigoletto mitwirken und ist hier ein beachtlicher 


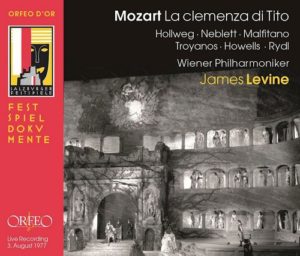

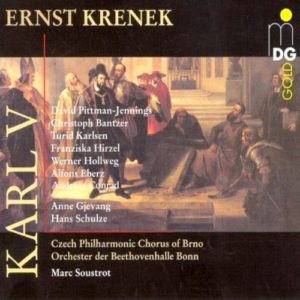



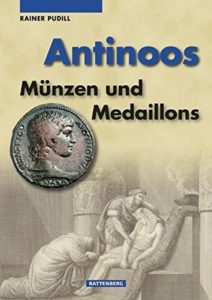













 Gesang in der heutigen Zeit: Gedanken zum Gesang und zur Gesangsausbildung:
Gesang in der heutigen Zeit: Gedanken zum Gesang und zur Gesangsausbildung:









