.
Auch in diesem Jahr sind wir bei der Auswahl der besuchten Live-Aufführungen wählerisch und konzentrieren uns auf wenige und eben für uns interessante Operntitel (deshalb behalten wir auch nachstehend einige wichtige Aufführungen für das vergangene Jahr bei.). Eine Auflistung alle Beiträge finden sie hier
..
.
Schostakowitsch an der Komischen Oper Berlin: Premierensieg. Alle drei Berliner Opernhäuser präsentierten schon im ersten Monat des neuen Jahres eine Neuinszenierung. Die Komische Oper beschloss den Premierenreigen am 31. 1. 2026 mit Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk und trug ohne Zweifel den Sieg davon. Barrie Kosky inszenierte die Handlung im Bühnenbild von Rufus Didwiszus, der einen leeren grauen Raum von trister Ödnis erdacht hatte, in dem es nur ein paar verdorrte Grasbüschel auf dem Boden und wenige Requisiten gibt – Stühle, einen Tisch und ein Doppelbett, das zwei geblümte Kopfkissen schmücken. Am Ende senkt sich ein Plafond mit Neonröhren bedrohlich über die Szene. Victoria Behrs Kostüme sind zeitlos und nicht ortsgebunden – einzig Katarinas prachtvolles weißes Hochzeitskleid mit Brauthaube geht auf die russische Tradition zurück.

„Lady Macbeth von Mzensk“ an der Komischen Oper Berlin Bild Monika Rittershaus
Kosky folgt in seiner Inszenierung weitestgehend der Libretto-Vorlage von Alexander Preis nach der Erzählung von Noikolai Leskow und erzielt oft atemberaubende Spannung und Dramatik. Die schonungslose Drastik mancher Szenen geht freilich an die Grenze des Ertragbaren und wird sicher nicht jedem Besucher gefallen haben. Damit sind nicht die dem Werk immanenten Sex-Szenen gemeint, die in aller Deutlichkeit gezeigt werden und gelegentlich auch einen grotesken Anstrich haben, wenn der Akt von Katerina und Sergei unter dem Bett stattfindet, dessen Matratze sich durch die rhythmischen Stöße des Mannes hebt und senkt. Wirklich abstoßend ist die Szene, wo der Schäbige den von ihm entdeckten Leichnam des ermordeten Sinowi sexuell missbraucht, dabei in einer Orgie Korn aus aufgeschlitzten Säcken um sich schleudert. Erfreulich, dass Katarinas ungeliebter Ehemann Sinowi nicht zur Karikatur verzeichnet ist, das trifft eher auf den betrunkenen, mit der Schnapsflasche in Unterwäsche auftretenden Popen zu, der dem qualvoll und kreatürlich sterbenden Boris nicht mehr helfen kann. In der Schluss-Szene hat Kosky die Vorlage verändert – nicht im See finden Katarina und ihre aufreizende Nebenbuhlerin Sonjetka (Susan Zarrabi) den Tod.
Der blinde Alte Zwangsarbeiter, der davon singt, kann nicht sehen, dass Sonjetka von Katarina mit einem Strumpf erdrosselt wird und sie sich selbst erschießt. Dass sie im Lager im Besitz einer Pistole ist, mutet freilich seltsam an. Auch die Führung der Chorsolisten der Komischen Oper, die hier als die Zwangsarbeiter chaotisch hin und her stürzen, wirkt etwas unmotiviert. Einstudiert von David Cavelius, sorgten sie aber zuvor besonders mit dem klagenden Gesang der Gefangenen für einen ergreifenden Moment.
Sensationell war die Besetzung, angeführt von Ambur Braid in der Titelrolle, die mit voluminösem, warmem, leuchtendem und selbst in den größten Ausbrüchen gerundetem Sopran eine Ausnahme-Interpretation bot. Nie habe ich die Partie schöner gesungen gehört. Auch darstellerisch wusste die Kanadierin Katarinas Sehnsucht nach körperlicher Hingabe und Zärtlichkeit überzeugend zu vermitteln. Dmitry Ulyanov als ihr Schwiegervater Boris Ismailow imponierte mit voluminösem, urigem Bass und überzeugte auch darstellerisch mit der brutalen Gewalt, wenn er Sergej halbtot prügelt und gegenüber Katarina sogar handgreiflich und übergriffig wird. Sean Panikkar als Katarinas Geliebter Sergej profitierte von seiner starken erotischen Aura und einem potenten, sinnlichen Tenor. Auch Elmar Gilbertsson als ungeliebter und brutal endender Sionowi wusste mit seinem Tenor stimmlich zu gefallen.
Von den Nebenrollen sind Mirka Wagner als Hausangestellte Aksinja, die von den Arbeitern brutal vergewaltigt wird, Caspar Krieger als Der Schäbige mit würdelosen Aktionen sowie Dimitry Ivashenko als Pope und Stephen Bronk als Alter Zwangsarbeiter mit reifen Bässen zu nennen.
James Gaffigan reizte mit dem Orchester der Komischen Oper Berlin Schostakowitschs radikale Komposition schonungslos aus, ging teilweise bis an die akustische Schmerzgrenze mit stampfenden, dröhnenden fortissimo-Exzessen, bot aber auch Passagen von flirrenden, träumerischen Klängen. Die Premiere endete im Jubel des Publikums für alle Mitwirkenden. Bernd Hoppe
.
.
Korngold an der Deutschen Oper Berlin: Gefühlschaos in der Spirale. Offenbar war Christof Loy verhindert oder nicht interessiert an der Vorlage – er wäre jedenfalls der richtige Regisseur gewesen für die Neuinszenierung von Erich Wolfgang Korngolds einaktiger Oper Violanta von 1916. Mit Das Wunder der Heliane, Francesca da Rimini, Der Schatzgräber, La Fiamma und Fedora hatte er sein besonders Gespür für Sujets aus dem Umkreis der Psychoanalyse, entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder in dessen ersten Jahrzehnten, imponierend gezeigt. Denn auch die venezianische Adlige Violanta ist eine in den Fesseln der Ehe gefangene Frau, die ausbrechen und sich erotisch befreien will. Seit dem Suizid ihrer Schwester Nerina, die vom Prinzen Alfonso verführt und dann verlassen wurde, ist sie seelisch verstummt und verweigert sich ihrem Gatten Simone. Dessen Versuche, sie zu beleben, bleiben erfolglos – einzig der Rache an dem Verführer gilt ihr Trachten.
Regisseur David Hermann hat dem kurzen Werk zwei Instrumentaltitel vorangestellt, deren erster, John Dowlands Lautensong „A fancy“, noch Sinn macht, denn die Handlung ist im Venedig der Renaissance verortet, und zudem will Simone seiner Frau beim Karneval ein unterhaltendes Musikstück bieten. Daher musiziert der kostümierte Instrumentalist Pedro Alcàcer auch auf der Szene, hat freilich wenig Chancen, sich akustisch durchzusetzen. Ganz anders das folgende Präludium aus Alban Bergs „Drei Orchesterstücken opus 6“, welches Donald Runnicles mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin im Graben anstimmt und das in seiner geschärften Aggressivität einen schroffen Kontrast zum ersten Beitrag. bildet, allerdings auch keinen Bezug zur Handlung aufweist.
Die Optik der Aufführung wird bestimmt von einer futuristischen Konstruktion von Jo Schramm, welche an einen gigantischen Museumsbau erinnert. Die Spielfläche ist zunächst eine gekippte Scheibe, über der ein Saturn-artiges Segment schwebt. Später hebt sie sich in Form einer Spirale und gibt im Unterbau eine Vielzahl von Kammern mit Spiegeln frei, die Violanta durchwandert und wo ihr mehrere maskierte Figuren begegnen, wie ihre tote Schwester oder eine Marienstatue mit sechs Brüsten. Auch die venezianischen Karnevalsfiguren, zu Beginn noch mit langen spitzen Hüten und Kostümen, welche entfernt an Oskar Schlemmers Triadisches Ballett erinnern, erscheinen ihr – nun derangiert und verformt. Zur surrealen Ästhetik der Aufführung tragen Sybille Wallums Kostüme, vorwiegend in den Farben Violett und Mauve, entscheidend bei, ebenso der marionettenhafte Bewegungsduktus der Figuren.

Deutsche Oper Berlin „Violanta“ von Erich Wolfgang Korngold Bild Marcus Lieberenz
Verwunderlich ist die Zeichnung des Alfonso, dessen Aura doch so unwiderstehlich sein soll und am Ende Violanta sterben lässt. Denn sie hat erkannt, dass sie diesen Mann liebt und ihr Verlangen nur durch den Tod besiegen kann. Der lettische Tenor Mihails Culpajevs als glatzköpfiger Mann mit Brille im grauen Business-Anzug entsprach freilich nicht in einem Moment der Vorgabe, musste sich steif und ohne jede Empathie bewegen. Auch die Stimme des Sängers mit vielen ertrotzen Spitzentönen von gekrähtem Klang ließ Wünsche offen. Noch problematischer war die Besetzung der Titelpartie mit der Amerikanerin Laura Wilde, deren herb vibrierender Sopran in der Höhe enervierend grell klang. Ihre trotzigen Abwehrreaktionen gegenüber ihren Ehemann erinnerten zuweilen an Salome. Ólafur Sigurdarson war von der Regie zum alten, großväterlichen Mann verzeichnet, doch bot der Isländer mit markant reifem Bariton die gesanglich überzeugendste Leistung. Befremdlich mutete die vom Regisseur erdachte finale Lösung an, wenn Simone Violanta aus der oberen Ebene erschießen will, sie aber die Kugel abwehrt und mit dem Geliebten in der unteren Ebene versinkt, während Simone oben allein zurückbleibt.
Unterschiedliche Eindrücke auch in den Nebenrollen, wo Andrei Danilov als unglücklich in Violanta verliebter Matteo mit schwachem Tenor enttäuschte, während Stephanie Wake-Edwards als Violantas Amme Barbara mit reizvoll timbriertem Mezzo aufhorchen ließ.
Donald Runnicles verabschiedete sich mit dieser Produktion als GMD des Hauses, hatte anfangs Schwierigkeiten, die Balance zwischen Bühne und Graben herzustellen, so dass Mägde und Soldaten in der Eingangsszene stimmlich untergingen. Zunehmend jedoch gab er dem schwelgerischen Rausch der Musik, ihrem sinnlichen Melos in der Nähe zu Richard Strauss, aber auch den avantgardistischen Passagen gebührenden Raum. Das Premierenpublikum am 25. 1. 2026 feierte das gesamte Team euphorisch. Bernd Hoppe
.
.
Am Ende ist man erschlagen von so viel Wunder: Als 1927 in Hamburg Das Wunder der Heliane herauskam, hatte Korngold den Höhepunkt seiner ungemeinen Tote Stadt-Popularität überschritten. Gegen die brualistische Energie der modernen Zeitoper, konkret Kreneks Jonny spielt auf, kam sein aus der Zeit gefallenes Mysterienspiel schwer an. Der Kampf der beiden Richtungen setzte sich bis zu den beiden von der Österreichischen Tabakregie kreierten Zigarettenmarken fort: die billige, in den 1970er Jahren wiederbelebte Jonny rauchte ich noch während des Studiums in Wien, Heliane war längst eingegangen. In einem Land, in dem man wenig Freude kennt, ist plötzlich „alle Ruh dahin“, seitdem ein junger Mann auftauchte, dem die Menschen hinterher laufen wie die Kinder, da sie erstmals ahnen, dass sie geschaffen wurden „zu lieben und geliebt zu werden“. Das macht ihn verdächtig. Dafür soll der Fremde hingerichtet werden. Der Herrscher wirft ihn in Gefängnis, wo ihn dessen Gattin Heliane aufsucht. Da er am nächsten Tag hingerichtet werden soll, bittet er Heliane, sich ihm nackt zu zeigen. Der Herrscher kommt hinzu, hält seine Frau für schuldig und lässt sie noch in der gleichen Nacht vor die Richter zerren. Sie beteuert ihre Unschuld, der Fremde küsst sie und ersticht sich daraufhin. Helianes Unschuld soll nun durch ein Gottesurteil geklärt werden. Tatsächlich erweckt sie den Toten zum Leben und bekennt ihre Liebe zu ihm, worauf sie der Herrscher ersticht. Nochmals wird Heliane lebendig, gemeinsam mit dem Fremden geht sie in den Himmel, denn „Dem Herzen nur ist solche Macht gegeben und nur die Liebe ist die Ewigkeit. Ewigkeit“.

Korngolds „Wunder der Heliane“ in französischer Erstaufführung in Strasbourg/Szene/Foto Klara Beck
Die zweimalige Totenerweckung lässt sich kaum erzählen. Das Libretto von Hans Müller, der Korngold bereits das Libretto zu Violanta geliefert hatte und ein gewiefter Dramaturg war (Das Weiße Rössl am Wolfgangsee), machte die Vorlage, das expressionistische Mysterienspiel „Die Heilige“ des aus Temesvar gebürtigen, 1919 im Alter von 24 Jahren verstorbenen Hans Kaltneker, keineswegs zugänglicher. Erich Wolfgang Korngold gefiel die Mischung aus Mitgefühl und Barmherzigkeit und sinnlicher Leidenschaft: zumindest letzteres entsprach seinen Lebensumständen, denn 1924 heirate er Luise Sonnenthal. Die Ehe dauerte bis zu seinem Tod. Auf jeden Fall bezeichnete Korngold dieses Hohelied der Liebe stets als eine beste Musik.
An der Opera national du Rhin in Straßburg, wo man für die französische Erstaufführung der Heliane eine Produktion der Nederlandse Reisopera von 2023 übernahm, umgehen Regisseur Jakob Peters-Messer und sein Ausstatter Guido Petzold die Fallstricke der Handlung und konzentrieren sich auf die Hauptfiguren, in denen Korngold eine Fortsetzung der Violanta-Konstellation sah. Kein wie und wo und warum. Der Raum, so schlicht und banal er scheint, ist von großer Raffinesse. Nach hinten spitz zulaufend. Irgendwie hell, durchlässig, durchschimmernd, kristallin, man glaubt sich in einer ins Eis gebrochenen Räumlichkeit zu befinden, mit einer gewellten, verspiegelten oder reflektierenden Decke darüber, das ist wenig fassbar, wie der seltsame, auf halber Höhe schwebende Würfel im hinteren Winkel und die Bilder der freizügigen Hedy Lamarr aus dem skandalberühmten Ekstase-Film (Videos ebenfalls von Petzold). Edelsteinhaft schillernd wie die Musik. Die kleinen Marcel Breuer-Beistelltische und die Liege verweisen auf die Entstehungszeit, der Gerichtsaal mit seinen orangefarbenen Schalensitzen lässt an die Halle einer Billig-Fluglinie denken und das zwischen Müll und Containern hausende Volk des dritten Aktes und der auf Europaletten aufgebahrte Leichnam des Fremden weiten das Kammerstück zum modernen Sozial- und Gesellschaftsdrama. Klar, dass sich dünnen Membranwände am Ende des Märchens zu silbrig spiegelndem Glanz weiten.

Korngolds „Wunder der Heliane“ in französischer Erstaufführung in Strasbourg/Szene/Foto Klara Beck
Doch kein szenischer Glanz reicht an die bannende Intensität der Musik heran, deren überdimensioniertes Orchester mit Klavier, Orgel, Celesta, Harmonium und Glockenspiel oder den Trompeten, Posaunen und Fanfaren aus dem Off oft beschrieben wurde und die im überschaubar großen Haus der Straßburger Rheinoper in der „Reduktion“ für 70 Musiker von Fergus McAlpine im wahrsten Sinn des Wortes überwältigend ist. Es gleicht einem Wunder, dass Robert Houssart mit dem Orchestre philharmonique de Strasbourg neben der Farbigkeit, Opulenz, Kraft und Raffinesse der Musik sogar etwas wie Durchsichtigkeit erreicht und man Teile des Textes zu verstehen meint (21. Januar 2026). Geradezu magische Momente erzielt die Deutsch-Französin Camille Schnoor bereits beim ersten Erscheinen der Heliane mit ausdrucksvoller Singdeklamation und deutender Textgestaltung, sinnlich ausladend und um lyrisch zarte Nuancen bemüht. Ihre leuchtend und strahlend, leicht am Rande der Belastbarkeit gesungene Arie „Ich ging zu ihm“ wird zur zentralen Achse des Stückes. Ric Furman ist der moderne Outlander. Furman hat die unerschöpflich reiche Stimme für den Fremden, ein schmal geführter, etwas durchdingender metallsicher Tenor, heldisch und biegsam, mit Kraft und Vibrato, aber beim Versuch ein Piano zu singen fast nicht hörbar und mit mulmiger Tonproduktion. Im gutsitzenden Zweireiher (Kostüme: Tanja Liebermann) singt Josef Wagner den Herrscher mit schierer Kraft und gewaltigem Heldenbariton und gebotener Bosheit, die estnische Mezzosopranistin Kai Rüütel-Pajula formte die Botin zu einer Kundry ähnlichen Gestalt, – solche Verweise sind selbst ohne konkrete textliche oder musikalische Zitate vielfach spürbar – der einstige Heldentenor Paul McNamara gab den blinden Schwertrichter mit schlichter Autorität, der Bariton Damien Pass war ein sympathischer Pförtner. Gefeiert wurde der Chor der Opèra national du Rhin. Auf die kauernde Gestalt, die man anfangs für einen Mithäftling hätte halten können, die sich aber durch die „Angel“-Aufschrift auf dem grauen Overall als durchgehend präsenter und tanzender Engel (Nicole van den Berg) zu erkennen gab, hätte ich verzichten können. Am Ende ist man erschlagen von so viel Wunder. Rolf Fath
.
.
Wer hat Angst vor Lucrezia?: Am Nationaltheater Mannheim – Gaetano Donizettis Lucrezia Borgia. Kaum von Donizetti Opera aus Bergamo zurück, geht es für mich in Mannheim mit einer weiteren Oper Donizettis weiter. Dass bei Lucrezia Borgia melodische Schönheit und romantische Tiefe nicht auf der Strecke bleiben, dafür sorgt der aus Bergamo gebürtige Roberto Rizzi Brignoli, dem diese Musik spätestens als junger Mann durch seinen Mentor, den großen Gianandrea Gavezzeni, nahegebracht wurde. Auf jeden Fall hatte der Mannheimer GMD mit der Oper Donizettis mehr Erfolg als kürzlich mit Lohengrin zur Spielzeiteröffnung, und Orchester und Herrenchor spielten und sangen als gälte es einen Ruf zu verteidigen. Rizzi Brignoli entfaltete Lucrezia Borgia als zentrales Stück aus Donizettis mittlerer Schaffensperiode mit der dunkeldrängenden Leidenschaft der Ensembleszenen von Gennaro und seinen Freunden während des Karnevals in Venedig und in Ferrara beim Fest der Negroni, der Sensibilität der Melodien in den Szenen Lucrezias mit Gennaro, in der sich nicht zwei Liebende, sondern zwei verwandte Seelen begegnen, der Bravour von Arien wie Alfonsos Cavatine und Orsinis Trinklied und der geschliffenen Rhetorik in der Konfrontation Lucrezias mit ihrem Gatten, die den Furor des jungen Verdi vorwegnimmt. Im weitangelegten Prolog und den zwei übersichtlichen Akten, zu denen Felice Romani Victor Hugos umfangreichen Dreiakter Lucrèce Borgia verdichtet hatte, bündelt Rizzi Brignoli präzise Leidenschaft und Dramatik. Hugos Stück wurde im Februar 1833 in Paris uraufgeführt, Donizettis Oper hängte sich bereits am 26. Dezember des gleichen Jahres an der Mailänder Scala an den Erfolg an. Mit federnder Energie spornte Rizzi Brignoli seine Sänger zu tollen Leistungen an (7. Dezember). Voran Estelle Kruger, die von der Königin der Nacht und Zerbinetta bis zu Hanna Glawari und Rosalinde so ziemlich alles für sie Erreichbare gesungen hat. Statt jugendlichen Schmelz hat sie nun einen durchsetzungsstarken Sopran zu bieten, der sich vor keiner Herausforderung für dramatischen Koloratursopran scheut. Mit unruhiger, auch etwas klirrender Stimme wirkt Krugers Lucrezia zunächst wie der Inbegriff der skrupellos schnarrenden Machtpolitikerin, die in der Romanze „Come è bello“ ihre mütterlichen Gefühle angesichts des schlafenden Gennaro nicht ausdrücken kann.

Donizettis „Lucrezia Borgia“ in Mannheim 2025/Foto Christian Kleiner
Maskiert nähert sie sich dem jungen Mann, der natürlich erst ganz am Ende und in ihren Armen sterbend erfährt, dass er dem verhassten Geschlecht der Borgia entstammt und Lucrezia seine Mutter ist. Besser als das lyrisch zarte Koloraturgewirk des ersten Auftritts gelingen Kruger die energischen Attacken in der Konfrontation mit Alfonso d’ Este, ihrem dritten und letzten Gemahl, wo sie die Krallen ausfährt und um das Leben des jungen Mannes ringt, den der Gatte für ihren Liebhaber halten muss und deshalb wegen der Schändung des Borgia-Wappens mit dem Tode bestrafen will. Und letztlich besitzt Krugers Lucrezia in den Schlussszenen und dem großen Rondo auch Wärme und echte Gefühle. Kruger realisiert ein großes, psychologisch dichtes Porträt. Sung Min Song war der propere Sohn Gennaro mit attraktivem Timbre, doch einheitlich lautem Ton und phantasielos einförmigem Singen, das wenig Freunde bereitete. Nur im kurzen Duett mit dem Freund Orsini zu Beginn des zweiten Aktes taucht kurz ein Gefühl für Nuancen und leisere Töne auf. Shachar Lavi singt die Hosenrolle des Orsini mit viel Energie, ohne die sinnliche Kraft ihres Schlagers „Il segreto per esser felici“ auszukosten. Bartosz Urbanowicz ist ein echter Bassbariton, der mit prachtvoller Höhe seine Racheschwüre „Vieni, la mia vendetta“ hinausschleudert. Ausgezeichnet die die Nebenrollen, voran Christopher Diffey als tenoral lockender Rustighello und der gewaltige Bass Sung Ha als Lucrezias Zuträger Gubetta, die beide zu Größerem berufen sind. Individuell und ausdrucksvoll waren auch die vier Begleiter Gennaros gezeichnet, die Tenöre Raphael Wittmer und Dominic Lee als Liverotto und Vitelozzo und die Bässe Ilya Lapich und Zacharias Galaviz-Guerra als Petrucci und Gazella.
Zu vernachlässigen war die Regie von Rahel Thiel, die sich von Fabian Wendling die drei Bühnenseiten mit Schlagzeilen der Art „Wer hat Angst vor Lucrezia“, „Mit Gift gewürzte Orgien“, „Herzog von Gravina im Borgia-Palast heimlich erdrosselt“ oder „Tochter des Papstes: Heilige oder Hure“ plakatieren und mit ausgestanzten Buchstaben, mal überlebensgroß, mal mittelgroß zum Draufstehen oder kniehoch wie Kita-Möbeln zum Draufsitzen, umranden ließ. Gleich zwei Kostümbildnerinnen, Rebekka Dornhege Reyes und Isabel Garcia Espina, kümmerten sich darum, dass alle in ihren phantasievollen schwarz-weiß-roten Kostümen gut aussahen. Rolf Fath.
.
.
An der Deutschen Oper Berlin: Fedora mit Premierenglanz. Christof Loy ist der Regisseur für das ausgefallene Repertoire, für Raritäten des frühen 20. Jahrhunderts. An der Deutschen Oper Berlin hat er mit großem Erfolg Korngolds Das Wunder der Heliane, Zandonais Francesca da Rimini und Respighis La Fiamma inszeniert. Nun folgte Giordanos Fedora, 1898 in Mailand uraufgeführt, als Übernahme einer Produktion aus Frankfurt. Das bekanntere Werk des Komponisten, Andrea Chénier, steht seit Jahren im Spielplan des Hauses und erfreut sich auch international großer Beliebtheit. Fedora dagegen wird äußerst selten aufgeführt, auch in Berlin war sie noch nie zu sehen. Immerhin gab es 1956 an der Mailänder Scala eine Produktion mit Maria Callas in der Titelrolle und auch andere legendäre Primadonnen wie Virginia Zeani, Magda Oliviero und Renata Tebaldi haben die Partie gesungen. Das informative Programmheft zeigt noch weitere Interpretinnen in historischen Fotos: Gianna Pederzini, Giulietta Simionato, Giuseppina Cobelli.

Giordano: „Fedora“ an der Deutschen Oper Berlin/Szene/Foto Bettina Stöss
Das Werk ist ein Thriller mit den Schauplätzen St. Petersburg, Paris und einem Dorf in den Schweizer Alpen. Die Handlung kreist um Rache, Liebe und Tod. Die Titelheldin Fedora Romazoff will den Mord an ihrem Verlobten Graf Wladimiro Andrjewitsch rächen. Verdächtigt wird Graf Loris Ipanov, der nach Paris flieht. Fedora folgt ihm, als Spionin getarnt, verliebt sich jedoch in den Mann, der ihr sein Motiv für die Tat offenbart: Andrejewitsch hatte ein Verhältnis mit seiner Frau. Nach gemeinsamen glücklichen Wochen in der Schweiz erfährt Loris aus Briefen vom Tod seines Bruders und seiner Mutter, resultierend aus einem Schreiben Fedoras an die russische Polizei, in welchem sie Loris und seinen Bruder beschuldigt hatte. Loris erkennt in ihr die Verfasserin und beschuldigt sie, worauf sie den Suizid wählt.
Die Ausstattung von Herbert Murauer erinnert in ihrer Ästhetik an die von Johannes Leiacker für Francesca da Rimini. Ein Raum mit ornamentierter Tapete, spärlichem Mobiliar und prachtvollem Lüster dient als Einheitsschauplatz (was die drei unterschiedlichen Spielorte nicht berücksichtigt). Im Hintergrund sieht man einen goldenen Bilderrahmen, in welchem von Velourfilm AB produzierte Videos zu sehen sind, die das Geschehen auf der Bühne abbilden, zum anderen aber auch Ereignisse backstage festhalten. Zwischen dem 2. und 3. Akt gibt es sogar einen privaten (und entbehrlichen) Moment, wenn die Sängerin der Titelrolle hinter den Kulissen gefilmt wird, während sie sich mit Mineralwasser erfrischt. Raffiniert ist das tableau vivant im 2. Akt mit einem Musikzimmer, wo der polnische Pianist Boleslau Lazinski (Chris Reynolds) die Gäste mit seinem Klavierspiel unterhält. Im 3. Akt wird der Rahmen sogar zur Spielfläche, wenn sich in ihm eine ländliche Idylle mit Wald und Bächlein öffnet, wo das Paar sein trügerisches Glück genießt. Den Übergang vom erhöhten Bilderrahmen zur ebenen Szene bilden ramponierte Möbelpaletten – dies das einzige störende Detail in der sonst eleganten Optik. Denn auch die historisierenden Kostüme sind prachtvoll, vor allem bei Fedoras Empfang in Paris. Sie selbst trägt attraktive Roben aus Taft und Spitze – rot im 1. und schwarz im 2. Akt -, ergänzt um Pelzmantel und -Cape.
Die litauische Sopranistin Vida Mikneviciuté in der Titelrolle ist ein Ereignis. In der Erscheinung von kühler Eleganz, stellt sie den Wandel von der Rache suchenden zur liebenden Frau glaubhaft dar und vermag in ihrer Sterbeszene zutiefst anzurühren. Nach ihren Erfolgen im Wagner-Repertoire hat sie sich nun auch diese italienische Verismo-Partie zu eigen gemacht und dabei reiche Facetten ihres Soprans hören lassen. Er ist bis in die exponierte Höhe zu mühelos durchschlagenden, metallisch gleißenden Ausbrüchen fähig, kann die Stimme aber auch bis zu feinsten lyrischen Tönen zurücknehmen. Ergreifend gestaltet sie die Finalszene, wo der Regisseur sie den Bühnenraum verlassen lässt, was die Aussöhnung des Paares konterkariert, während aus dem Off das wehmütige Lied des Kleinen Savoyarden (François Bader vom Kinderchor des Hauses) erklingt.
Jonathan Tetelman ist ein attraktiver Loris Ipanov mit einem baritonal gefärbten Tenor von enormer Fülle und Kraft. Bei der berühmten Arie „Amor ti vieta“ noch verhalten, steigerte er sich im großen Liebesduett mit Fedora am Ende des 2. Aktes („Vedi, io piango“) zu leidenschaftlicher Emphase und vokalem Rausch. Schmelz und lyrische Finessen sind der Stimme nicht gegeben, Tetelmans Trümpfe sind Volumen und Potenz.

Giordano: „Fedora“ an der Deutschen Oper Berlin/Szene/Foto Bettina Stöss
Auf hohem Niveau sind auch die Nebenrollen besetzt. Die russische Sopranistin Julia Muzychenko gefällt als kapriziöse Olga mit klarem Sopran und lebhaftem Spiel, der armenische Bariton Navasard Hakobyan als Diplomat de Siriex mit klangvoller Stimme vor allem in seinem Solo „La donna russa“. Zu nennen sind noch der Bariton Artur Garbas als Kutscher Cirillo und der Bassist Tobias Kehrer als Polizeioffizier Gretch in markanten Episoden.
Die unterschiedlichen Klangfarben der drei Akte bringt John Fiore mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin zu optimaler Wirkung. Schwelgerisches Melos ertönt schon in der Ouvertüre und klingt immer wieder, so in den Zwischenspielen, mit dem Motiven der Tenor-Arie auf. Gelegentlich reizt der Dirigent die Dynamik bis an die Grenze aus, doch können die Protagonisten diese Herausforderung souverän bestehen. Der Premierenabend am 27. 11. 2025 endet im Jubel des Publikums, der zu Recht ein denkwürdiges Ereignis feiert. Bernd Hoppe
.
.
Till Eulenspiegel von Emil Nikolaus von Reznicek in Hildesheim „Erkennen Sie die Melodie?“ Ältere Opernfreunde erinnern sich sicherlich an die musikalische Quizsendung mit diesem Titel, die in den 1970/80er-Jahren im ZDF lief, und daran, dass die Titel-Melodie aus der Ouvertüre zur Oper Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek (1860-1945) stammt. Mehr von ihm, vom Inhalt der genannten Oper oder gar weitere Opern sind völlig in Vergessenheit geraten.
Anlässlich der Wiederaufführung seiner Volksoper Till Eulenspiegel im Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim hier ein paar Hinweise zu Leben und Werk des Komponisten: Aufgewachsen in seinem Geburtsort Wien und später in Graz, erhielt er ersten Klavierunterricht mit 11 Jahren; er studierte zunächst Jura, bestand aber das erste Staatsexamen – möglicherweise absichtlich – nicht. Anschließend wurde ihm endlich erlaubt, seine bereits neben dem Jura-Studium erfolgte musikalische Ausbildung fortzusetzen, nun in Leipzig. In der Folgezeit war er als Kapellmeister in verschiedenen Theatern tätig, u.a. in Zürich, Stettin, Berlin und schließlich ab 1896 in Mannheim. Als Reznicek nach dem Tod seiner ersten Frau seine künftige Frau Berta kennenlernte, lebte diese zwar schon von ihrem ersten Ehemann getrennt, war aber noch nicht geschieden. Dass das junge Paar dennoch offen zusammenlebte, war für jene Zeit ein Skandal, zumal als 1898 der gemeinsame Sohn Emil-Ludwig unehelich zur Welt kam. Reznicek wurde danach aus seiner Mannheimer Stellung geradezu heraus gemobbt. Er zog nach Wiesbaden, wo er seine 1902 uraufgeführte Volksoper Till Eulenspiegel komponierte, in der er die Mannheimer Erlebnisse verarbeitete. 1903 übersiedelte die Familie nach Berlin, wo von Reznicek bis zu seinem Tod 1945 lebte.
Emil Nikolaus von Reznicek gehörte im beginnenden 20. Jahrhundert zu den äußerst erfolgreichen Komponisten und wurde von Gustav Mahler, Richard Strauss und Alban Berg sehr geschätzt. Sein kompositorisches Schaffen ist in allen Bereichen äußerst vielfältig; eine ganze Reihe von Opern und Chorwerken stehen neben viel Sinfonik, Klavier- und Kammermusik sowie Liedern. Dass es nach 1945 nur vereinzelt Wiederaufführungen seiner Werke gab, mag daran gelegen haben, dass sein Bild in der Zeit ab 1933 jedenfalls nach außen widersprüchlich wirkte. Er wurde 1934 zum deutschen Delegierten des neu gegründeten Ständigen Rats für internationale Zusammenarbeit der Komponisten gewählt, einer Institution, die als Nazi-Organisation galt. Tatsächlich stand der mit einer Jüdin verheiratete von Reznicek den neuen Machthabern wohl eher kritisch gegenüber; er soll sein Amt dazu genutzt haben, Werken zur Aufführung in Deutschland zu verhelfen, die die Nationalsozialisten nicht ohne Weiteres akzeptiert hätten. Seinen Zeitgenossen galt er als sehr streitbar.
In Hildesheim gibt es seit 2020, dem Beginn der Intendanz von Oliver Graf, in jeder Saison eine Trilogie, d.h. alle Sparten beschäftigen sich in einem einheitlichen Bühnenbild mit demselben Stoff. Diesmal ist es Till Eulenspiegel, der sein „Unwesen“ in der Oper treibt, ab Januar 2026 im Schauspiel von Moritz Nikolaus Koch und ab April in einem partizipativen Tanzstück. In der Oper werden in zwei Akten und einem Nachspiel drei Episoden aus Tills Leben behandelt:

Emil Nikolaus von Reznicek, 1927 in Leipzig (Foto: privat)/ProClassics
Dem vom Komponisten selbst verfassten Libretto liegt Fischarts Eulenspiegels Reimensweiß von 1572 zugrunde; so erklärt sich der altertümelnde Text des Librettos. Aber auch der Eulenspiegel-Roman von Charles de Coster von 1872 gilt als Vorlage, weil der Roman zur Zeit der Bauernkriege spielt und sozusagen operngerecht eine Liebesgeschichte enthält. Es beginnt 1525 in Kneitlingen am Elm, dem Geburtsort Eulenspiegels, wo Till seiner besorgten Mutter mitteilt, dass er künftig als Narr durch die Welt ziehen wolle. Auf dem Marktplatz trifft er auf die Milchfrau Gertrudis, und die beiden verlieben sich ineinander. Es geht nun gleich hochdramatisch zu, als Till von Opfern seiner Streiche beim kaiserlichen Vogt Uetz von Ambleben angeklagt wird, der Till zum Tod verurteilt. Mit List und Tücke erreicht Till jedoch die Umwandlung der Strafe in eine dreijährige Verbannung. Der zweite Akt spielt auf der Burg Ambleben drei Jahre später. Uetz terrorisiert mittlerweile die Bevölkerung mit ständigen Raubzügen. Till kehrt als verkleideter Mönch zurück und ermöglicht den Bauern, die Burg zu stürmen. Gemeinsam mit Gertrudis, die auf ihn gewartet hat, zieht er in die Welt hinaus. Im Nachspiel sind viele Jahre vergangen, als der todkranke Till in ein Spital zurückkehrt, das von Uetz und seinem Kumpanen, dem gegenüber Gertrudis übergriffigen Doctor, geführt wird. In einem letzten Streich gelingt es ihm, im Hospital aufgenommen zu werden, wo er gelassen von der Welt Abschied nehmen kann. Eine Überraschung ist die Musik, die nach Tills Tod folgt; sie suggeriert, dass Eulenspiegel zumindest als Idee irgendwie weiterlebt.
Regisseur Jan Langenheim verzichtete wohltuend auf eine Aktualisierung des Bühnengeschehens, wenn man davon absieht, dass es als einzige aktuelle Anspielung deutsche und ukrainische (!) Untertitel gibt – schließlich spielt die Oper während eines schrecklichen Krieges. Das einfache, mit grauen Stoffvorhängen versehene Bühnenbild von Lars Linnhoff ist auch in den anderen Stücken über Till Eulenspiegel gut verwendbar. Vor diesem Hintergrund konnte Amelie Müller mit märchenhaften und dadurch zeitlos wirkenden Kostümen in bunten Farben schwelgen. Insgesamt ist dem TfN eine unterhaltsame Produktion gelungen, wozu die vielseitige, teilweise lautmalerische Musik mit einigen Wagner-Anklängen, auch unter Verwendung historischer Texte und Melodien ganz wesentlich beitrug. Garant dafür war der scheidende GMD Florian Ziemen, der die gut disponierte TfN-Philharmonie stets zu schwungvollem Musizieren, aber auch zum Auskosten der mehr lyrischen Szenen animierte.

Theater für Niedersachsen (TFN): Rezniceks „Till Eulkenspiegel“/Szene/Foto Clemens Heidrich
Auffällig war die große Spielfreude aller Mitwirkenden, die ausgesprochen lebhaft zu agieren hatten und die mit der sängerisch anspruchsvollen Partitur bestens zurecht kamen. Da ist zuerst in der Titelrolle der puertoricanisch-amerikanische Tenor David Soto Zambrana zu nennen. Er beeindruckte durch sein quirliges, fast tänzerisches Auftreten und seine in allen Lagen markige, durchgehend intonationsreine Stimme. Die Litauerin Gabrielė Jocaitė imponierte als entzückende Gertrudis mit blitzsauberem, höhensicherem Sopran.
Mit witziger Bühnenpräsenz bewährten sich als über alle Maßen korrupter kaiserlicher Vogt Uetz von Ambleben Tobias Hieronimi und der Kanadier Andrey Andreychik als urkomischer Doctor mit abgerundetem, wohlklingendem Bariton. In kleineren Partien überzeugten jeweils in mehreren Rollen Julian Rohde und der Südafrikaner Eddie Mokofeng.
Zwischen dem 2. Akt und dem Nachspiel traten die genannten Protagonisten vor den Vorhang und verlasen in ihrer Muttersprache belehrende Texte zu den Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts und Hinweise darauf, dass die Idee Till Eulenspiegels immer weiter leben wird – eine im Ergebnis unnötige Unterbrechung des Spielablaufs, die wohl wegen des Umbaus zum Nachspiel im Spital erforderlich schien.
Neele Kramer gab mit gewohnt kultiviertem Gesang Tills besorgte Mutter; mehrere Chorsolisten ergänzten passend. Überhaupt waren der Opernchor des TfN und der Extrachor von Achim Falkenhausen sorgfältig vorbereitet worden, sodass die vielen ebenfalls recht anspruchsvollen Chorstellen abgewogen und wie gewohnt differenzierend erklangen.
Das leider nur spärlich erschienene Publikum spendete in der Vorstellung am 15. November 2025 kräftigen und lange anhaltenden Applaus für alle Mitwirkenden. Ob die vielschichtige, nicht immer auf Anhieb überzeugende Volksoper den Weg ins Repertoire schafft, erscheint eher zweifelhaft. Gerhard Eckels
.
.
An der Staatsoper Hamburg: Ruslan und Ljudmila als queere Orgie. Michail Glinkas Ruslan und Ljudmila, uraufgeführt 1842 in St. Petersburg, gilt als die russische Nationaloper, war es doch das erste in russischer Sprache komponierte Opernwerk. Es ist eine Große Zauberoper in fünf Akten nach dem gleichnamigen Poem von Alexander Puschkin mit märchenhaften Bildern, verwunschenen Szenen, Zauberern und mysteriösen Entführungen, bis es am Ende doch noch eine vom Volk bejubelte Hochzeit gibt.
Die beiden ungarischen Regisseurinnen Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka wollten von einer sagenumwobenen Welt nichts wissen, verlegten die in legendärer Zeit spielende Handlung in eine fiktive Diktatur und konzentrierten sich vor allem auf die Hinterfragung tradierter Geschlechterrollen. Die von ihnen selbst ausgestattete Inszenierung kommt wie ein Loblied auf die queere Community daher, quasi ein Gegenentwurf zu aktuellen Zuständen in Putins Russland, wo Angehörige der LGBTQ+-Szene Repressalien ausgesetzt sind und von massiver Gewalt bedroht werden. Die Unterwelt der Hexe Naina verortete das Team in einem Metro-Schacht, wo ein abgewrackter Waggon hereinfährt und schäbige, mit bunten Plakaten beklebte Kioske eine queere Bar abgeben. Hier tummeln sich Schwule, Lesben, Transvestiten, Stricher, Prostituierte und Gender People in schrillen Outfits aus Lack, Leder, Glitzer und Federputz. Hier entdeckt auch Fürst Ratmir, einst von Ljudmila abgewiesen und dann der Geliebte von Gorislawa, seine homoerotischen Neigungen, posiert in Brautkleidern und schwarzer Damenunterwäsche. Sogar mit Ruslan kommt es zu körperlicher Nähe, bis die mit Schlagstöcken bewaffnete Miliz hereinbricht, auf alle einprügelt und einige gar abführt.
Das Gegenstück zu dieser grell-bunten Szenerie mit ihren schrillen Paradiesvögeln ist das erste Bild mit dem Festsaal des Kiewer Großfürsten Swetosar, wo die Hochzeit von Ruslan und Ljudmila gefeiert werden soll – ein deprimierender schmuckloser Raum von tristem Grau mit Graffiti an den Wänden und zwei langen Tafeln für die Hochzeitsgäste, die alsbald hereinstürmen. Aber auch das Militär in Uniformen ist präsent und überwacht die Feier, was die freudlose Atmosphäre noch betont. Überraschend wird das Hochzeitspaar auf Schlittschuhen als Eiskunstläufer gezeigt; Video-Einspielungen von Janic Bebi präsentieren vor allem Ljudmila als heranwachsenden Star. Neben solch entbehrlichen Szenen werden wichtige Etappen der Handlung nicht bedient. Die Entführung Ljudmilas beim Hochzeitsfest durch einen mächtigen Zauberer, die Suche von Ruslan, Ratmir und Farlaf nach der Verschwundenen sowie Ruslans Kampf mit einem Ungeheuer auf dem Schlachtfeld, womit er ein Zauberschwert gewinnt, bleiben im Dunkeln. Ljudmilas tiefer Schlaf, in den sie der Zauberer versenkt hat, ist eine Abfolge von dramatischen Szenen, wenn sie über das Sterben sinniert, sich die Pulsadern mit den Kufen der Schlittschuhe aufschlitzt oder auf dem Totenbett liegt. Danach wirkt der Schlusschor, der das hymnisch jubelnde Motiv der Ouvertüre aufnimmt, überraschend und unglaubwürdig, ist zudem eine weitere Demonstration der queeren Bewegung, wenn Regenbogenfahnen geschwenkt und Parolen wie Love is Love gezeigt werden.
Fast ohne Einschränkung ist die musikalische Seite der Premiere am 9. November 2025 zu loben. Der russische, mittlerweile in Deutschland lebende Dirigent Azim Karimov fächerte Glinkas stilistisch vielschichtige Musik mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg imponierend auf, beginnend mit der schmissigen Ouvertüre, die Rossinis Schwung und Brillanz aufnimmt. Auch später gibt es an den Belcanto erinnernde Passagen, zu denen die Schwermut mancher Chöre in krassem Kontrast steht. Der Chor der Hamburgischen Staatsoper (Einstudierung: Alice Meregaglia) punktete mit klangvollem und engagiertem Gesang. Wie eine französische Grand opéra weist die Komposition auch Ballettmusiken. auf, welche das Orchester mit Esprit und Delikatesse servierte.
An der Spitze der Besetzung stand der russische Bassbariton Ilia Kazakov als männlicher Titelheld mit voluminöser, kantabel strömender, aber auch auftrumpfender Stimme. Kaum weniger überzeugend die usbekische Sopranistin Barno Ismatullaeva als Ljudmila, deren üppige, aufblühende Stimme die anspruchsvolle Partie blendend meisterte. Ihrer Kavatine im 1. Akt folgt eine Cabaletta im Stil Donizettis, welche die Sängerin bravourös absolvierte, während die von Konzertmeister Konradin Seitzer begleitete Arie im 4. Akt mit ihrem klagenden Duktus ungemein berührte. Nur am Ende hörte man einige grelle Töne in der exponierten Lage. Einer Sensation kam die Besetzung des Ratmir mit dem russischen Countertenor Artem Krutko gleich, ist die Partie doch für einen Alt komponiert, also eine Hosenrolle. Er bewältigte die Herausforderung nicht nur mühelos, sondern imponierte auch mit betörendem Gesang. Natalia Tanasii als seine Geliebte Gorislawa ließ einen fülligen, wohllautenden Sopran hören. Dunklere Töne brachte die deutsche Mezzosopranistin Kristina Stanek als Naina ein. Ein renommierter, international gefragter Tenor ist der Schotte Nicky Spence, der in einer Doppelrolle als Zauberer Finn und Barde Bajan mit starker Präsenz überzeugte. Die Besetzung ergänzten solide die Bässe Alexei Botnarciuc aus Moldawien als Farlaf und Alexander Roslavets aus Weißrussland als Swsetosar.
Das Publikum feierte alle Interpreten auf der Bühne und im Graben gebührend, nur das Regie-Team musste Proteste hinnehmen. Bernd Hoppe
.
.
An der Deutschen Oper Berlin: Konzertante Sternstunde zum Saisonfinale. Konzertante Opernaufführungen sind eine beim Publikum, beliebte Tradition im Haus an der Bismarckstraße, bieten sie doch häufig unbekanntere Werke und vor allem international renommierte Solisten. Im Falle von Jules Massenets Werther trifft der Aspekt der Rarität eher weniger zu, denn 1998 gab es bereits eine unvergessliche konzertante Aufführung mit dem betagten spanischen Tenor Alfredo Kraus als Titelheld (ein Jahr vor seinem Tod) und der charismatischen bulgarischen Mezzosopranistin Vesselina Kasarova. 1999 sah man an diesem Haus eine verstörende Inszenierung des jungen Regisseurs Sebastian Baumgarten, der das Paar auf der Waschmaschine kopulieren ließ. Solche Exzesse musste man am Abend des 25. 7. 2025 (nach der Premiere zwei Tage zuvor) glücklicherweise nicht befürchten. Nicht umsonst steigt die Beliebtheit konzertanter Versionen beim Publikum immer mehr.
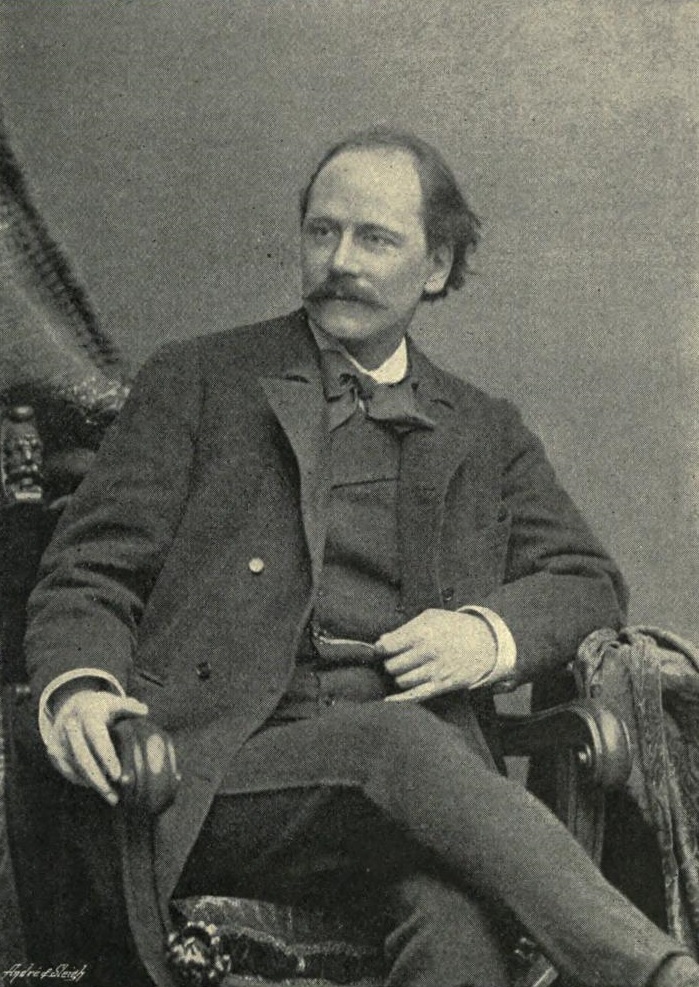
Jules Massenet/Wikipedia
Dass man bei der dreistündigen Aufführung die Szene nicht einen Moment vermisste, lag vor allem an der Besetzung der beiden tragenden Rollen mit dem amerikanischen Tenor Jonathan Tetelman und der russischen Mezzosopranistin Aigul Akhmetshina. Beide gestalteten ihre Rollen mimisch und gestisch so lebensecht und überzeugend, dass man ihnen wie gebannt folgte. Beide sind zweifellos geradewegs auf dem Weg zu Samson und Dalila, was die Üppigkeit, die Dramatik und Leidenschaft ihrer Stimmen betrifft. Aber wenn der Abend auch keine ideale Interpretation im französischen Idiom bot, so in jedem Fall ein opulentes vokales Fest, welches das Publikum im ausverkauften Haus am Ende anhaltend und enthusiastisch honorierte. Die raumfüllenden, lang gehaltenen Spitzentöne des Tenors waren in ihrer Mühelosigkeit und Sicherheit durchaus von imposanter Wirkung, wenn man sich die Figur auch introvertierter, poetisch-verträumter vorstellen könnte. Aber man muss Tetelman attestieren, dass er neben der potenten Kraft und den leidenschaftlichen Ausbrüchen auch zarte piano– und mezza voce-Töne hören ließ, so dass beispielsweise „Pourquoi me réveiller“ sehr anrührte.
Aigul Akhmetshina war ihm eine mindestens ebenbürtige Charlotte, für mich sogar die Favoritin der Aufführung. Das Timbre ist betörend in seiner Sinnlichkeit und Glut, suggeriert daher eher ein verführerisches denn keusches Naturell. Die beiden Soli „Werther! Ces lettres!“ und „Va! Laisse couler mes clarmes“ waren in ihrer stimmlichen Vollendung magische Momente – ebenso das finale Duett mit Werther („À cette heure suprême“) in seinem Rausch.
Beglückend war die exzellente Besetzung der übrigen Rollen. Der amerikanische Bariton Dean Murphy, Ensemblemitglied des Hauses, imponierte als Albert mit resonanter, viriler Stimme, Lilit Davtyan, Stipendiatin des Förderkreises der Deutschen Oper, entzückte als reizende Sophie mit lieblichem Sopran, der besonders im Solo „Du gai soleil“ bezauberte. Michael Bachtadze war ein solider Amtmann, wie auch Jörg Schörner als Brühlmann und Karis Tucker als Käthchen. Chance Jonas-´Toole als Schmidt und Gerard Farreras als Johann trumpften im Zwiegesang „Vivat Bacchus!“ zu Beginn des 2. Aktes auf.
Enrique Mazzola, dem Haus seit Jahren als Erster Gastdirigent verbunden, leitete das Orchester der Deutschen Oper Berlin mit Umsicht und Gespür für die Valeurs der Musik. Schon im Prélude entfaltete eine farbenreiche Palette voller Duft und Melancholie, sorgte dann stets für Transparenz, filigranes Flirren und schwelgerisches Melos. Der Abend war ein glanzvoller Abschluss der Ära des Intendanten Dietmar Schwarz, der nach 13 Jahren seine Leitung des Opernhauses beendet und in der Pause vom Regierenden Bürgermeister Berlins Kai Wegner würdig verabschiedet wurde. Bernd Hoppe
.
.
Strauss-Rarität an der Berliner Staatsoper: In stimmungsarmer Ausstattung inszenierte Jan Philipp Gloger an der Berliner Staatsoper Richard Strauss´ musikalische Komödie Die schweigsame Frau, die Unter den Linden noch nie gespielt wurde und die Christian Thielemann für seine erste Neuproduktion als Generalmusikdirektor des Hauses ausgewählt hat. Die Bühne von Ben Baur zeigt die Wohnung des Sir Morosus als Flucht mehrer Räume – ein viel zu großes Heim für einen älteren, einsamen Menschen. Das Produktionsteam spricht damit auch ein aktuelles Problem in Berlin und anderen Großstädten an. Wohnungsnot ist eines der beiden sozialen Themen, welche das Regie-Team für die Inszenierung bemüht haben – das andere ist die Vereinsamung des Menschen im Alter. Zumindest das erste wirkt aufgesetzt und im Stück nicht erkennbar. Deutlich sichtbar wird, dass die Inszenierung im Hier und Heute angesiedelt ist. Zum Vorspiel werden Internet-Verkaufsanzeigen von Wohnungen und Häusern verschiedenster Preislagen eingeblendet, eine Neon-Leuchtreklame von Berliner Pilsner im Hintergrund verweist auf die deutsche Hauptstadt als Spielort. Schlagzeilen über die Einsamkeit älterer Bürger aus diversen Medien werden vor jedem Akt auf einen Zwischenvorhang eingeblendet (Video: Leonard Wölfl), was man als überflüssigen Einfall abtut. Bedauerlich aber ist, dass die Zimmerflucht mit mehreren Räumen und einer Bibliothek keinerlei Atmosphäre besitzt und bis auf ein Gemälde mit einer maritimen Szene nirgendwo an die Vergangenheit des Sir Morosus als Admiral zur See erinnert.
Seinen offensichtlichen Hang zu Turbulenzen kann der Regisseur vor allem in den Auftritten der Theatertruppe von Morosus´ Neffe Henry bedienen, wobei die grell-bunten Kostüme von Justina Klimczyk wie so oft in ihrer Hässlichkeit kaum zu überbieten sind und die schrill-queere Stimmung der Szene unterstreichen. Die im 2. Akt arrangierte Scheinhochzeit mit Morosus und Henrys Gattin Aminta unter Glühlämpchen-Girlanden samt alberner Tanz-Einlage (Choreografie: Florian Hurler) und Komparsen in roten Herz-Kostümen („Just Married“) ist der deprimierende Tiefpunkt der Inszenierung. Im übrigen bietet diese weitere aufgesetzt wirkende Einfälle wie diverse Transparente (Achtung: Oper! / Cancel Morosus! / Achtung: Regie-Theater!) oder das Finale, wenn der Sir nach seinem Monolog mit der gesamten Theatertruppe, die er wie Flüchtlinge in die Wohnung aufgenommen hat, am Esstisch sitzt.

„Die schweigsame Frau“ an der Staatsoper Unter den Linden Foto Bernd Uhlig Staatsoper Berlin
Wieder einmal entschädigte die musikalische Qualität der Aufführung. Dabei begann diese verstörend, weil Iris Vermillion als Haushälterin eine ruinöse Stimme hören ließ, die in keifenden Sprechgesang flüchten musste. Danach aber das ganze Gegenteil mit Samuel Hasselhorn als Barbier in Blouson und weißen Jeans (hier als Physiotherapeut), denn der Bariton imponierte mit jugendlich-vitaler Stimme von reicher Fülle und schönem Klang, darüber hinaus mit agiler Darstellung und starker Präsenz. Fast schon heldentenoral legte Siyabonga Maqungo den Henry an. Die metallischen Spitzentöne waren durchaus beeindruckend, doch hätte man sich zuweilen mehr lyrischen Schmelz gewünscht. Kompetent besetzt waren seine spielfreudigen Komödianten mit Serafina Starke (Isotta), Rebecka Wallroth (Carlotta), Dionysios Avgerinos (Morbio), Manuel Winckhier (Vanuzzi) und Friedrich Hamel (Farfallo).
Die forderndste Partie des Stücke ist Aminta – ein hoher Koloratursopran in Zerbinetta-Nähe. Die Amerikanerin Brenda Rae ist eine Spezialistin für dieses Fach und demonstrierte auch bei ihrem Haus-Debüt in Berlin ein hohes technisches Vermögen und absolute Souveränität bis in die Extremlage. Die obertonreiche Stimme dominierte die Ensembles, war gleichermaßen zart in den lyrischen Passagen wie hochdramatisch im Ausbruch am Ende des 2. Aktes, wenn sie „Ruhe!“ einfordert und ein glitzerndes Koloratur-Feuerwerk nachschickt. Ein anrührender Sir Morosus war Peter Rose mit sanftem Bass, dem man manchmal etwas mehr Volumen gewünscht hätte, aber die menschliche Darstellung der Figur mit entsprechend feinen Zwischentönen ging sehr nahe. Unter seinen Schlussmonolog „Wie schön ist doch die Musik“ legte Thielemann mit der Staatskapelle Berlin einen sublimen Streicherteppich. Die Musik funkelte sprühte, glänzte unter seiner Leitung, lärmte auch, und der Dirigent legte sich in solchen Passagen keine Zurückhaltung auf, fand aber immer wieder die Balance zwischen Bühne und Graben. Das Premierenpublikum am 19. 7. 2025 in der ausverkauften Staatsoper feierte die Sänger, das Orchester und den Dirigenten euphorisch, ließ aber auch Missfallen gegen das Regie-Team hören. Bernd Hoppe
.
.
Zum ersten Mal Spiros Samaras´Oper „Medgé“ in Athen in neuer Orchestrierung: Eine weitere Oper des Komponisten Spyros Samaras aus Korfu, das Meisterwerk „Medgé“, wurde im Rahmen einer Hommage an den großen griechischen Komponisten des Verismo in Zusammenarbeit mit dem Athener Philharmonischen Orchester auf der Bühne des Olympia-Theaters in einer neuen Orchestrierung aufgeführt.
Samaras, der Komponist, der die Olympiahymne vertont hat, war zweifellos der bedeutendste und erste Komponist der Ionischen Schule, der internationale Anerkennung erlangte. Seine Karriere blühte in Paris, Mailand und anderen Städten Italiens, bevor er zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Griechenland zurückkehrte. Leider sind die meisten Opern von Samaras nur in gekürzter Form, in Transkriptionen für Gesang und Klavier, erhalten, wobei die Originalorchestrierungen des Komponisten offenbar für immer verloren sind.

Samaras „Medgé“ im Konzert in Athen/Foto Maria Callas Olympia
Der erfahrene Dirigent Byron Fidetzis arbeitet seit vielen Jahren systematisch an der Wiederbelebung von Samaras‘ Werk und hat aus diesem Grund mehrere seiner Opern neu orchestriert, damit das zeitgenössische Publikum sie genießen und würdigen kann.
Nach der Wiederaufführung der Oper „Lionella” im Mai 2023 setzte der künstlerische Leiter der Philharmonie seinen unschätzbaren Beitrag zur Verbreitung des griechischen klassischen Repertoires fort und orchestrierte „Medgé” neu.
Mit diesem Satz hat der berühmte italienische Dichter und Dramatiker von Puccini und Samara (1861-1917), Ferdinando Fontana (1850-1919), vor etwa 140 Jahren das „Phänomen” Samara vorausgesagt! „Hören” Sie es sich mit Ihrer Fantasie und im Original an: Spiro Samara: una vera stoffa d’operista! Ist die Musikalität der Worte nicht erstaunlich?“
Und ein Beweis für diese höchst lobenden und bedeutungsvollen Worte für die Zukunft, die ein „renommierter“ Schriftsteller unserem jungen 22-jährigen Barden aus Korfu in Italien entgegenbrachte – obwohl wir zuvor nur seine späteren Opern „Despo“, „Lionella“, „Rea”, die mit der „Olympischen Hymne” beginnt, und „Tigra”, sowie seine Operetten „La Cretopoula” und „Die Prinzessin von Sassoon”, sowie die Aufnahmen von „Xanthoula” und „La Martyr” – war zweifellos der Höhepunkt der Aufführung im „Olympia” – dem Städtischen Musiktheater „Maria Callas“, das jugendliche Werk des Komponisten in vier Akten, „Medgé“.
Nach der Wiederaufnahme der Oper „Lionella“ im Mai 2023 hat der Dirigent Byron Fidetzis, der seinen unschätzbaren Beitrag zur Verbreitung des wissenschaftlichen griechischen Repertoires fortsetzt, „Medgé“ neu orchestriert, da die Orchestrierung von Samaras wie im Falle von „Lionella“ als verloren gilt.
Die Oper, die nach dem französischen Originallibretto von Pierre Elzéar aufgeführt wird, ist eine beeindruckende Leistung des erst 22-jährigen Samaras. Ihr unendlicher melodischer Reichtum wurde von einer hervorragenden Besetzung von griechischen und französischen Opern-Sängern dargeboten.
Es war ein „Ozean“ origineller musikalischer Themen, die so vertraut sind und doch noch nie zuvor gehört wurden, sodass man sich dabei ertappt, abstrakt vor sich hin zu summen oder leicht im Takt der Ballettmusik des Werks mitzuwippen, als wäre es etwas ganz Eigenes. Aber ist das nicht das Wesen wahrer Kunst?
Was Byron Fidetzis betrifft, der das Werk nach dem Verlust der Originalpartitur neu orchestriert und damit eine weitere Meisterleistung in unserem Musikleben vollbracht hat, was soll man da noch sagen! Wir glauben, dass selbst wenn die Italiener 1888 in Rom ein völlig anderes Werk gehört hätten, Samaras, wäre er anwesend gewesen, von Fidetzis‘ „Handwerkskunst” begeistert gewesen wäre.
In der Musik des Komponisten konnte man die französische Finesse und den Einfluss seiner französischen Kollegen und Lehrer Delibes („Lakmé”), Bizet (Les Pêcheurs de Perles), Charpentier (Louise) und Chabrier (L’Étoile), aber auch in der „trionfale” „alla” „Aida“ mit den links und rechts „abgeschnittenen” (!) Trompeten. Vorbildliche Ensembles von Sängern im italienischen Belcanto-Stil von Donizetti (siehe Sextett) und seine Ballette im französischen Stil (siehe Verdis „Vespri siciliani“), sowohl in der Oper als auch in französischen Operetten „à la“ (die an den berühmten Klein-Chuck aus „Les contes d´Hoffmann“, aber auch an die österreichisch-ungarische Operette seiner Zeit erinnern), aber immer mit einem persönlichen Stil, der nicht von seinen Zeitgenossen kopiert oder „gestohlen” wurde, sondern sich nur von den musikalischen Entwicklungen um ihn herum beeinflussen ließ, als Student und Kollege, der in ganz Europa intensiv studierte und dessen gesamtes musikalisches Œuvre das Gefühl vermittelt, dass etwas Neues die Geschichte unserer Kunst erschüttern wird, und die Wahrheit offenbart wird, um den kommenden musikalischen Trend des Verismo einzuführen und „zu gebären”, der von seinen Kollegen Puccini, Leoncavallo und Mascagni zu Recht als „Vater” dieser Bewegung bezeichnet wurde. Ein Beweis dafür ist das Intermezzo zwischen dem 3. und 4. Akt.
Bühnenbild für Samaras „Medgé“ 1887 von Carlo Ferrario/Ricordi Archivio Storico
Das Athener Philharmonische Orchester, der Athener Stadtchor unter der Leitung des Dirigenten Stavros Beris und die Solisten in Bestform, obwohl für eine ausgewogene Balance mindestens ein weiterer Chor erforderlich gewesen wäre. Die Rollen wurden gespielt von: Lucie Peyramaure (Mezzo), Konstantinos Klironomos (Nair), Dimitris Platanas (Selim), Héloïse Mas (Vazanda), Tassos Apostolou (Kantur) und Florent Leroux-Roche (Amtziad), die vom Pianisten Apostolos Palaios tadellos vorbereitet worden waren (17. 02. 254).
Das Publikum, das den Theaterraum füllte, rief „Bravo” und applaudierte lange, was für die griechische Oper in unserer Zeit ungewöhnlich ist, und ließ die Künstler nicht von der Bühne. Es war ein echter Triumph für Samaras, Fidetzis und alle anderen. In Korfu und Italien wären sie sicherlich mit Rosenblättern überschüttet worden, wie es Tradition ist. Und es stellt sich erneut die Frage, warum die Nationaloper all diese erstklassigen griechischen Opern von Samaras, Carrer, Lavraga usw. nicht in ihr Repertoire aufnimmt und unsere 200-jährige Tradition in der Versenkung verschwinden lässt. Kostas Xakenis
.
.
Gounods Roméo et Juliette an der Semperoper: Stimmenglanz in szenischer Ödnis. 1867, ein halbes Jahr nach der Pariser Uraufführung, erlebte Charles Gounods Roméo et Juliette die deutsche Erstaufführung am Königlich Sächsischen Hoftheater Dresden. Nun inszenierte die polnische Schauspielerin und Regisseurin Barbara Wysocka das Drame lyrique an diesem Haus neu. Man sah eine Aufführung, welche Ort und Zeit der Handlungsvorlage negiert, sie stattdessen zwischen vergangenem Jahrhundert und Gegenwart sowie an einem beliebigen, austauschbaren Platz ansiedelt. Barbara Hanicka hatte drei hohe graue Betonwände mit schmalen Öffnungen auf die Bühne gestellt, die von Fabio Antoci in diffuses Licht getaucht werden und durchweg mediterrane Stimmung vermissen lassen. In ihrer Ästhetik ist die Szene zwischen Mussolinis faschistoider Architektur und Giorgio de Chiricos Bildwelten einzuordnen. Ärgerlich sind Julia Kornackas heutige und besonders hässliche Kostüme von Jeans bis zum unkleidsam kurzen Ballkleid mit Glitzereffekt für Juliette. Unnötig waren die von der Regisseurin ausgewählten Zitate aus Shakespeares Tragödie, welche an eine Wand projiziert werden. Es gelingt ihr dagegen nicht, in zentralen Szenen eine passende Stimmung zu evozieren – beim Maskenball der Capulets konzentriert sie sich mehr auf Fotografen und Security-Personal als auf eine ausgelassene Fest-Atmosphäre. Profan inszeniert ist die Vermählung des Paares mit Flitter und Sektflasche, nicht sehr professionell wirken die Kampfszenen, wenig Flair haben die intimen Szenen zwischen den Liebenden.

Jean de Reszke als Roméo/OBA
Wieder einmal wurde das Premierenpublikum am 3. 5. 2025 mit einer musikalischen Darbietung auf hohem Niveau entschädigt. Robert Jindra, Musikdirektor des Prager Nationaltheaters, motivierte die Sächsische Staatskapelle Dresden bei seinem Hausdebüt zu farbenreichem, schillerndem Spiel mit kostbaren lyrischen Valeurs und spannenden dramatischen Akzenten. Gern hätte man vom Orchester auch die Ballettmusik im 4. Akt gehört, die leider gestrichen war. Packende Momente sind dem Sächsischen Staatsopernchor (Einstudierung: Jan Hoffmann) zu danken, so im Prologue („Vérone vit jadis deux familles rivales“) oder im ergreifenden Gesang nach Tybalts Tod („Ô jour de deuil!“).
Exzellent besetzt sind die Titelpartien. Die finnische Sopranistin Tuuli Takala, Ensemblemitglied des Hauses, brillierte als Juliette mit leuchtendem lyrischem Sopran von schöner Substanz. Nur in wenigen exponierten Tönen vernahm man eine Spur von Grellheit. Die Ariette „Je veux vivre“ war erfüllt von übermütiger Ausgelassenheit, das Liebesduett „Ô nuit divine!“ von innigem Gefühl und die große Scène et air („Dieu! quel frisson“) nach der Einnahme des Schlafmittels von reifem Ausdruck und leidenschaftlichem Engagement. Einen Tenor von enormer Pracht ließ der australisch-chinesische Tenor Kang Wang hören, der als Roméo an der Semperoper debütierte. Die reich timbrierte Stimme schien ohne Grenzen in der metallischen Höhe, ohne Limit in der Durchschlagskraft. Mit ihrer Tendenz zum heldischen Repertoire fehlte es ihr zuweilen ein wenig an jugendlichem Zauber, aber die Duette mit der Takala waren erfüllt von schwelgerischem Wohllaut.
Roméos Freunde Mercutio und Benvolio waren mit dem Bariton Danylo Matviienko und dem Tenor Jongwoo Hong solide besetzt, während der Bariton Oleksandr Pushniak als Capulet mit seiner Raum greifenden Stimme von patriarchalischer Aura besonders gefiel. Einmal mehr imponierte Georg Zeppenfeld als jugendlicher Frère Laurent mit profundem Gesang. Beschwörend seine Schilderung der Wirkung des Trankes („Buvez donc ce breuvage“). Auch Tilmann Rönnebeck als Duc de Vérone überzeugte mit Bassfülle und autoritärem Auftritt. Aus der Familie der Capulets gaben Brian Michael Moore mit in der Höhe etwas engem Tenor den Tybalt und Gerrit Illenberger mit sonorem Bariton den Paris. Feminine Töne brachten Michal Doron mit leichtem Mezzo als Juliettes Amme Gertrude und Valerie Eickhoff als Stéphano, die das Chanson „Que fais-tu, blanche tourterelle“ mit aparter Stimme und pointierter Diktion vortrug, ein. Nach dem gemeinsamen Liebestod von Roméo und Juliette, dem berührenden Schlussduett „Console-toi, pauvre âme“, endete die Premiere im anhaltenden Jubel des Publikums. Bernd Hoppe
.
.
Staatstheater Darmstadt: Daniel Aubers La muette de Portici. Man kann sich einigermaßen das Erstaunen des Regisseurs vorstellen, als er feststellten musste, dass es sich bei Aubers La muette de Portici um ein Stück handelt, das kaum mehr dazu angetan ist Opernbesucher wachzurütteln. Bemerkenswert ist der lodernde Aufruf der neapolitanischen Fischer, der einst eine Revolution auslöste, allenfalls als Geburtsstunde der Grand opéra und ihren aufwendig produzierten spektakelhaften Historienstoffen, die in den Werken von Meyerbeer und Halevy kulminierten und deren Spuren wir bei Donizetti wie Verdi finden. Im Stil eines engagierten Bürger*innentheaters versuchte Paul-Georg Dittrich deshalb den Fünfakter des Daniel-François-Esprit Auber zur brisanten Politkunst aufzumotzen und die Zuschauer durch „Seid ihr bereit?“- oder „Glotzt nicht so romantisch“-Sprüche anzumachen. Zuerst vor zwei Jahren im nordhessischen Kassel. Jetzt am Staatstheater im südhessischen Darmstadt, das sich das Spielzeitmotto „Schön geträumt“ verordnet hat und mit dem Genre überfordert schien.
Der Reihe nach. Den historischen Rahmen der von Aubers Librettisten Scribe und Delavigne ersonnen Handlung bildet der vom Fischer Masaniello angeführte Aufstand der neapolitanischen Fischer gegen die spanische Besatzung und deren Steuerauflagen im Jahr 1647. Überwölbt wird die Handlung vom Schicksal von Masaniellos stummer Schwester Fenella, die von Alphonse, dem Sohn des spanischen Vizekönigs, verführt wird und bei dessen Braut Elvire Schutz findet. Masaniello und die Fischer schwören an dem Verführer Rache zu nehmen. Der fünfte Akt endet mit dem Tod des Masaniello, der zuvor Elvire rettet, der Niederschlagung des Aufstands durch die Spanier und dem Ausbruch des Vesuvs. Das Volk singt „Grâce pour notre crime!/ Gnade für unser Verbrechen“.
Die am 29. Februar 1828 in Paris uraufgeführte Oper, die allein in Paris bis in die 1880er Jahre über 500-mal gespielt wurde, trat rasch einen Siegeszug über viele deutsche Bühnen an, gelangte über Budapest, London und Amsterdam bis nach New York, Sydney und Rio de Janeiro und schließlich 1870 nach Kairo. Noch 1828 erfolgte in Rudolstadt die deutsche Erstaufführung. Bei Aufführungen in Frankfurt soll es zu Zwischenfällen gekommen sein, die mancherorts bis zum Deutsch-Französischen Krieg – teilweise mit eingeschobener Musik – immer wieder aufflackerten. Keine Aufführung war jedoch so folgenreich wie jene am 25. August 1830 in Brüssel, wo die Menschen nach dem Masaniello/Pietro-Duett im zweiten Akt „Amour sacré de la patrie/ Geheiligte Liebe zum Vaterland“ Masaniellos Waffenruf im dritten Akt „Aux armes! An die Waffen!“ wörtlich nahmen und vor dem Opernhaus auf die Barrikaden stürmten, was zur Belgischen Revolution und letztlich der Unabhängigkeit Belgiens führte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ließ die Anziehungskraft der Oper nach, die sich bei Wiederaufführungen praktisch umfunktionieren ließ, etwa in den 1950er Jahren an der Berliner Staatsoper im Sinne des Arbeiterkampfes. Ich hatte das Stück zuletzt in Dessau gesehen, wo André Brück Die Stumme von Portici nicht mit den neuen Problemen vor Ort belastete, sondern sie in den heutigen Docks von Neapel spielen ließ, wo sich die Arbeiter gegen die übermächtige Camorra wehren.

Aubers „Muette de Portici“ in Darmstadt/Foto Benjamin Weber
Der findige Paul-Georg Dittrich schien angesichts des Brockens etwas ratlos. Also wird im Zuschauerraum eine moderne junge Frau vom Scheinwerfer erfasst, worauf sie auf die Bühne geht, staunend ein mehr oder weniger bürgerliches Wohnzimmer mit Blick auf klassizistische Häuserzeilen betritt, erfolglos mit der Konsole werkelt, „You died“, und historische und zeitgeschichtliche Bilder von Büchner bis Marx über die Wände flimmern. Angewidert blendet sie das Kriegsgeschehen und die beunruhigen Bilder weg und wirft eine Decke über den Fernseher. Es ist Fenella, die titelgebende Stumme, die bald durch eine fast lebensgroße Puppe ersetzt wird. Endlich haben Kapellmeister Johannes Zahn und das Darmstädter Staatsorchester mit der langen Ouvertüre begonnen, während der das Wohnzimmer weggeräumt wird – wobei sich die Darmstädter Technik an diesem Abend immer nachdrücklich Gehör verschafft – eine Wandelhalle im neogotischen Stil erscheint und der Chor das Glück des Alphonse besingt. Eine Zeitreise, die eher ins deutsche Biedermeier als die französische Restauration (Bühne: Sebastian Hannak) zu führen scheint. Ebenso pittoresk (Kostüme: Anna Rudolph) und trügerisch erweist sich das Gestade, wo sich die Fischer sammeln. Denn kaum haben sie neben einem Goya-Galgen den patriotischen Weckruf angestimmt und sich die Bürger*innen-Statisten vor dem populären Bild „Die Freiheit führt das Volk“ von Delacroix postiert, dringen kurz „Bella ciao“- und „Die Gedanken sind frei“-Einschübe an. Unnötigerweise wird das folgende Duett Elvire/Alphonse zu Beginn des dritten Aktes hinter dem Vorhang gespielt, der Orchestergraben und Zuschauerraum trennt, und auf dem nun vierfach geteilten Vorhang-Bildschirm durch Einfügungen mit einem Komponisten und Regisseur sowie Einwände der Sänger, die die Handlung in Frage stellen, einen historischen Zeitstrahl und stete Hinweise auf Büchner und seinen 1834 in Darmstadt verteilten „Der hessische Landbote“ unterbrochen und kommentiert. Das verständliche Mühen um Entmusealisierung, Kontakt zum Publikum und gesellschaftliche Relevanz dringt der Aufführung aus allen Poren und zerfleddert die Oper.
Die Sängerin der Elvire hat recht: „the music is boring“. Wobei Megan Marie Hart nach anfänglich harscher und spitzer Tongebung bereits in der ersten Arie einen wirkungsvoll aufblühenden Sopran zeigt; mit dramatischem Glanz, guter Höhe und präsentem Ausdruck erzielt sie die schönste Leistung des Abends. Der Alphonse des Ricardo Garcia hinterlässt keinen Eindruck, Matthew Vickers wirkt trotz schöner Mittellage mit der Tessitur des Masaniello überfordert, die reizvolle Barcarole „Amis, la matinée est belle“ bleibt glanzlos, in der Kavatine im vierten Akt müht er sich tapfer, aber vergebens. Kraftvoll halten Chor und Extra-Chor dagegen, auch das Staatsorchester, das mir oftmals zu laut, undifferenziert und routiniert klang. Während Georg Festl in der Partie von Masaniellos Freund Pietro raubaritonal grobkörnig blieb, fiel unter den Nebenrollen einzig der profunde Bass des Johannes Seokhoon Moon als Selva, Anführer der spanischen Leibwache, auf; natürlich auch die von zwei Spielerinnen (Franziska Dittrich und Lilith Maxion) geführte und von zahlreichen Live-Kameras effektvoll und geradezu sprechend in Szene gesetzte Fenella-Puppe. Die Kameras kommen nach der Pause im sich unendlich dehnenden zweiten Teil nochmals verstärkt zum Einsatz, um die wie in Verhörsituationen an Tischen hockenden Protagonisten einzufangen. Die „Bürger*innen“ beschauen sich das Geschehen und unterbrechen häufig, um ihre Stimmungen und Hoffnungen zum Ausdruck zu bringen, sexuellen Missbrauch, die Migrationsbewegung über das Meer, Pakistan und die Taliban, Geschlechtergerechtigkeit und unseren Wohlstand anzusprechen und soziale Nähe einzufordern. Rolf Fath
.
.
An der Berliner Staatsoper: Norma als Fabrikarbeiterin. Jüngst gab es an der Oper Leipzig eine Aufführung von Bellinis Norma, in der die Priesterin als Krankenschwester im Lazarett Kriegsverwundete pflegt. Die Staatsoper Berlin zeigte als ihre Festtags-Produktion Vasily Barkhatovs Inszenierung aus dem Musik-Theater an der Wien, in der Norma im schwarzen Overall (Kostüme: Olga Shaismelashvili) in einer Keramikwerkstatt Büsten brennt, die dem auf einem Foto zu sehenden Diktator gleichen (Bühne: Zinovy Margolin). Beide Deutungen sind so absurd wie profan und gehen an der Libretto-Vorlage von Felice Romani vorbei. Da ist Norma die Priesterin des Mondes, wofür sie ein Keuschheitsgelübde ablegen musste, so dass ihre beiden heimlich zur Welt gebrachten Kinder mit Pollione ein Vergehen sind, welches sie am Ende mit ihrem Freitod sühnen will.

Bellinis „Norma“ an der Berliner Staatsoper/Szene/Foto Bernd Uhlig
Zur Sinfonia sieht man, dass früher in der Manufaktur Engelsfiguren hergestellt wurden, die von einer hereinstürmenden Soldateska brutal zerstört werden. An die Scherben richtet Norma ihre berühmte Kavatine „Casta Diva“, mit der die amerikanische Sopranistin Rachel Willis Sørensen bei ihrem Haus- und Rollendebüt mit purem Wohllaut und in technischer Vollendung imponiert. Die Stimme ist eigentlich ein „blonder“ Sopran für das lyrische Mozart- und Strauss-Fach von Contessa bis Arabella. Aber schon das Auftrittsrezitativ „Sediziose voci“ zeigt eine Veränderung des Timbres, das nun reifer und dunkler klingt. Der Vortrag besitzt Nachdruck, Autorität und Würde, der Sopran Fülle, Leuchtkraft und sichere Spitzentöne. Neu war die Bekanntschaft mit Elmina Hasan aus Aserbaidschan, die als Adalgisa einen wunderbar ebenmäßigen, warmen und jugendlich tönenden Mezzo hören lässt. Die beiden Duette mit Norma zählen zu den vokalen Höhepunkten der Premiere am 13. 4. 2025. Mirakulös der Zusammenklang der beiden sich umschlingenden Stimmen, phänomenal ihre Agilität. Optisch stellt sich diese erhabene Wirkung leider nicht ein, weil die beiden Frauen an einem runden Tisch den Kaffee einnehmen. Wenig Persönlichkeit strahlt der russische Tenor Dmitry Korchak als Pollione im biederen Büro-Anzug aus. Der Sänger kommt vom Rossini-Repertoire, was seine stupende Extremhöhe beweist, die er auch großzügig einsetzt. Mancher Ton gerät etwas forciert, aber Cavatina und Cabaletta des Auftritts besitzen energischen Aplomb und virile Kraft. Im 2. Akt findet er auch zu differenzierterer Stimmgebung mit zarten Kopftönen. Der Italiener Riccardo Fassi ist ein ungewöhnlich jugendlicher Oroveso mit profundem Bass. Solide besetzt sind die Nebenrollen mit dem jungen Tenor Junho Hwang als Flavio und der Sopranistin Maria Kokareva als darstellerisch aktive Clotilde.
Der Staatsopernchor (Einstudierung: Dani Juris) als Fabrikarbeiter in grauen Overalls beeindruckt besonders im aggressiven „Guerra!“-Aufruf. Die Staatskapelle Berlin spielt unter der engagierten Leitung von Francesco Lanzillotta pulsierend und in der Sinfonia mit fiebriger Eile. Im Kontrast dazu wählt der Dirigent später auch retardierende Momente und sorgt so für manche Überraschung. Souverän ist seine zuverlässige Begleitung der Sänger.
Der gravierendste Eingriff des Regisseurs ist das Finale, wenn Norma ihr Leben (statt auf dem Scheiterhaufen) im Brennofen auslöschen will. Optisch bringt diese Szene fatale Erinnerungen an Vernichtungslager. Pollione, der durch Normas Eingreifen selbst dem Tod entgeht, verhindert die Tat und reißt sie aus den Flammen. Ob dieses lieto fine den beiden Menschen in Zukunft wirklich das Glück bringt, steht in den Sternen. Das Publikum feierte die Sänger, beurteilte die Regie aber kontrovers. Bernd Hoppe
.
.
Donizettis Anna Bolena am Treatro La Fenice, Venedig: Anna Bolena war seit 1857 nicht mehr an der Fenice zu sehen. Glücklicherweise sind sowohl der Dirigent Renato Belsadonna als auch der Regisseur Pierluigi Pizzi zwei besonders sensible und versierte Künstler, die bereit waren, auf der Grundlage der von Paolo Fabbri herausgegebenen kritischen Ausgabe die strukturellen und stilistischen Neuerungen der Partitur hervorzuheben, unterstützt von einer außergewöhnlichen Besetzung. Was die neue Inszenierung für die Fenice betrifft, so hat Pizzi durch Weglassen gearbeitet und eine allgemeine Vereinfachung des Bühnenbildes zugunsten der Emotionen und der psychologischen Introspektion der Figuren angestrebt. Die Inszenierung ist karg, nüchtern, aber nicht minimalistisch. Die Bühne besteht aus einer großen grauen Holzkonstruktion, die an die spätgotische Architektur erinnert und deren tragende Streben an eine Art großen Käfig denken lassenSie erzeugt das klaustrophobische und bedrückende Gefühl, das die gesamte Geschichte prägt und zu dem auch die allgemein gedämpfte Beleuchtung (entworfen von Oscar Frosio) und die Kostüme beitragen, die größtenteils dunkel und von schlichter Eleganz In dieser monochromen Umgebung stechen wenige Elemente eindrucksvoll hervor, darunter das Rot von Percys Mantel und Giovanna Seymours Kostüm sowie das leuchtend weiße Kleid von Anna vor ihrem tragischen Ende, das sie streng in Schwarz gekleidet absolviert. Im Einklang mit der Inszenierung konzentriert sich Renato Belsadonna auf die Sänger. Seine Interpretation hebt den Gesang hervor.

Donizettis „Anna Bolena“ am Teatro La Fenice/Szene/Foto Michele Crosera/Teatro La Fenice
Gerade in „Al dolce guidami“, einem Ausbruch von ergreifender Lyrik, der dem tragischen Ende der Protagonistin vorausgeht, hat Lidia Fridman das Publikum besonders verzaubert. Ihr stand – mit ihren inter-pretatorischen und stimmlichen Qualitäten – die Sopranistin Carmela Remigio als Giovanna gegenüber: elegant und ausdrucksstark – in ihrem Hin- und Hergerissenheit zwischen Königin, und den Schuldgefühlen wegen des. Sehr lobenswert war auch die Leistung der Mezzosopranistin Manuela Custer in der Rolle der Smeton. Auf der männlichen Seite zeigte der Bass Alex Esposito erneut seine ebenso tiefe wie ausladende Stimme und zeichnete einen despotischen, zynischen und grausamen Heinrich VIII.. Glaubwürdig war der ungestüme Percy des Tenors Enea Scala, der die schwierige Textur einer für Giovanni Battista Rubini konzipierten Rolle würdig meisterte und sich in „Vivi tu, te ne scongiuro“ besonders hervorhob. Positiv zu vermerken sind die Darbietungen des Baritons William Corrò (Rochefort) und des Tenors Luigi Morassi (Hervey) sowie die des Chors unter der Leitung von Alfonso Caiani. Besonders die Protagonistin wurde mit großem Beifall gefeiert (28. 03. 25). Gisela Fechner
.
.
Die Vögel von Walter Braunfels am Staatstheater Braunschweig. In den letzten Jahren wird die bekannteste Oper von Walter Braunfels, die nach der Uraufführung 1920 in München bis zu ihrem Verbot in den 30er-Jahren sehr erfolgreich war, wieder häufiger aufgeführt, auch in mittleren Häusern wie z.B. Osnabrück, Oldenburg und jetzt Braunschweig. Braunfels (1882 bis 1954), der die Arbeit an der Oper 1913 begann, wurde 1915 eingezogen und kehrte erst zum Ende des 1.Weltkrieges in seine Heimatstadt Frankfurt a.M. zurück. Im von ihm selbst verfassten Libretto, das auf das Stück von Aristophanes aus dem Jahr 415 v. Chr. zurückgeht, wird aus der Komödie eine Tragödie, indem die erlebten Zeitumstände mit einfließen. Es wird deutlich, wie schnell Diktaturen entstehen können, was gerade heute hochaktuell ist.

Walter Braunfels/Wikipedia
Die beiden verwöhnten Großstädter Ratefreund und Hoffegut suchen nach dem Reich der Vögel, um sich ganz der „Kunst“ zu widmen und die bisherigen Zerstreuungen hinter sich zu lassen. Ratefreund, machtbewusst und gewitzt, entwirft den Plan zu einer befestigten Stadt in den Lüften namens Wolkenkuckucksheim. Diese Residenz soll so prächtig werden, dass sie den Vögeln die Herrschaft über die Götter und Menschen sichert. Der Wiedehopf, der König der Vögel, berät mit seinem Volk über den Plan. Zunächst dominieren die Gegner, denn mit den Menschen haben viele Vögel sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Doch schließlich siegt der Wille zur Macht, Begeisterung greift um sich und alle nötigen Aufgaben bei den Bauarbeiten von der Beschaffung des Mörtels bis zur Wasserversorgung werden auf die Vögel verteilt. In einer Vollmondnacht trifft der empfindsame Hoffegut auf die Nachtigall und lässt sich von deren Gesang verzaubern. Schließlich ist die imposante Vogel-Stadt errichtet, und alle Beteiligten freuen sich über ihren Erfolg. Prometheus tritt auf und warnt die Vögel vor den Folgen ihres Hochmuts: Noch „schlafe“ Göttervater Zeus, doch wenn er aufwache, werde sein Zorn fürchterlich sein. Ratefreund lässt sich von Prometheus nicht beirren und stachelt die Vögel zum Krieg gegen die Götter auf. Ein gewaltiges von Zeus ausgelöstes Gewitter endet in der totalen Zerstörung von Wolkenkuckucksheim. Wenig berührt von diesem tragischen Ende, kehren Ratefreund und Hoffegut in ihre Stadt zurück. Ratefreund sehnt sich bereits zurück nach heimischer Gemütlichkeit, Hoffegut hängt mit seinen Gedanken ganz der Nachtigall nach, die allein es wert gewesen sei, in die Welt der Vögel aufzubrechen.
In der Braunschweiger Inszenierung der Parabel über menschliche Hybris vermeidet Regisseurin Kerstin Steeb bewusst jede Aktualisierung und setzt auf ein äußerst fantasiereiches Ambiente, das im ersten Teil eine karge Gebirgslandschaft ist, in dem die Vögel in ausladenden, detailverliebten Kostümen stark beeindrucken (Ausstattung: Lorena Días Stephens, Jan Hendrik Neidert). Wohl aus umbautechnischen Gründen wird das lange, berühmte Duett zwischen Hoffegut und der Nachtigall an den 1. Akt angehängt, sodass nach der Pause das Wolkenkuckucksheim als eine riesige Überwachungsanlage erscheint, deren Energie von den Vögeln im Geschoss unter dem „Big-Brother-Auge“ erzeugt wird. Die Choreografin Valeria Liva sorgt mithilfe eines kleinen Bewegungschors dafür, dass auch die Choristen sich als Vögel individuell tiergerecht verhalten und nach der Rede des sich zum Diktator aufspielenden Ratefreund völlig einheitliche, sozusagen gleichgeschaltete Bewegungen machen.
Die musikalische Ausführung hatte in der besuchten Vorstellung in allen Bereichen sehr hohes Niveau: GMD Sraba Dinic hatte den großen Apparat fest im Griff und sorgte am Pult des in allen Instrumentengruppen ausgezeichneten Staatsorchesters mit gewohnter Präzision und mit jeweils deutlich hervorhebender Zeichengebung dafür, dass die spätromantische, mit zahlreichen Wagner-Anklängen versehene Partitur mehr als nur angemessen zur Geltung kam.

Walter Braunfels: „Die Vögel“ am StaatstheaterBraunschweig/Szene/ ©Thomas M. Jauk/Stage Picture
An erster Stelle aus dem insgesamt hochklassigen Gesangsensemble ist eine der Braunschweiger Publikumslieblinge zu nennen: Ekaterina Kudryavtseva beherrschte die stimmtechnisch höchst anspruchsvolle Partie der Nachtigall bravourös. Die vielen extremen Höhen schienen ihr ebenso wie die schönen Legato-Passagen vor allem im Duett mit Hoffegut keinerlei Probleme zu machen. Dieser wurde von Mirko Roschkowski verkörpert, der nicht nur Lyrisches ausdrucksstark zu gestalten wusste, sondern auch tenoralen Glanz verbreitete. Mit ihm drang Ratefreund ins Reich der Vögel ein, dem Michael Mrosek, aus mehreren Partien in Braunschweig in guter Erinnerung, mit seinem überaus flexiblen Bariton so starkes rhetorisches Gewicht verlieh, dass ihm die Vögel sofort in allem folgten. Besonders gefiel auch das Braunschweiger Ensemblemitglied Maximilian Krummen als Wiedehopf, König der Vögel; er führte seinen volltimbrierten Bariton mit bestem Legato durch alle Lagen. Mit durchgehend volltönendem Bassbariton imponierte Johannes Schwärsky als warnender Prometheus. Als klarstimmiger Zaunschlüpfer – besser bekannt als Zaunkönig – überzeugte die Israelin Galina Benevich; dass sie alberner Weise wohl wegen des Namens fast ständig mit heruntergezogenem Schlüpfer agieren musste, ist ihr nicht anzulasten. In kleineren Rollen ergänzten Isabel Stüber Malagamba mit charaktervollem Mezzo (Drossel) und Florian Spiess mit kräftigem Bass (Rabe/Adler). Wieder präsentierte der Chor in der Einstudierung von Johanna Motter trotz beweglichen Spiels gut ausgewogene, mächtige Klänge. Das Publikum in der Nachmittagsvorstellung war begeistert und spendete starken Beifall. Gerhard Eckels
.
.
Am Theater Altenburg Gera Eugen d’Alberts Oper Die toten Augen: In solch einem großbürgerlichen Salon mögen Eugen d’Albert die Ideen zu seinen Opern gekommen sein. Ausstatter Markus Meyer hat ihn sich für die Bühne des Theaters Altenburg Gera, wo d’Alberts Oper Die toten Augen erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Aufführung erlebten (28. März 2025), mit drei hohen Flügeltüren und großmustrigen Tapetenornamenten der Gründerzeit erdacht. Kein spätantikes Brimborium Wie es „Jerusalem zur Zeit des Neuen Testaments“ entsprechen würde. Keine Fenster, keine Spiegel. Die Hausherrin ist blind. Umso sorgfältiger beachten die in lange schwarze Kleider und weiße Schürzen gekleideten Bediensteten die häuslichen Rituale und decken den langen Tisch, an dem sich Myrtocle und ihr Gatte Arcesius niederlassen, so sorgfältig wie für eine festliche Tafel ein. Und umso gewaltiger, die Pracht und Fülle und Gewalt und die explodierenden Farben, mit der die Musik in diese stille Idylle bricht, wenn das Wunder geschehen ist und Myrtocle wieder sehen kann.

D´Alberts Oper „Die toten Augen“ am Theater Altenburg Gera/Szene/Foto Ronny Ristock
Es liegt auf der Hand, dass der bereits 1913 fertiggestellte Einakter, dessen knappes Vorspiel bei der Uraufführung 1916 unter Fritz Reiner in Dresden weggelassen wurde, mit der am gleichen Ort rund zehn Jahre zuvor aufgeführten Salome des gleichaltrigen Richard Strauss verglichen wurde. Wegen ihrer exzessiven Orchestersprache, auch, weil sie in Jerusalem spielt, ebenfalls zur Zeit Jesu, und der Auftritt des Wundarztes Ktesiphar ein bisschen an das Judenquintett erinnert und wegen der sexuell-religiösen Angespanntheit. Dennoch haben sich Die toten Augen, einst d’Alberts größter Erfolg neben dem eigentlich nur noch als Beispiel eines deutschen Verismo bemühten Tiefland von 1903, nicht halten können. Wie keine seiner 21 Opern, mit denen er den Moden der Zeit hinterherjagte, von Hebbel bis zum Kabarett alle Stoffe ausreizte, von dem 1894 uraufgeführten Rubin bis zu den späten Der Golem (unter Clemens Krauss 1926 in Frankfurt) und Die schwarze Orchidee (unter Gustav Brecher 1928 in Leipzig quasi als Reaktion auf Jonny spielt auf ein Jahr zuvor am gleichen Ort), zugleich primitiv wie mondän, die Musikwissenschaftlerin Anna Amalie Abert erkannte darin einen starken „Zug zur Trivialität“. Karl Schumann brachte es auf den Nenner: „Im Hin und Her zwischen den Stilformen war d’Albert kein Ideendramatiker, Moralist oder Weltverbesserer. Dem Theater gegenüber nahm er den Standpunkt des Virtuosen ein… Die Wirkung entscheidet.“
Der in Schottland als Eugène Francis Charles d’Albert geborene, von italienischen Vorfahren abstammende, in Deutschland aufgewachsene und lebende Pianist und Komponist, der 1932 in Riga als Schweizer Bürger starb, war ein Kosmopolit. Den Vornamen wollte er stets deutsch, also Eugen, ausgesprochen wissen. Der Liszt-Schüler, der fast bis zu seinem Lebensende international konzertierte, galt als überragender Beethoven-Interpret, der zudem die Bühnen unermüdlich mit Novitäten belieferte. Zugleich fand er Zeit, sechs Mal zu heiraten. Seinen Lebensmittelpunkt hatte er als Hofpianist des Großherzogs Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach übrigens viele Jahre in Thüringen, wo er zeitweise in Eisenach in der Villa d’Albert unweit der Wartburg lebte.
Die toten Augen sind ein seltsames Stück, eher Gleichnis und Parabel als dramatisches Geschehen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf bildet sozusagen den Rahmen – und wird innerhalb der Oper von Maria von Magdala mit dem Bild vom „Guten Hirten“ aufgegriffen. Wie eine Fortsetzung von Debussys Prélude à l’après-midi d’un faune wirkt die zarte Panflöte, die die pastorale sommerliche Abendstimmung einfängt: die Schnitter kehren vom Feld nach Hause. Ein Hirte vermisst eines seiner Schafe und beginnt trotz anbrechender Nacht mit der Suche nach ihm. Dann der harte Wechsel zur blinden Korintherin Myrtocle, die mit dem römischen Senator Arcesius verheiratet ist. Sie sind glücklich., denn alle verschweigen ihr die Wahrheit: der unansehnliche Arcesius ist arg entstellt. Für Myrtocle ist der Gatte so schön wie der Liebesgott Amor, „Kein Mensch auf der Welt ist so gut wie du – so musst du auch der Schönste sein unter allen Menschen“. Doch es bleibt die übermächtige Sehnsucht, ihn zu sehen. Durch Maria von Magdala erfährt sie von dem Mann aus Nazareth, der gerade einen Toten erweckt habe. An diesem Tage werde Jesu nach Jerusalem kommen. Alle strömen zum Einzug des Wundertäters, der tatsächlich auch Myrtocle sehend macht, ihr aber vorhersagt, dass sie ihn verfluchen werde noch ehe die Sonne untergeht. So geschieht es, denn als Arcesius mit seinem Freund Galba zurückkehrt, hält Myrtocle sofort den attraktiven Galba, der sie schon lange liebt, für ihren Gatten. Aus Eifersucht tötet Arcesius den Freund, denn „einen Traum liebt sie – nicht mich!“. Myrtocle erfährt, dass der Mörder nicht irgendein Monster, sondern ihr Gatte ist, worauf sie so lange in die Sonne blickt, bis sie neuerlich erblindet. Myrtocle und Arcesius wollen „weiterleben in der Träume Welt“. Da schwingt am Ende ein bisschen Salome und „Hättest du mich angesehen…“ mit, doch d’Albert findet eine eigene rauschhafte Musik, von großer Süße und kitschiger Schönheit wie in Myrtocle „Psyche wandelt durch Säulenhallen“, von expressiver Kraft mit nachwagnerischer Deklamation und biegsamem Parlando, doch ohne den großen dramatischen Bogen, weshalb der Einakter eine Häufung spiegelnder Kristalle bleibt, die sich nicht in einem Kaleidoskop bündeln. Doch das Material ist berauschend, was das Philharmonische Orchester Altenburg Gera unter seinem eminenten GMD Ruben Gazarian mit wohligem Klang und feiner Linienführung in der kunstvollen Instrumentation genüsslich auskostete. Manchmal erinnert Myrtocles Suche nach dem Licht im sargdunklen Wohnraum an Judiths Öffnen der verschlossenen Türen auf Blaubarts Burg.

D´Alberts Oper „Die toten Augen“ am Theater Altenburg Gera/Szene/Foto Ronny Ristock
Kay Kuntze hat das pseudohistorische Stück geschickt und klug wie als Kommentar zu Freuds Studien zur „Psychopathologie des Alltagslebens“ entworfen, lässt Raum für Unbewusstes, Gewünschtes, Symbolisches und Geträumtes in Gestalt des schönen engelsgleich schwebenden Apolls (Davit Vardanyan) und der Hirten oder der gleißenden Sonne, die als Traum hinter transparenten Wänden erscheinen. Anne Preuß singt die herausfordernde Partie der Myrtocle mit einem klaren, manchmal etwas forschen und scharfen, aber in den lyrischen Momenten innigen Sopran, der auch in den expressiven Passagen von bemerkenswerter Deutlichkeit bleibt, spielt den Wechsel von der Blinden mit Brille zur Sehenden, die sich dem ersten gutaussehenden Mann an den Hals wirft, überzeugend. Mit warmen Heldenbariton und guter szenischer Präsenz ist Alejandro Larraga Schleske ein Arcesius, mit dem sie es gut aushalten sollte. Als wackerer Freund Galba bleibt Isaac Lee zurückhaltend. Franziska Weber macht mit dem Auftritt der Maria von Magdala nachhaltig Eindruck, Caroline Nkwe, Jana Lea Hess, Iris Eberle und Ina Westphal geben den jüdischen Frauen bzw. Bediensteten starkes Profil ebenso wie Julia Gromball der treuen Arsinoe. Ein Wunder vollbrachte Jan Kristof Schlip, der als skurriler Wunderheiler Ktesiphar nicht erkennen ließ, dass er kurzfristig und ohne Orchesterprobe eingesprungen war. Langer und herzlicher Applaus für die formidable Aufführung und eine Ausgrabung, von der Intendant Kuntze weiß, daß sie trotz allen Glanzes folgenlos bleiben wird, da der Markt „seine eigenen Gesetze hat“. Rolf Fath
.
.
An der Staatsoper Hamburg: Eine Königin aus Albanien: Die Saison 2024/25 nähert sich bald ihrem Ende, da konnte die Staatsoper mit der Neuinszenierung von Donizettis Maria Stuarda noch einen fulminanten Erfolg einfahren. Es war die allererste Aufführung der Tragedia lirica in Hamburg überhaupt und man darf der Produktion nach dem Premierenabend am 16. März 2025 eine lange Erfolgsstrecke voraussagen. Der Jubel des Publikums galt vor allem der exzellenten und ausgewogenen Besetzung, welche von Ermonela Jaho in der Titelpartie angeführt wurde. Die albanische Sopranistin ist weltweit im Verdi- und Puccini-Fach sowie veristischen Repertoire unterwegs. Die Maria Stuarda Donizettis war ein Rollendebüt und schlagender Beweis für ihre Kompetenz auch im Belcanto. Ihr weicher, in jedem Ton gerundeter und in der Höhe wunderbar aufblühender Sopran klang innig und sanft, formte feinste Gespinste von bestechender Phrasierungseleganz und ließ Spitzentöne von enormer Leuchtkraft und ohne jede Schärfe hören. Kontrastreich dazu die Konfrontation mit Elisabetta im Park, wo sie in rasendem Furor die englische Königin als Hure beschimpft, ihr die Krone vom Haupt reißt und für sich beansprucht. In vokalem Ausnahmezustand scheute sie hier auch den veristischen Ausbruch nicht und erzielte damit immense Wirkung. Ergreifend war die ausgedehnte Finalszene mit einem inbrünstig gesungenen Gebet und dem schmerzlichen, doch gefassten Abschied vom Leben. Neben ihr behauptete sich die usbekische Sopranistin Barno Ismatullaeva als Elisabetta eindrucksvoll. Die Stimme ist dunkler und strenger getönt als die ihrer Konkurrentin, raumfüllend und durchschlagend, energisch und autoritär im Ausdruck. Im Duett mit Maria fand sie zu verschlagenen Tönen, welche eine faszinierende Farbe einbrachten und sich in das klangliche Gesamtspektrum aus rachsüchtigen, triumphierenden, höhnischen und verletzlichen Nuancen aufregend einfügten.

Donizettis „Maria Stuarda“ an der Hamburgischen Staatsoper/Szene/Foto Brinkhoff-Möggenburg
Nicht sehr umfangreich, aber dennoch anspruchsvoll ist die Partie des Roberto, Graf von Leicester, der von beiden Königinnen umworben wird und Elisabetta immer wieder um Gnade für Maria bittet. Im 1. Akt hat er eine emphatische Cavatina („Questa imago, questo foglio“) zu singen, der eine bravouröse Cabaletta („Ah! rimiro il bel sembiante“) folgt. Der chinesische Tenor Long Long imponierte mit potenter, farbenreicher Stimme und virilem Ausdruck. Solide Leistungen erbrachten der Bassist Alexander Roslavets als Graf Talbot, der um Gnade für Maria bittet, und der Bariton Gezim Myshketa als Lord Cecil, der in seiner Funktion als Elisabettas engster Berater auf Marias Hinrichtung drängt. Der Chor des Hauses (Einstudierung: Eberhard Friedrich) hatte seinen großen (und bewegenden) Auftritt in der Preghiera vor Marias Hinrichtung. Antonino Fogliani leitete das Philharmonische Staatsopernorchester Hamburg sehr umsichtig und mit großer Aufmerksamkeit für die Sänger, die sich vom Orchester jederzeit sicher getragen fühlen konnten. Spannungsreich modelliert waren die Kontraste zwischen zarten, elegischen, bedrohlichen, aggressiven und dramatisch dichten Momenten. Nach dem euphorischen Erfolg der Aufführung hofft man nun auf eine Tudor-Trilogie in den kommenden Jahren.
Inszeniert hatte Karin Beier, Intendantin des Hamburger Schauspielhauses und eine prominente Figur in der Theaterszene. Vor jedem Akt lässt sie ein Königinnen-Double vor dem Vorhang im Spot Texte rezitieren, die aus Aufzeichnungen der beiden Regentinnen stammen. Im Verlauf des Geschehens vermehren sich diese Doubles bis zu sechs für jede Königin, identisch gewandet in Rot und Weiß für Elisabetta sowie Schwarz und Weiß für Maria und die Höflinge (Kostüme: Eva Dessecker). Sie sind die personifizierten Überbringer von Gefühlen und geheimen Gedanken der Monarchinnen. Die Regisseurin fand ihr Konzept aus einer mittelalterlichen Theorie, nach der jedem Herrscher zwei Körper zugeordnet sind – der politische (männlich imaginierte) zur Repräsentanz der politischen Macht und der biologische (weibliche) für die privaten Emotionen. Wenn Elisabetta sich ihren intimen Gefühlen hingibt, legt sie ihre königliche Robe ab und übergibt sie einem ihrer Doubles. Das Spiel mit den Kostümen prägt auch das Finale, wenn Maria, kahl geschoren, in hochgeschlossenem schwarzem Mantel auftritt und diesen beim Gang zum Schafott ablegt. Darunter trägt sie eine rote Robe, ganz wie Elisabetta, und wird in ihrer Vision im Tode zur englischen Königin.
Eindrucksvoll ist das monumentale Bühnenbild von Amber Vandenhoeck – ein hoher Raum aus grauen Granitplatten mit schmalen Schlitzen in der Höhe, der einen Bunker oder ein Gefängnis suggeriert. In der Mitte sieht man einen drehbaren Quader, dessen Öffnungen private Räume der Königinnen zeigen. Über allem schwebt ein silbernes Kunstobjekt in Form eines Tränentropfens, was eine surreale Stimmung erzeugt. Ergänzt wird die Optik durch Videos von Severin Renke – historische Porträts der beiden Herrscherinnen, blutige Jagdszenen, Juwelenschätze und die gnadenlose Rasur von Marias Kopfhaar. Dass die Regie ohne platte Aktualisierungen auskommt ist anzuerkennen, auch wenn sie einige sattsam bekannte Chiffren des Regietheaters nicht vermeidet – der Chor mit Transparenten („Gracia“, „Pietà“, „Gnade“), Parolen an den Wänden („My end is my beginning“, „Whore!“) und Kameramänner, die den Tod live filmen, wie es in Aufführungen von Castorf & Co. schon vor Jahren zu sehen war. Aber mit Maria, die rücklings mit ausgebreiteten Armen auf dem Schreibtisch liegt, endet die Aufführung mit einem starken Bild. Bernd Hoppe
.
.

„Norma“ an der Wiener Staatsoper/Szene/Foto Michael Poehn
Casta Diva – Inflation in Wien: Jahrzehntelang war Vincenzo Bellinins Norma, die zwar in Italien und romanischen Ländern als d i e klassische Oper schlechthin gilt (aber in unseren Breiten nie besonders populär war), in Wien nicht zu sehen. Und jetzt in knapp einem Jahr gleich drei Mal.
Den Anfang machte im Juli eine Produktion im Stift Klosterneuburg, die von der Wiener Kritik als „Steinzeit-Unternehmung“ und „Operation Hinkelstein“ verhöhnt wurde. Und jetzt folgten innerhalb von 1 Woche (!) gleich zwei Neu-Inszenierungen des Belcanto-Meisterwerks, sowohl an der Wiener Staatsoper als auch am Theater an der Wien. Man weiss ja, was von Statements von Opernintendanten zu halten ist, dass sie sich ohne alle gut verstehen und ihren Spielplan aufeinander abstimmen (letztes Jahr „durfte“ man gezählte drei Carmens erleben), aber soo geballt hatte man sinnlose Triplagen auf Steuerzahlerkosten noch nie erlebt.Unverständlich.
Fangen wie mit der Staatsoper an: die hatte den französischen Regisseur Cyril Teste (der am selben Haus schon eine Salome in den Sand gesetzt hatte) mit der Inszenierung beauftragt.
Es gibt ein paar Video-Projektionen auf den Gaze-Vorhang, es gibt wieder einmal (wie originell !) ein paar Live-Kameras, aber ansonsten herrscht ganz ungeniert jenes Prinzip vor, das die Briten in unnachahmlicher Weise „park & bark“ nennen: an die Rampe gehen, sich hinstellen und ohne Rücksicht auf Verluste frontal ins Publikum darauf losschmettern. Und das Ganze in scheußlichen Kostümen: Pollione trägt (warum?) eine braune Lederjacke zur schwarzen Hose, Norma hat einen fürchterlichen lilaesken Fetzen an, Aldagisa denselben Putzfrauenkittel in Grau…Kinder, wie soll sich denn diese tödliche Dreiecksgeschichte, die sich doch in erster Linie um Erotik, Begehren Leidenschaft, Eifersucht und Sex dreht, bei solchen Liebestötern ausgehen ? Kopfschütteln.

„Norma“ an der Wiener Staatsoper/Szene/Foto Michael Poehn
Wenn dann wenigstens gesanglich die Druidenpost abgehen würde….aber weit gefehlt. Am meisten überzeugt noch Vasilisa Berzhanskaya als Adalgisa (obwohl sie gegen besagten grauen Kittel und noch dazu entstellende Stirnfransen anzusingen hat). Auch Anna Bondarenko lässt in der undankbaren Rolle der Clotilde mit einem schönen Sopran aufhorchen. Federica Lombardi hingegen ist jeder ihrer vielen Zölle keine Norma, sondern ein mittelmäßiges Sing-Mannequin, das ihre Gefühle durch standardisierte Gesten aus dem Theatermuseum auszudrücken versucht. Immerhin war da auch der erfahrene Ildebrando D´Arcangelo als dräuender Oberrpeister Oroveso mit nicht mehr ganz so eindringlichem Bass. Der erfahrene Juan Diego Florez ist da darstellerisch schon ein anderes Kaliber und gibt den Pollione sehr glaubhaft als impulsiven flatterhaften Latin Lover. Warum der einstige unangefochtene Rossini-Weltmeister und – Olympiasieger sich jedoch nunmehr (nach dem enttäuschenden Werther) auch an diesem Repertoire vergreift, ist schleierhaft. Der häufigste Satz in den schlechten Kritiken lautete: Florez ist kein Pollione. (Selbst der unbekannte Hiroki Amako in der Eingangs-Partie des Flavio übertrifft ihn stimmlich bei weitem.) Aber das hätten wir ihm doch alle schon vorher sagen können…und hätte ihm doch jemand Wohlmeinender doch auch schon vorher sagen m ü s s e n (wenn er es schon selbst nicht merkt). Für uns jahrzehntelange Florez-Verehrer, die sogar schon seine Bühnen-„Geburt“ in Pesaro erlebt haben, ist es jedenfalls s e h r schmerzhaft anhören zu müssen, wie unser Idol zum ersten Mal in unserem Leben in der Staatsoper ausgebuht wurde….
Das positivste an dieser Norma war jedenfalls das Dirigat von Antonino Folgliano, das im Gegensatz zum Premieren-Dirigat von Michele Mariotti um Vieles energetischer und straffer war.
.
Nach einhelligem Urteil der österreichischen, aber auch der internationalen Kritik, war das Theater an der Wien der eindeutige Sieger im Wiener Norma-Derby. Was, vor allem in gesanglicher Hinsicht, auch absolut berechtigt ist. Wobei der Treppenwitz der Geschichte ist, dass die beiden Protagonisten – Freddie de Tommaso und Asmik Grigorian – eigentlich Staatsopern-„Kreaturen“ sind (sie haben gemeinsam die Eröffnungspremiere der Direktion Roscic „Madama Butterfly“ gesungen).

Bellinis „Norma“ im Theater an der Wien/Szene/Foto Monika Rittershaus
Als man hörte, dass Asmik Grigorian die Norma singen würde und noch dazu in einem Interview erklärte, die Rolle „veristisch“ anlegen zu wollen, war man doch sehr skeptisch . Aber Asmik kam. sah, sang und spielte vor allem alle über den Haufen. Ihr Gesicht drückt in einer Sekunde mehr widerstrebende Gefühle aus als Federica Lombardis Körper an einem ganzen Abend. Eine vom Wiener Publikum heftigst bejubelte Glanzleistung an Beseeltheit, Intensität und Leidenschaft.
Auch Freddie de Tommaso ist nach seinem nicht ganz überzeugendem Pinkerton-Debut sowohl stimmlich als auch darstellerisch sehr gereift. Tareq Nazmi enttäuscht als Oroveso. Dazu kamen Gustavo Quaresma und Viktoria Leshkevich in den kleineren Partien des Flavio und der Clotilde.
Und Aigul Akhmetshina (die gerade ihre erste CD herausgebracht hat, ist eine echte Wucht und eine echte Entdeckung, von der man in Hinkunft sehr gerne sehr viel mehr hören möchte.
Bleibt die Inszenierung, verantwortet von Vasily Barkhatov,,dem Ex-Mann der Grigorian.
Er bewies (nach seinem Weinbergschen „Idioten“) ein weiteres Mal, dass Russisches Regietheater um nichts weniger hässlich und scheuklappenmässig ideologisch sein muss als sein Deutsches Pendant. Im Gegenteil.
Hier siedelt er das Geschehen in einer Art religiöser Devotionalienfabrik an, die nach dem (noch vor der Ouverture erfolgten) Einmarsch der Phösen dann (nach der Ouvertüre) Diktatorenbüsten herstellen muss. Gut und schön. Bzw. schlecht und hässlich. Wenn auch, das muss man fairerweise zugestehen, sehr gut gemacht, vor allem was die Personenregie und die Führung des Chors betrifft. Das Problem ist nur, dass sich dann – wie eigentlich immer bei diesem modischen Kontext-Swapping – die ganze Geschichte nicht mehr ausgeht, Und nicht nur, weil die doch so mächtigen und opernmässig einzigartigen poetischen Symbole wie Mond, Sichel, Mistel, Wald etc, keinerlei Bedeutung mehr haben, sondern vor allem auch, weil die ganze Fallhöhe des tödlich endenden Dramas – ohne jungfräuliche Priesterinnen einer Mondgöttin – dann nicht mehr gegeben ist. Denn was soll an zwei Kindern einer Vorarbeiterin in einer sowjetischen Fabrik so skandalös sein, dass es zwangsläufig mit dem Scheiterhaufen geahndet werden muss?

Bellinis „Norma“ im Theater an der Wien/Szene/Foto Monika Rittershaus
Die Produktion übersiedelt am 13.April 2025 an die Staatsoper Unter den Linden nach Berlin. Bin gespannt, ob sich dort das Konzept – mit einem ganz anderen Cast – noch ausgehen wird.
Insgesamt überfällt einem nach dieser intensiven Normaaufführungs-Vergleichsforschung auf alle Fälle ein seltsamer Appetit, sogar Heisshunger auf Hinkelsteine…Vielleicht braucht Wien ja noch eine vierte Norma… Robert Quitta, Wien
.
.
Barockoper konzertant Unter den Linden. Eine veritable Rarität präsentierte die Berliner Staatsoper mit der konzertanten Aufführung von Domènech Terradellas´ Merope. Die Opera seria des 1711 in Barcelona geborenen und 1751 in Rom gestorbenen Komponisten auf das Libretto von Apostolo Zeno wurde 1743 in Rom uraufgeführt. Der Text des Venezianers, der als Vorläufer des berühmten Metastasio gilt, wurde fast fünfzigmal vertont, so von Albinoni, Vivaldi, Broschi und Traetta. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen Merope, Witwe des im Auftrag von Polifonte ermordeten Königs Cresfonte, und ihr Sohn Epitide, der ins Exil flüchten konnte und nun den Mord an seinem Vater rächen will, was zu Verwicklungen und Intrigen führt, am Ende aber glücklich ausgeht.

Domènec Terradellas (1713 – 1751)/Wikipedia
Die konzertante Aufführung am 25. 2. 2025 erfolgte im Rahmen einer Tournee-Produktion. Stationen vor Berlin waren das Teatro Real in Madrid und das Gran Teatre del Liceu in Barcelona. Von Berlin geht das Ensemble an das Theater an der Wien – insgesamt also vier konzertante Aufführungen, was angesichts des exzellenten Niveaus der Interpretation nur allzu verständlich ist.
Die Musik, welche den stile galante vorwegnimmt, erfordert Sänger von höchster Kunstfertigkeit. Die Da capo-Arien sind extrem virtuos komponiert und stellen an die Interpreten allergrößte Anforderungen hinsichtlich ihrer stimmlichen Kunst, der Phantasie für die Variationen und Verzierungen sowie der ausdrucksmäßigen Gestaltung ihrer Partien.
Mit Emöke Barath war die Titelheldin prominent besetzt. Bei ihrer furiosen Auftrittsarie mussten in der exponierten Höhe noch grelle Momente hingenommen werden, doch schon hier war der expressive Gestaltungswille deutlich vernehmbar. Ausgewogener klang die Stimme in der wiegenden, von Flöten lieblich umspielten Arie „Ein sanfter Hauch“, in der die Königin von süßer Rache singt – mit vielen Ornamenten und langen legato-Bögen. Zunehmend sieht sie sich Emotionen verschiedenster Art ausgesetzt, was auch zu forcierten Tönen führte, aber stets beeindruckend war der schonungslose Einsatz für eine spannende und expressive Gestaltung. In großem Wettstreit mit der prima donna agierte der primo uomo des Abends in der Partie des Epitide. Die italienische Sopranistin Francesca Pia Vitale stand in der Publikumsgunst ganz oben, und ihr leuchtender Sopran mit schöner Fülle und dramatischem Potential darf durchaus als Entdeckung gelten. Epitide fällt die erste Da capo-Arie des Werkes zu, in der er beschließt, einen riesigen Eber zu töten. Mit geradezu wildem Aplomb stürzte sich die Sängerin in diese Nummer, was auch hier zu einigen schrillen Tönen in der Extremhöhe führte. Aber der Hosenrolle ist auch eine der schönsten Arien zugeordnet – das sanft wiegende „L`augelin che in lacci stretto“ mit zarten Flötentönen, die ein Vögelchen imitieren. Der Sopran konkurrierte hier im Dialog mit der Föte, brillierte mit Koloraturen und Trillern sowie einer kunstvollen Kadenz. Der dritte Sopran der Besetzung, Sunhae Im als Prinzessin Argia, die Epitide versprochen wird, war leider ihr Schwachpunkt, denn das stimmliche Spektrum der Koreanerin bewegte sich zwischen neckisch und keifend.

Domènec Terradellas in einer Karikatur von Pier Leone Ghezzi 1743/Wikipdia
Fulminant war der Auftritt von Valerio Contaldo als Polifonte. Der baritonal timbrierte Tenor von heroischem Zuschnitt formulierte seine Arien zwischen Angst, Furcht und Gewalt mit aufgewühlter, höchst expressiver Stimmgebung und vehementem Einsatz. Dagegen blieb der zweite Tenor, Thomas Hobbs als Anassandro, blass mit einer weichen, stilistisch mehr dem Oratorium verpflichteten Stimme. Ein ungewöhnlich reizvolles Organ ließ Margherita Maria Sala als Botschafter Licisco hören – ein heute sehr seltener echter Kontra-Alt mit satter Fülle und gebührender Flexibilität. Das vokale Ereignis des Abends für mich war der französische Countertenor Paul-Antoine Bénos-Dijan in der Partie des Stadtrat-Anführers Trasimede. Einen Vertreter dieser Stimmgattung mit derartig resonantem Klang, raumfüllendem Volumen und betörender stimmlicher Schönheit habe ich seit Jahren nicht gehört. Dazu kamen viele Farben, raffiniert phrasierte Details und emotional berührende Nuancen.
Der italienische Dirigent Francesco Corti am Pult der Akademie für Alte Musik Berlin setzte schon mit der wirbelnden Sinfonia ein Achtungszeichen, sorgte mit pompösen Märschen, furiosen dramatischen Szenen und schmerzlichen lyrischen Passagen immer wieder für beglückende musikalische Momente. Das Publikum dankte den Interpreten mit euphorischem Beifall. Bernd Hoppe
.
.
De kölsche Fledermaus als Karnevalsvergnügen 2025. Alljährlich gibt es in Köln zum Karneval ein Divertissementchen, veranstaltet von der Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg des Männer-Gesang-Vereins der Stadt, das stets ein Höhepunkt im Karnevalsprogramm und im Nu ausverkauft ist. In diesem Jahr ehrte man Johann Strauss anlässlich seines 200. Geburtstages mit der unsterblichen Fledermaus. Gemäß der Tradition ist jede Aufführung, liebevoll „et Zillche (Cäcilia)“ genannt, auf Kölsch, was den neuen Titel De kölsche Fledermaus erklärt, und werden alle Rollen von Männern dargestellt. Thomas Guthoff hatte die Operette mit kölschen Schlagern, Karnevalsliedern, Filmmusik und bekannten Opernmelodien (aus dem Freischütz, Nabucco und Fidelio) gemixt – eine stimmige Melange, die von den Bergischen Symphonikern und den Westwood Slickers unter Bernhard Steiner mit Esprit und Tempo serviert wurde.

Divertissementchen 2025 – Szenenfoto Akt 4.1 © Stefanie Althoff
Lajos Wenzel inszenierte das Divertissementchen mit großer Opulenz, viel Witz und auch aktuellen politischen Anspielungen, welche das Publikum spontan honorierte. Tom Grasshof erdachte für das Spiel in fünf Akten eine atmosphärische Bühne im Stil der 1920er Jahre mit Nachtclub, Interieur und Gefängnis. Ebenso trugen Judith Peters’ Kostüme in ihrer Pracht und Eleganz viel zur überwältigenden Gesamtwirkung der Aufführung bei. Und nicht zuletzt waren es 13 Tänzer, die in der Choreografie von Jens Hermes und Katrin Bachmann für hinreißende Momente sorgten, ob als Sylphiden in weißen Tutus mit Blütenranken, als Charleston-Girls, Charlie-Chaplin-Doubles, Moulin-Rouge-Tänzerinnen mit Federputz oder Haremsdamen – jeder Auftritt war so originell wie köstlich.

Divertissementchen 2025 – „Zilchen en Jefahr“ © Stefanie Althoff
Die Besonderheit der Kölschen Fledermaus liegt auch darin, dass hier die in der klassischen Version nicht zu sehende Vorgeschichte gezeigt wird, nämlich die alkohol-geschwängerte Nacht von Eisenstein und Dr. Falke mit dem fatalen Erwachen des letzteren am nächsten Morgen als verkleidete Fledermaus auf dem Marktplatz der Stadt mit dem peinlichen Spott der Bürger. In der Kölner Version der Operette werden der Notar zu Mätes I., Prinz Karneval (Rainer Wittig), und Eisenstein zu Mätes’ Düsseldorfer Jugendfreund Anton Adler (Jürgen Nimptsch). Nach dem öffentlichen Skandal verliert Mätes sein Prinzenamt und seine Verlobte Marie (Markus Becher), worauf er sich an Anton in der aus der Originalfassung bekannten Weise rächt. Neu in Köln ist der doppelte Frosch mit Amalia (Wolfgang Semrau) und ihrer Schwester Emma (Simon Wendring). Beide Interpreten, die mit „Nä, dat künne mer nit jot“ auch ein Duett singen, werden für ihre hinreißenden Auftritte vom Publikum besonders gefeiert. Jan Faßbender im roten Frack als Olaf, Erbe eines Kölner Schokoladenfabrikanten, darf Orlofskys berühmtes Couplet singen (hier: „Dat wor ne Filou“) und Dirk Pütz als Antons Gattin Rosa ersetzt Rosalindes Csárdás mit einer witzigen Nummer („Us dem fäne Ejypte“) als maskierte ägyptische Prinzessin mit Krokodil. Auch in Köln gibt es ein Champagner-Finale, freilich in spezieller Form mit „Dä Nubbel es schold!“, womit jene Strohpuppe gemeint ist, die in der letzten Karnevalsnacht verbrannt wird. Schon während der Vorstellung hatte sich das Publikum mitreißen lassen und jeden Titel im Takt mitgeklatscht. Am Ende gab es anhaltenden Jubel für diesen vergnüglichen Abend, der gar keine kleine Unterhaltung war, sondern mit seinem professionellen Niveau den Titel Divertissement durchaus verdient hätte. Bernd Hoppe
.
.
In Verona Falstaff… aber der von Antonio Salieri. Das Teatro Filarmonico feiert den fünfzigsten Jahrestag seiner Wiedereröffnung mit Falstaff des Veronesers Antonio Salieri. Die Opernsaison 2025 beginnt im Teatro Filarmonico von Verona mit einer seltenen Oper, Falstaff von Antonio Salieri, auf ein Libretto von Carlo Prospero Defranceschi nach dem Stück The merry Wives of Windsor von William Shakespeare.
Die Oper wurde am 3. Januar 1799 in Wien im Kärntnertortheater uraufgeführt und anschließend im Burgtheater, in Dresden und in Berlin gespielt. In Verona wurde sie 1975 zur Wiedereröffnung des Teatro Filarmonico aufgeführt und kehrt nun zur 50-jährigen Feier des Theaters zurück.
Salieris Oper ist ein ehrliches und angenehmes musikalisches Produkt seiner Zeit, das vielleicht mehr wegen der Historisierung der Epoche – Mozart war damals seit acht Jahre tot – als wegen des musikalischen Ergebnisses selbst interessant ist. Defranceschi reduziert Shakespeares Stück drastisch, lässt die Nebenhandlung weg und konzentriert sich auf die Streiche der lustigen Weiber gegen den dicken Falstaff. Das Stück beginnt mit einer Ensembleszene, einer Party im Haus von Master Slender (d.h. Master Page bei Shakespeare), bei der der prahlerische Falstaff Mrs. Slender und Mrs. Ford aufsucht und folgt. Defranceschi fasst in dieser Szene die gesamte Vorgeschichte zusammen und folgt dann im Wesentlichen linear dem Ablauf der Shakespeare’schen Ereignisse. So gibt es den Vorfall mit dem Wäschekorb, die Schläge des als alte Frau verkleideten Falstaff und das Finale bei der Eiche von Herne mit der Feenszene.
Musikalisch kann man alle Einflüsse der damaligen Zeit hören,

Salieris „Falstaff“ in Verona/Szene/Foto EnneviFoto
die Antonio Salieri mit großer Professionalität und Erfahrung verbindet, ohne jedoch besondere Höhen der Originalität zu erreichen. Nichts was mit den großen Meistern zu tun hätte, sondern ein ehrliches und gediegenes Handwerk, mit hier und da ein paar angenehmen Seiten. Wenn man die Oper von Salieri zuhört, kommt einem in den Sinn, was Piero Melograni in seinem Buch „Wam“ über die Rezeption von Mozarts außergewöhnlicher Musik schreibt: wie neu und besonders sie vielleicht für die Ohren der Zeitgenossen klang, die an die klassischen und beruhigenden Lösungen des Hofkapellmeisters Salieri gewöhnt waren.
Wir haben also einen Diener, Bardolfo, Bass, dessen Rezitative zuweilen an Leporello erinnern, ohne jedoch jemals dessen Originalität oder gar dessen szenischen und dramatischen Schwung zu besitzen. Ein Falstaff, der die Merkmale des komischen Basses auf den Punkt bringt, mit einer fast baritonalen Gesangslinie und ausgedehnten Rezitativen, die eindeutig eher an einen Sänger-Schauspieler à la Schikaneder als an einen Sänger tout court denken lassen. Dann haben wir einen Ford, Tenor, der einige stilistische Merkmale der „Opera Seria“ nachzeichnet, mit Arien, die manchmal dramatisch sind, aber immer mit einem klassischen Ansatz, der uns zu Akzenten des Metastasio zurückführt. Dasselbe gilt für die beiden Frauen, die wie eine dumpfe Version von Donn’Anna und Donna Elvira klingen, aber im Stil von Carl Heinrich Graun oder anderen Epigonen der Hofoper des aufgeklärten Absolutismus vertont sind. Dann kehrt Mozart mit dem konzertanten Klarinettensolo in der Ford Arie „Or gli affannosi palpiti“ zurück, wo man La Clemenza di Tito zu hören meint. Es gibt auch ein Zugeständnis an die Farce, mit der halb deutschen/halb italienischen Arie von Frau Slender, die als „Jungfer“ angesprochen wird und zusammen mit Falstaff verschiedene Aussprachefehler zwischen Italienisch und Deutsch macht, vermutlich zur Belustigung des hauptsächlich deutschsprachigen Wiener Publikums.
Hier liegt wohl der Schlüssel zum Verständnis dessen, was diese lustige Oper zur Zeit ihrer Uraufführung gewesen sein könnte: Wahrscheinlich ein Singspiel in italienischer Sprache, die Zauberflöte war nicht umsonst einige Jahre zuvor vorbeigegangen, wo Farce und Schauspiel den gleichen Stellenwert hatten wie die Musik. Davon zeugt, neben diesem Hauch von sprachlichem Pasticcio, auch die außergewöhnliche Länge der Rezitative, die den Sängern, oder bessere die „Comici“ wie Goldoni gesagt hätte, Raum geben musste eine offene und freimütige Rezitation ähnlich der „Commedia dell’Arte“ voranzutreiben.
In diesem Sinne geht die Inszenierung von Paolo Valerio in die entgegengesetzte Richtung. Der Regisseur, der sich auch um die Kostüme kümmert und für Bühnenbild und Projektionen von Ezio Antonelli unterstützt wird, wählt eine klassische und historisierende Darstellung. Er verlegt die Handlung in das Venedig des 18. Jahrhunderts, indem er sie zwischen zwei großen eckigen Kulissen ansiedelt, auf die Bilder von Kanälen und venezianischen Palästen projiziert werden. Diese Kulissen drehen sich und schaffen so die verschiedenen Umgebungen, in denen sich die Geschichte entfaltet. Der Regisseur hält es für notwendig, die Ouvertüre durch ein Ballett von Daniela Schiavone zu beleben, das ohne allzu viel Originalität eine Reihe von Stilelementen des 18. Jahrhunderts wiedergibt, vom Bankett über galoppierende Reiter bis hin zu Pantomimen, die sich über Falstaffs Fettleibigkeit lustig machen. Die Fortsetzung ist dann im Wesentlichen konventionell, auch wenn die Szenenwechsel, die das Verdienst haben schnell und schmerzlos zu sein, gut gelungen sind. Der Chor geht ein und aus und ist meist frontal, während das Finale mit der Fee in der Mitte und dem Chor der Falstaff umkreist, absolut ideenlos ist. Ein paar Schaukeln, die von oben herunterkommen, eine venezianische Brücke und ein Himmelbett bringen Abwechslung in eine insgesamt rein ästhetische, beruhigende und konventionelle Inszenierung.
Francesco Ommassini, der das Orchester der Stiftung Arena dirigiert, schlägt sich durch die Partitur präzis und mathematisch, glänzt aber nicht durch Lebendigkeit und Abwechslung in einem Stück, was im Sinne Salieris immer noch eine komische Oper sein sollte.
Wirkungsvoll ist im Großen und Ganzen die Gesangsgruppe, der es hier und da sogar gelingt, den Publikum zum Lachen zu bringen, obwohl wir deutlich von der damaligen Aufführungspraxis entfernt sind, bei der sehr wahrscheinlich die komische Verve der Darstellung ebenso zählte wie der Gesang.
Der Trentiner Bariton Giulio Mastrototaro verkörperte den dicken Ritter wirkungsvoll, mit feiner, klarer Stimme und ausreichender Bühnenpräsenz. Eine deutliche Diktion und präzise Phrasierung umrahmten seine insgesamt gute Leistung.
Gilda Fiume und Laura Verrecchia erweckten Mrs. Ford bzw. Mrs. Slender mit guten stimmlichen Leistungen und gutem szenischen Willen zum Leben. Kommen wir zu den Gatten: Marco Ciaponi als Mastro Ford ist stets vor Eifersucht getrieben und hatte einige amüsante Bühnenauftritte, auch wenn seine Bühnenpräsenz noch verbesserungswürdig ist. Andererseits ist er stimmlich in Hochform, mit einer klaren, kernigen Stimme, die die Schwierigkeiten der Rolle souverän meistert. Michele Patti fühlt sich in seinen Kleidern aus dem 18. Jahrhundert pudelwohl und flattert amüsant über die Bühne. Seine Stimme mit dem schönen Timbre und dem guten Volumen ist für die Rolle gut geeignet. Eleonora Bellocci ist ein luxuriöses Dienstmädchen, immer präzise und effektiv. Die Besetzung wird durch Romano Dal Zovos tonvollen, aber hölzernen Bardolf vervollständigt. Im Finale guter Publikumserfolg für diese seltene Oper. Raffaello Malesci (19. Januar 2025)
.
.
Offenbach an der Komischen Oper Berlin: Exotisches zum 4. Advent. Großer Beliebtheit beim Publikum der Komischen Oper erfreut sich die alljährliche Aufführung einer Operetten-Rarität vor Weihnachten – stets gekürzt und in semikonzertanter Form. In diesem Jahr gab es im Schillertheater Jaques Offenbachs Opéra comique Robinson Crusoé, die 1867 an der Pariser Opéra-Comique uraufgeführt wurde. Dauerte der Abend damals vier Stunden, hatte Felix Seiler in seiner szenischen Einrichtung das Stück auf 90 Minuten gekürzt und mit Andreja Schneider eine Erzählerin eingeführt, die als Offenbachs angeblich verschollene Schwester Jacqueline mit Witz und Ironie durch die Handlung führte. Mit Stirnglatze und Backenbart glich sie dem Komponisten aufs Haar – ein Meisterstück der Maske! Und da Katrin Kath-Bösel das Ensemble in hinreißende Kostüme im Biedermeier-Stil gewandet hatte, begann der Abend verheißungsvoll, zumal Adrien Perruchon mit dem Orchester der Komischen Oper Berlin die Ouvertüre mit Schmiss und schwelgerischem Melos ausbreitete. Dass er dennoch nicht so zündete wie die Kálmán- oder Abraham-Titel in den Vorjahren, lag wohl an der deutschen Textfassung von Jean Abel, welche sich recht bieder gab, und an der deutschen Sprache überhaupt. Esprit, Charme und Parfum transportieren sich über die französische Originalsprache einfach leichter.
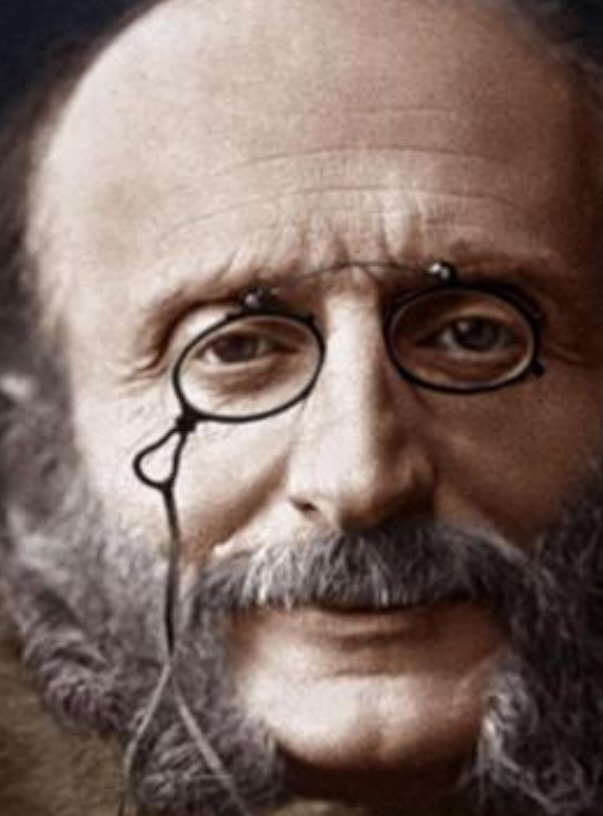
Jacques Offenbach/ Foto Nadar/ Wikipedia
Auch die Sänger waren nicht erste Wahl. Agustín Gómez als Titelheld ließ zwar zu Beginn aus dem Off beeindruckende Spitzentöne hören, doch schon beim ersten Auftritt an der Rampe imponierte der Tenor mit unpersönlichem Timbre weniger, was sich bis zum Schluss nicht änderte. Das Bravourstück der Komposition fällt Robinsons Cousine Edwige zu – es ist ein virtuoser Walzer „Führt mich zu ihm, den ich lieb` und begehre“, vor Jahren von Joan Sutherland in einer Modellinterpretation auf Platte verewigt. Miriam Kutrowatz schlug sich mit ihrem hübschen Sopran achtbar bei dieser Nummer, servierte delikate Triller und glitzernde staccati in der Kadenz, musste aber mit greller Höhe dem Anspruch des Stückes Tribut zollen. Zwei gestandene Interpreten des Ensembles, Tom Erik Lie und Karolina Gumos, blieben unauffällig als Elternpaar Sir William und Deborah, blasser noch Sarah Defrise als Edwiges Dienstmädchen Suzanne, deren Sopran sich mehrfach in den Sprechgesang flüchtete, und Andrew Dickinson als ihr Verlobter Toby. Dagegen bewies Christoph Späth mit markantem Charaktertenor als Robinsons ehemaliger Nachbar Jim Cocks, wie man auch eine kleine Rolle profilieren kann. Die Partie des Freitag, Robinsons Gefährten auf der Insel, komponierte Offenbach für einen Mezzosopran. Virginie Verrez sang sie mit kultivierter, ebenmäßiger Stimme, der es für die Rolle en travestie nur an androgynem Klang fehlte.
Im Hintergrund waren vor einer wechselnd beleuchteten Wand (Johannes Scherfling) die Chorsolisten der Komischen Oper platziert. Einstudiert von David Cavelius, konnten sie vor allem im 2. Finale und beim Trinklied der Piraten am Ende mit schmetterndem Gesang imponieren. Das Orchester, das in der bekannten Sea Symphony zu Beginn des 2. Aktes mit sphärischen Klängen à la Lohengrin bezaubert hatte, setzte am Ende mit fetzigen Rhythmen noch einen effektvollen Schlusspunkt, der das Publikum zu herzlichem Beifall animierte (22. 12. ‚2024). Bernd Hoppe
.
.
Giordanos Fedora am Grand Théâtre de Genève: Der Verismo ist sozusagen das Schmuddelkind unter den Opernstilrichtungen. Keiner will etwas mit ihm zu tun haben (es sei denn heimlich,als „guilty pleasure“). Selbst italienische Kritikerkollegen (die es eigentlich besser wissen müssten) schütteln sich vor Abscheu bei der bloßen Erwähnung von La Gioconda oder Fedora, auch wenn sie gerade aus einer äußerst gelungenen Premiere dieser Oper an der Mailänder Scala kommen.
Deutsche Kritiker sprechen wiederum gerne von „Schmachtfetzen“, „Schmalz“ und „Schmonzetten“, wenn sie den Verismus verunglimpfen wollen. Wie sie solche gehässigen Vorurteile aufrecht erhalten können, selbst wenn sie die jüngste Produktion von Fedora am Grand Théâtre de Genève gehört haben, bleibt mir ein Rätsel.
Denn Antonino Fogliano, Experte für das italienische Fach, beweist allen Verismo-Muffeln (wie ich selbst bis vor kurzem auch einer war) mit seinem einfühlsamen und kenntnisreichen Dirigat, was für eine intelligente, filigrane und ungewöhnliche Partitur Umberto Giordano da geschrieben hat. Von wegen Kitsch und Tränen und Schmachtfetzen: da ist jeder Puccini kitschgetränkter, pathetischer, pompöser und schmachtfetziger. Fedora hingegen ist leise, oft nahezu kammermusikalisch orchestriert und wartet auch mit einigen einzigartigen musikdramaturgischen Erfindungen auf: wie zum Beispiel der unglaublichen Szene im 2.Akt, in der das große Duett der beiden Protagonisten parallel zu den pianistischen Darbietungen des „Chopin-Nachfolgers“ im Salon daneben gesungen wird. Großartig !
Noch großartiger ist nur noch das überirdisch schöne Intermezzo, das (meiner Ansicht nach) schönste Intermezzo der Opernliteratur, noch schöner als das landauf landab (und wirklich schmachtfetzige) Intermezzo aus der Cavalleria Rusticana…
Wenn die musikalischen Vorurteile aufgebraucht sind, zeigt man gerne mit dem Finger auf das Libretto. Was Schwachsinn ist, denn im Gegensatz etwa zu Il Trovatore ist die Storyline (trotz aller notwendiger Verwicklungen) hier geradezu gradlinig. Und außerdem übersieht man gerne, dass der Autor der Vorlage, des Theaterstücks Fédora, niemand Geringerer als Victorien Sardou
war, der ja immerhin auch die Vorlage zum globalen Operevergreenhit Tosca geliefert. Nun gut, ich gestehe, der Giftselbstmord am Ende überzeugt mich auch nicht wirklich – aber ist Toscas berühmter Sprung von der Engelsburg tatsächlich um so viel mehr realistischer und glaubwürdiger ?
Wenn alle Vorurteilsstricke reissen, wird dann auch noch irgendein Faschismus-Vorwurf ausgepackt. Was nun überhaupt krank ist: denn Fedora wurde 1898 !!! uraufgeführt…(da war Mussolini gerade 15 Jahre alt).
Die männliche Hauptrolle des Grafen Loris Ipanov hob bei der Uraufführung im Teatro Lirico in Mailand übrigens Enrico Caruso aus der Taufe.
In Genf übernahm Roberto Alagna diese Partie. Obwohl gerade 60 geworden, ist er noch immer das Bild von einem Mann, auch wenn seine Haare bereits ergraut sind. Die Haare wären das geringste Problem, wenn nicht seine Stimme altersgerecht auch schon ein wenig ergraut wäre.
Hinzu kommt, dass Alagna, der ja noch nie ein großer Singschauspieler war, auch hier als Ausdruck der Verzweiflung wie andere Tenöre vor ihm (zb. Chris Merritt oder Plácido Domingo etc.etc,) nur die eine große, ein wenig lächerliche Geste zur Verfügung hat: pathetisch auf einen Sessel, auf einem Bett oder wo auch immer in sich zusammensInken, den Kopf zwischen den Armen verborgen …
Aleksandra Kurzak wiederum, vom lyrischen ins dramatischere Fach gewechselt, steht in der Blüte ihrer stimmlichen Fähigkeiten, klingt gelegentlich sogar wir ihre Kollegin Anna N., und stellt, auch schauspielerisch ambitioniert, durchaus eine beeindruckende Fedora dar. Pech ist nur, dass sie, obwohl noch nicht zerbotoxt, offenbar über keinerlei Mimik verfügt, was den Gesamteindruck ihrer Leistung leider sehr beeinträchtigt.

Giordanos „Fedora“ in Genf: Roberto Alagna und Alexandra Kurzak. Foto: Carole Parodi
Das Erstaunlichste aber ist, dass zwischen Kurzak und Alagna, die doch, wie man hört im „Real Life“ ein glückliches Ehepaar sind, in dieser so extremen mörderischen Hass-Liebe-Beziehung so überhaupt keine Leidenschaft zu spüren ist…
In der dritten ein wenig größeren Rolle glänzt Yulia Zasimova als Comtesse Olga Sukarev
Aber auch alle, in diesem Stück fast zur Statisterie degradierten, Nebenrollen sind ganz hervorragend und rollendeckend besetzt: Simone Del Savio (De Siriex), Mark Kurmanbayev (Gretch), Sebastià Peris (Loreck), Vladimir Kazakov (Cirillo) etc.
Regie führte Arnaud Bernard, der aus unerfindlichsten Gründen derzeit groß im Geschäft ist. In St.Margarethen hat er vorvzwie Jahren die ansonsten unkaputtbare Carmen in den Sand des Steinbruchs gesetzt, indem er als Rahmenhandlung überflüssige Filmaufnahmen dazu erfand. Dasselbe Gadget wendet er auch diesmal an, mit der geringfügigen Variation, dass es sich in Fedora um Videoüberwachungsaufnahmen des russischen Geheimdiensts handelt, um ein „Kompromat“( (kompromittierendes, belastendes Dossier) gegen den Grafen Loris Ipanov zu erstellen. Geht sich vorne und hinten und oben und unten und links und rechts nicht aus, und lenkt nur ab. Das Schlimmste daran aber ist, dass dieser banale Gag überdeckt, dass der Rest der Inszenierung aus altmodischen althergebrachten Schreit – und Steh – und An-der Rampe-Sing- Theater besteht.
Und das dazu noch in den einheitlich beleuchteten und atmosphärelosen Shabby-Chic-Bühnenbildern von Johannes Leiacker.
Es verwundert fast ein wenig, das (der demnächst nach Berlin wechselnde Intendant) Aviel Cahn, dem sowohl dieses Repertoire als auch dieser Regiestil ansonsten fremd sind, diese Produktion auf die Beine gestellt hat. Er begründet dies als Hommage an die in Genf historisch so bedeutende russische Exil-Community. Aber aus welchen ehrenhaften Gründen auch immer: diese Aufführung von Fedora ist sein Verdienst – und auch sein verdienter Erfolg. Nachahmung erwünscht: Ehrenrettet Fedora !Ehrenrettet Umberto Giordano !! Ehrenrettet den Verismo !!! Robert Quitta
.
.
Bellini an der Oper Leipzig: Norma als Oberschwester. Die Losung „FUORI I FASCISTI“ in blutroter Schrift an einer Hauswand verweist unmissverständlich auf die Epoche, in welcher Regisseur Anthony Pilavachi und Ausstatter Markus Meyer Bellinis Norma bei ihrer Neuinszenierung an der Oper Leipzig angesiedelt haben – im Faschismus Italiens der 1920/30er Jahre. Auch die Kostüme – Mäntel, Hüte und Kleider – befolgen den Stil der Zeit.
Es ist die allererste Produktion der Tragedia lirica im Opernhaus der Stadt, und man muss dessen Leitung Respekt zollen für den Mut, sich an das Gipfelwerk des Belcanto, das an seine Interpreten immense Anforderungen stellt, gewagt zu haben.
Die Premiere am 1. 12. 2024 begann verstörend, denn Randall Jakobsh als Oberpriester Oroveso sang dessen Auftrittsszene „Ite sul colle“ mit abenteuerlicher Intonation und verquollener, rissiger Stimme. Zudem war hier die von Wagner für diese Partie nachkomponierte Arie „Norma il predisse, o Druidi“ zu hören -, mit fatalem Resultat, musste man die gravierenden stimmlichen Defizite des Sängers doch noch einmal ertragen. Die nächste Nummer mit „Meco all´altar di Venere“ fiel Dominick Chenes als Pollione zu, der den Dreieckskonflikt zwischen Norma, Adalgisa und ihm verantwortet. Auch er offenbarte Probleme, vor allem bei der engen, gefährdeten Höhe. Immerhin ließ er eine jugendliche Stimme mit emphatischem Ausdruck hören, ging die Cabaletta „Me protegge, me difende“ mit gebührendem Aplomb an und stabilisierte sich im Laufe der Aufführung mit ins Heldische verweisendem Duktus.

Bellinis „Norma“ an der Oper Leipzig/Szene/Foto Tom Schulze
Furchtlos stellte sich die italienische Sopranistin Roberta Mantegna den vokalen Herausforderungen der Titelheldin. Die Stimme ist passend dunkel getönt und dramatisch grundiert, was dem Auftrittsrezitativ der Priesterin, „Sediziose voci“, die gebührende Wirkung verschaffte. Die Kavatine „Casta Diva“ sang sie in schöner Linie und melancholischer Stimmung, das Da capo der Cabaletta variierte sie originell. Bei den Aufschwüngen in die höhere Lage waren allerdings metallisch grelle Töne zu vernehmen, die später bei dramatischen Ausbrüchen sogar ein schneidend scharfes Ausmaß annahmen.
Die Optik der Aufführung war bei Normas berühmter Nummer bestürzend, denn nach der Eingangsszene, die in einem Flüchtlingslager mit verwüstetem Fluchtgepäck angesiedelt ist, spielt das zweite Bild in einer Krypta, die zum Lazarett umfunktioniert worden war, wo Norma als Krankenschwester in weißer Schürze Verwundete pflegt. Wenigstens einen kleinen Hausaltar mit Kerzen, Blumen und Madonnenbild gibt es in diesem Raum – für die Priesterin der Platz zur Verrichtung ihrer Gebete. Ihre privaten Szenen siedelte Meyer in einem schmucklosen Zimmer mit schwarz/weißen Verstrebungen an. Ihre und Polliones Kinder sieht man hier in auffällig aggressivem Verhalten, da sie offenbar unter der Trennung von ihrem Vater leiden.
Grotesk ist der Auftritt Adalgisas in einem mondänen türkisfarbenen Kostüm und extravaganten Hut, womit sie in der Erscheinung höher gestellt wirkt als die Oberpriesterin. Die Dauerwellenfrisur verweigerte ihr zudem jegliche jugendliche Erscheinung und machte sie unweigerlich zu einer britischen Gouvernante. Es war erstaunlich, wie sich Kathrin Göring, langjähriges verdientes Ensemblemitglied des Hauses, über diese Hindernisse hinwegsetzte und die Figur glaubhaft verkörperte. Ihr Mezzo ist etwas zu reif für die Rolle der jungen Priesterin, aber technisch meisterte sie, bis auf wenige steife Töne in der exponierten Region, die Partie bewundernswert. So gestalteten sich die zwei großen Duette der beiden Damen zu den musikalischen Höhepunkten des Abends. Ergreifend am Ende Normas Abschied von ihren Kindern und dem Leben vor einer monumentalen Palastfassade mit Treppe und Säulen, dem Münchner Nationaltheater nachempfunden, aber auch von faschistoider Anmutung. Norma und Pollione töten sich selbst, bevor sie mit Benzin aus Kanistern übergossen und Fackeln entzündet werden. Die Besetzung komplettierten Michael Stier als Flavio und Gabriele Kupsyte als Adalgisa.
Stark eingeschränkt war der Aktionsradius des Chores der Oper Leipzig (Einstudierung: Thomas Eitler de Lint), da er zumeist vor der Wand mit der Losung platziert war und damit nur einen schmalen Steg an der Rampe zur Verfügung hatte. Als Gallier in blauen Uniformen mit Gewehren und römische Besatzer in Schwarzhemden mit Pistolen wurde stramm gestanden, die Hand auf dem Herzen, oder im Gleichschritt marschiert. Immerhin war der Gesang ohne Tadel, beim „Guerra!“-Chor, den Michael Röger in flackerndes Licht tauchte, auch mit gebotener Aggressivität. Das Gewandhausorchester musizierte unter Daniele Squeo sehr differenziert, fand zu wuchtigen dramatischen Akkorden und warmen Tönen bei den tiefen Streichern. Auffällig waren oftmals gedehnte Tempi und Verzögerungen im musikalischen Fluss, womit der Dirigent sicher einzelne Details hervorheben wollte. Das Publikum feierte Orchester, Chor und die Sänger, ließ es aber auch nicht an Missfallenskundgebungen für das Regie-Team fehlen. Bernd Hoppe
.
.
Sondheim an der Komischen Oper Berlin – Musical-Thriller mit Gruseleffekt. Vor genau zwanzig Jahren präsentierte die Komische Oper Stephen Sondheims Sweeney Todd und damit im Repertoire des Hauses ein neues Musical als Berliner Erstaufführung. Die Premiere trug den Stempel des Besonderen, weil die populäre Schauspielerin Dagmar Manzel erstmals in einem Opernhaus auftrat. In genau dieser Rolle, Mrs. Nellie Lovett, war sie nun wieder zu erleben, denn der frühere Hausherr Barrie Kosky war zurückgekehrt, um im Schillertheater eine Neuinszenierung des Werkes vorzustellen. Katrin Lea Tag hatte dafür die Ausstattung besorgt. Ein dekoratives Proszenium in der Manier eines viktorianischen Theaters und ein geraffter roter Samtvorhang stimmen auf eine malerische Optik ein, aber die Bühne ist eher von minimalistischem Zuschnitt mit hängenden Fototapeten, welche historische bis moderne Stadtlandschaften zeigen. Im Zentrum der Szene befindet sich die Imbissbude von Mrs. Lovett, in deren Obergeschoss Sweeney Todd seinen Friseursalon mit dem verhängnisvollen Stuhl eingerichtet hat. Nach Jahren der Verbannung, verfügt durch den Richter Turpin, war er nach London zurückgekehrt, um sich für das begangene Unrecht zu rächen. Wer auch immer auf dem Friseurstuhl Platz nimmt, endet nach einem Kehlkopfschnitt mittels einer Falltür und Rutsche im Keller, wo die erfindungsreiche Mrs. Lovett den Leichnam zu einer schmackhaften Fleischpastete verarbeitet, die ihrem Imbissunternehmen zu wachsendem Wohlstand verhilft. Jeder Mord wird akustisch von einem höllischen Aufschrei des ganzen Orchesters samt szenischem Blackout begleitet. Insgesamt aber ist Koskys Inszenierung verhalten, meidet schrille Effekte, verlässt sich ganz auf die Virtuosität seines Ensembles.

Stephen Sondheims „Sweeny Todd“ an der Komischen Oper Berlin/Szene/ Foto Jan Windszus Photography
Dieses wird dominiert von Dagmar Manzel, die nach ihrer ersten Verkörperung der Figur 2004 nun auch im originalen Englisch den Wortwitz, Hintersinn und beißende Scharfzüngigkeit der Rolle hinreißend herüber bringt. Darstellerisch ist sie im ersten Teil ein Urvieh, herrlich deftig und vulgär, immer wieder in ihr ordinäres Lachen verfallend und in Sekunden den Tonfall wechselnd. Nach dem mausgrauen Outfit zu Beginn zeigt sie sich nach der Pause wie verwandelt in strahlendem Blond und einem hübschen rosa Kleid, was ihre veränderte private Situation anzeigt. Es zeugt von ihrer Bravour, dass sie beide Facetten dieser Frau gleichermaßen überzeugend darzustellen vermag. Der geschliffene Dialog kompensiert die mittlerweile reduzierte gesangliche Leistung. Vokal ist ihr der englische Bariton Christopher Purves in der Titelrolle überlegen, auch szenisch überzeugt er als Charakter. Glänzend besetzt sind die Nebenrollen mit Alma Sadé als Sweeneys Tochter Johanna, Hubert Zapiór als ihrem Geliebten Anthony und Jens Larsen als Richter Turpin. Markante Episoden bieten Ivan Tursic als exaltierter Barbier Pirelli, dem ersten Opfer auf Sweeneys Stuhl, und Sigelit Feig als derbe Bettlerin. Herauszustellen ist der junge Tenor Tob Schimon als Tobias, der mit seiner feinen Stimme und sensiblen Darstellung den besonderen Beifall des Premierenpublikums am 17. November 2024 empfing. Er ist es auch, der am Ende begreift, dass die Pasteten unter mysteriösen Umständen entstehen, und Sweeney Todd richtet.
Wieder sind die Chorsolisten der Komischen Oper Berlin (Einstudierung: David Cavelius) in ihren Auftritten präsent und klangvoll im Gesang. Sie geben das kommentierende oder mit dem Publikum an der Rampe kommunizierende Volk. James Gaffigan bringt mit dem Orchester der Komischen Oper die Musik in ihrer Vielschichtigkeit zwischen Musical-Thriller und Black operetta zu zündender Wirkung. Bernd Hoppe
.
.
Gounods Roméo et Juliette an der Berliner Staatsoper: Trotzgöre mit blauem Haar. Juliette ist eine Unangepasste. Dafür spricht schon ihre Haarfarbe – ein verwaschenes Blau, das gewiss den Unmut ihrer Eltern erregt, Roméo aber eher anzieht. Auch die Kleidung der Capulet-Tochter mit Jeans und Hoodie ist eigenwillig und vor allem nicht standesgemäß. Aber Mariame Clément kümmert sich bei ihrer Neuinszenierung von Gounods Drame lyrique in der Staatsoper nicht um historische Fakten der Vorlage von Jules Barbier und Michel Carré nach Shakespeares Tragödie. Radikal versetzt sie das Stück in die Gegenwart und hat dabei die Unterstützung der Ausstatterin Julia Hansen. Diese stellt ein hässliches Wohnhaus auf die Bühne, wo zu Beginn Julias Geburtstag gefeiert wird. Ein Happy Birthday-Schriftband und Luftballons garnieren die Szene, dazu die Gäste in schäbigen Klamotten vom Wühltisch. Wieder einmal ist die triste Optik bestürzend, gipfelnd in einer maroden Basketball-Sporthalle, wo der aggressive Streit zwischen den Montagues und Capulets stattfindet, Juliettes Mädchenzimmer mit Postern an den Wänden und Nippes im Regal, wo die Liebenden ihre Hochzeitsnacht verbringen, und einem schäbigen Pathologie-Saal, wo Juliette im weißen Totenhemd auf dem Seziertisch liegt und von Helferinnen gewaschen wird.

Gounods „Roméo et Juliette“ an der Berliner Staatsoper/Balkonszene/Foto Monika Rittershaus
An der szenischen Ödnis ändern auch die von Sébastien Dupouey erdachten Videos nichts, welche das Geschehen überblenden – surreal als Kaleidoskop mit flatternden Schmetterlingen und einem Blütenteppich oder romantisch mit nächtlichen Naturstimmungen samt Sternenhimmel. Gänzlich unmotiviert sind Ulrik Gads Lichtwechsel in den einzelnen Räumen, völlig überflüssig Mathieu Guilhaumons bizarre Choreografie mit sechs Juliette-Doubles. Was die Personenführung betrifft, so sind die Einfälle der französischen Regisseurin eher bescheiden, denn statuarisches Singen an der Rampe dominiert.
Vor allem Elsa Dreisig versucht, sich davon zu befreien. Ihre Juliette ist lebhaft und agil, setzt sich auch stimmlich an die Spitze des Ensembles. Freilich fehlt ihrem Sopran die individuelle Farbe, das unverwechselbare Timbre. Aber er besitzt den gebührend jugendlichen Klang für die Rolle, ist klar, delikat und leuchtend. Die Koloraturen in „Je veux vivre“ perlen vollendet, nur die grellen Spitzentöne stören. Die zweite, sogenannte „Gift“-Arie („Dieu! quel frisson“) singt sie mit Emphase und auch in den Duetten mit Roméo ist sie stets präsent. Der größte Erfolg der Premiere am 10. November 2024 gebührte ihr, denn Amitai Pati als Roméo mit blond gefärbten Haarsträhnen blieb hinter den Erwartungen zurück. Seinem Tenor fehlen Poesie, lyrischer Zauber und Schmelz. Bis zur Pause gab es auch empfindliche vokale Einbußen, so die unschön forcierten Spitzennoten in der Arie „Ah! lève-toi, soleil!“, die der Sänger auch am Ende der Duette mit Juliette hören ließ. Zudem enttäuschte sein distanziertes Spiel, dem Leidenschaft und Zuwendung fehlten. In der Kampfszene überraschte er dagegen mit potenten Tönen. Bei den Nebenrollen überzeugte vor allem Nicolas Testé als Frère Laurent, der hier als Lehrer in einer Schulklasse mit Bankreihen und Wandtafel fungiert und seltsamerweise das junge Paar trauen kann. Aber stimmlich ragt er mit seinem markigem, voluminösem Bass, dem gelegentlich ein grimmiger Unterton eigen ist, heraus. Auch Manuel Winckhier vom Opernstudio des Hauses ließ als Le Duc autoritäre Töne hören. Dagegen blieb Arttu Kataja als Capulet mit verquollenem Bass deutlich zurück, während Mariana Prudenskaya die kleine Partie der Gertrude stimmlich und darstellerisch markant profilierte. Stéphano in Gestalt von Ema Nikolovska ist hier ein Wesen von androgyner Natur, singt das Chanson „Que fais-tu, blanche tourterelle“ mit üppigem Mezzo von strengem Vibrato. Unauffällig in Stimme und Spiel blieb Johan Krogius als Tybalt.
Der Staatsopernchor (Einstudierung: Dani Juris) fungiert im Prologue als Theaterzuschauer auf der Bühne, überzeugt gesanglich vor allem im trauernden Gesang nach Tybalts Tod „O jour de deuil!“. Stefano Montanari malt mit der Staatskapelle Berlin die Lyrismen der Komposition stimmungsvoll aus, dennoch hätte man sich gelegentlich mehr Duft und größeren Farbenreichtum gewünscht. Und mehrfach nahm der Dirigent auch nicht genügend Rücksicht auf die Sänger, die dadurch zur Mobilisierung aller Kräfte gezwungen wurden. Am Ende empfing auch er Unmutsbekundungen, freilich weit weniger als das Regieteam, während vor allem Elsa Dreisig gefeiert wurde. Bernd Hoppe
.
.
Annaberg-Buchholz: Deutsche Erstaufführung von Michael William Balfes Romantischer Oper Satanella. Wer sage da noch, England sei ein „Land ohne Musik“. Aus der von einem deutschen Musikwissenschaftler publizierten Feststellung sprach um die vorvorige Jahrhundertwende eine gehörige Portion Ressentiment, das wohl auch für das englischsprachige Irland gilt. Nach der bedeutenden Aufführung von Michael William Balfes romantischer Oper Satanella, die das Eduard von Winterstein Theater in Annaberg jetzt erstmals auf einer deutschen Bühne vorstellte, muss man sich im Gegenteil fragen, wo hat sich diese „englische“ Musik eines Iren, mit der sich Sänger wie Zuhörer auf Anhieb wohlfühlen, so lange versteckt. Nun, sie wurde durchaus gespielt (und mehrfach dokumentiert). Allerdings blieb ihr Einzugsgebiet begrenzt.

Balfes „Satanella“ in Annaberg/Szene/Foto Dirk Rückschloss
Und Balfe war nur die Spitze eines Eisbergs, zu dem mehrere Kollegen gehörten, die sich an Opern in der Landessprache versuchten. Natürlich wurden seit den Zeiten Händels die italienischen Komponisten bevorzugt, doch der einheimischen Produktion wurde durchaus eine Chance gegeben, wenngleich noch bei der Uraufführung der Satanella die Kritiker über die Sprechtexte die Nase rümpften. Der Ire Balfe, geboren 1808 in Dublin, aufgewachsen in der Festspielstadt Wexford, hatte das Handwerk von der Pieke auf gelernt. Zuerst als Geiger und Sänger, dann als Komponist. Bereits 1823 spielte an Londoner Bühnen Geige, 1825 debütierte er in Webers Freischütz als Sänger, Studiert hatte der Rossini-Protegé in Italien, wo er 1827 als Figaro in Il Barbiere di Siviglia auftrat, zwischen 1829 und 1833 ein Ballett und drei Opern zur Uraufführung brachte und eine Kantate für die junge Grisi schrieb. Er sang u.a. an der Mailänder Scala und an der Pariser Opéra neben der berühmten Maria Malibran sowie am Teatro La Fenice. Heirate um 1831 die österreichische Sängerin Lina Roser kehrte 1835 nach London zurück, wo er mit The Siege of Rochelle seinen Durchbruch als Komponist erlebte.
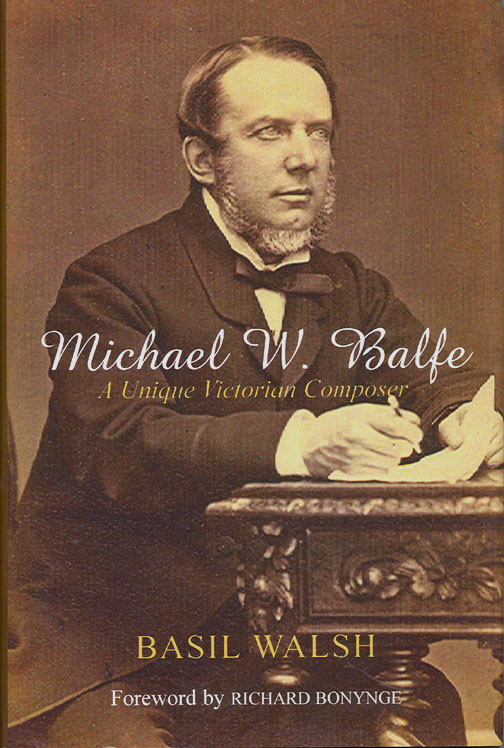
Unverzichtbar für Balfe-Fans – das umfassende Buch von Basil Walsh
Der Erfolg wurde mit dem auch auf dem Kontinent gespielten The Bohemian Girl übertroffen. Insgesamt schrieb Balfe rund 30 Opern zumeist in englischer, aber auch italienischer und französischer Sprache. Er starb 1870. Seine 23. Oper Satanella entstand im Auftrag der Sopranistin Louisa Pyne, die just ihre erste Opernsaison im für mehrere Winterspielzeiten angemieteten Covent Garden Theatre mit einem Werk von Balfe eröffnen wollte, nachdem sie in Rose of Castille Erfolge gefeiert hatte hatte. Das 1858 uraufgeführte Stück über den Weibsteufel Satanella ist großes romantisches sattes Theater, das zur Erbauung des puritanischen Publikums mit der Rettung des Helden Rupert und der Teufelin Satanella endet. Vorlage für die Librettisten Augustus Harris und Edmund Falconer bildete ein Roman von Jacques Carotte Le diable amoureux, der in den 1840er Jahren in Ballett-Adaptionen in Mailand und London über die Bühne gegangen war. Der Kampf des Helden mit den teuflischen Geistern oder Gegenspielern ist romantisches Gemeingut.
In Annaberg verkompliziert Christian von Götz die Geschichte nicht unwesentlich, befrachtet und überfrachtet sie bis zur Unkenntlichkeit. Herausgekommen ist ein Schauermärchen, das mit allen Bildern und Motiven der Romantik jongliert. Nicht mehr der Graf ist die Hauptfigur, sondern sein Gefolgsmann Carl, der ein schweres Trauma erlitt, als er seine Braut mit einer anderen Frau überraschte. Das ist der neue Rahmen.. Im Zustande gesteigerter Erregung, dem Wahnsinn nahe, vertraut sich der aufgelöste Carl einer Person an, die nun ihrerseits sich bald halbnackt wälzt und als Kirchenmann zum Gegenspieler der bösen Kräfte wird, bei der es sich eigentlich um den Piratenführer Braccacio handelt. Mit dem Grafen selbst hat sich Carl ein schwarzes Alter Ego geschaffen. Leicht unübersichtlich wird das dunkle Grusical, da Rupert, dessen Sänger in schwarzer Kleidung weitgehend versteckt bleibt, zusätzlich ein weibliches Ich in Gestalt einer tanzenden Doppelgängerin erhält. Und da Arimanes, der Chef, der Satanella zur Verführung des Rupert anhält, von einer Frau dargestellt wird, was allerdings ausnehmend gut gelingt, da der Sänger komplett unsichtbar bleibt und der Kampf zwischen Satanella und der Meisterin Arimanes das Kosen der beiden Frauen des Vorspiels aufnimmt, kann der Regisseur von einem „feministischen Ansatz“ sprechen.

Balfes „Satanella“/ Bühnenbild zum 3. Akt der Uraufführung/ Balfe Society/ dazu auch der Artikel in der Reihe die Vergessene Oper
Das alles muss man nicht verstehen. Alle Motive, von den schwarzen Vögeln, den Doppelgängern zuhauf, dem Spiel am Kartentisch, dem Spiel mit den Pistolen à la Russisch Roulette bis zu den verdeckten und falschen Bräuten und den lauernden, verkrümmten Mitmenschen als habe E.T.A. Hoffmann den Text geschrieben, dekliniert von Götz im Sinne einer gesteigerten Version von Carls Erzählungen durch. Die Piraten und die Küste, der Sklavenmarkt und Bazar, der Turm des bösen Ungeheuers und die Hütte des guten Mädchens, all diese pittoresken Szenen und Bilder, die das victorianische Publikum ergötzten, sind in diesem Spiel auf schwarzer Bühne mit vielen Türen nicht mehr zu finden Irgendwann hat man in diesem dream within a dream die Übersicht verloren, Hauptsache die zuvor schon als Madonna mit Strahlenkranz inthronisierte Satanella preist die Kraft wahrer Liebe und steigt irgendwann gen Himmel, „There’s a power whoses way, Angel souls adore, and the lost obey, Weeping ever more. Language cannot tell, half thy power, oh, love“. Rupert und seine Braut Lelia loben die Macht des Himmels.
Die Macht der Musik packt uns an diesem Abend (23. Oktober 24) stärker. Eigentlich hat Balfes Musik alles, was es braucht. Temperament, leichte, aber doch nicht simple Eingängigkeit, ebenso leichte, aber nicht unraffinierte Gesanglichkeit, schlichte Balladen, die in jedem Mädchenpensionat gesungen werden konnten, glitzernde Bravourszenen, Romanze, Cabaletta, machtvolle Ensembles und Finali sowie Melodien, die sich festsetzen. Inspiriert eindeutig von italienischen Vorbildern, ohne dass man sie genau benennen könnte, aber auch mit einer Prise deutscher Befindlichkeit und Innerlichkeit. Es klingt, als wenn „Bellini auf Gilbert & Sullivan trifft“, meint von Götz ganz treffend. Was der Musik vielleicht fehlt, ist der große dramatische Atem, Dringlichkeit und Durchschlagskraft. In der übermäßig verklausulierten Inszenierung verliert sich die Musik ein wenig.

Balfes „Satanella“ in Annaberg/Szene/Foto Dirk Rückschloss
Gerne hätte man den ausgezeichneten lyrischen Tenor Martin Mairinger, dessen feinem noblen Ton und keuschen sinnlichen Timbre man endlos zuhören könnte, nicht nur als Ruperts Schattengestalt erlebt. Sein Doppelgänger auf der Bühne war die zurückhaltende Martha Tam, während sich Verena Hierholzer als Arimanes die Seele aus dem Leib spielte und sich der sonore Wenzheng Tong als Stimme des Teufels absolut versteckt hielt. Als Satanella lockte Sarah Chae mal als Klosterschwester mal als Verführerin mit scharf angespitzten Koloraturen und starrer Haltung und gefälliger Mittellage. Lieblicher, aber auch unauffälliger daneben Maria Rüssel als Ruperts Braut Lelia. Die Nebenrolle des Carl wird bei Christian von Götz zur durchgehend wahnsinnigen, leidenden, sich quälenden und von Richard Glöckner mit Leidensfähigkeit gespielten Hauptfigur, deren Couplet er mit hübschem Spieltenor sang. Ebenso aufgewertet der Braccacio von Jakob Hoffmann als Beichtvater, Vertrauter und Liebender, den Carl am Ende küsst. Jens Georg Bachmann und die Erzgebirgische Philharmonie Aue gestalteten einen großen Abend romantischer Musik und zeigten nicht zuletzt in den reichen instrumentalen Vorspielen à la Carl Maria von Weber die Kunst Balfes.. Rolf Fath
.
.
An der Semperoper: Boito-Rarität zur Saison-Eröffnung. Mit der in Deutschland selten zu sehenden Oper Mefistofele von Arrigo Boito eröffnete die Sächsische Staatsoper Dresden die neue Spielzeit. Die Inszenierung von Eva-Maria Höckmayr in der Ausstattung von Momme Hinrichs (Bühne & Video) und Julia Rösler (Kostüme) ist betont streng, dunkel und minimalistisch abstrakt. Ein optischer Zauber stellt sich nicht ein. Die Farbe Schwarz dominiert die Bühne mit dunklem Rundhorizont und einer drehbaren Scheibe im Zentrum, welche häufig gekippt wird. Im zweiten Teil wird die Szene von einer dreistöckigen Galerie beherrscht, die von Menschen bevölkert ist, die das Geschehen wie Zuschauer in einer Arena verfolgen. Auf einer Treppenkonstruktion mit oberem Podest sieht man Faust, der während der Aufführung fast immer im Schatten des Titelhelden steht. Diesen zeichnet die Regisseurin als biederen Büroangestellten im dreiteiligen Anzug mit Brille, Aktentasche, Krawatte und Trenchcoat, der so gar nichts Teuflisches an sich hat und eher kauzig-menschliche Züge offenbart, wenn er an der Rampe tänzelt oder auf allen Vieren kriecht.

An der Semperoper Dresden: Boitos „Mefistofele“/Szene/ Foto Monika Rittershaus
Krzysztof Baczyk singt ihn mit aufgerautem, sprödem Bass und zuweilen dumpfer Tongebung. Seine Trümpfe kann er in der stabilen, klangvollen oberen Lage ausspielen. Fast wie sein Ebenbild in Kleidung und Physiognomie erscheint Faust, der in der 6. Vorstellung am 18.10, 2024 umbesetzt war und nun von dem argentinisch-amerikanischen Tenor José Simerilla Romero wahrgenommen wurde. Bei seinem Haus- und Rollendebüt konnte der Sänger mit baritonal getönter Mittellage und strahlenden Spitzentönen überzeugen. Zu besonderen vokalen Höhepunkten gerieten seine beiden Duette mit Margherita und Elena. Erstere gefiel in der anrührenden Darstellung von Marjukka Tepponen, die mit ihrem jugendlichen Sopran der Partie auch gesanglich nichts schuldig blieb und die große Arie „L´altra notte“ wirkungsvoll vortrug. Im Liebesduett mit Faust („Lontano lontano“) gelang beiden zuvor ein visionärer Traum vom gemeinsamen Glück mit zartem Beginn und wunderbarer Verblendung der beiden Stimmen. Effektvoll war der Auftritt von Clara Nadeshdin als blond gelockte Elena mit dunkel-sinnlichem Sopran. Ihre schwelgerische, sich ekstatisch steigernde Szene mit Faust („Amore! Misterio!“) gehörte zu den aufregendsten Momenten der Aufführung. Zur Illustration der arkadischen Traumwelt werden Motive vom Schmuckvorhang des Opernhauses verwendet,
Irritierend war die Idee der Regisseurin, eine Sprechrolle (genannt „Eine Frau“ und interpretiert von Martina Gedeck im grauen Hosenanzug) in den musikalischen Ablauf einzufügen, die das Geschehen stumm verfolgt oder Goethe-Texte aus beiden Teilen der Tragödie rezitiert, ohne dass dies den Abend bereichert hätte. Seltsam auch der Einfall, einen kleinen Putto mit weißen Engelsflügeln auftreten und in den Himmel entschweben zu lassen. Ob er sich gleich Ikarus zu hoch hinauf wagte, bleibt ungewiss. Aber die Flügel stürzen aus der Höhe herab und dienen nun Faust als Mittel für seine Reise in eine andere Welt.
Das Schlussbild wiederholt den Beginn der Aufführung, wenn Mitglieder des Sächsischen Staatsopernchores Dresden (Einstudierung: Jan Hoffmann) in heutiger Alltagskleidung an der Rampe sitzen. Die Sänger als himmlische Heerscharen, Volk und Elenas Gefolge wechseln mehrfach ihre Kostüme zwischen Historie und Gegenwart, sind gesanglich stets präsent und klangvoll. Dirigent Andrea Battistoni fordert sie wie auch die Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden bis zum Äußersten. Die fortissimo-Attacken des Orchesters erreichen mehrfach die Schmerzgrenze und manch orchestrale Feinheit geht dadurch auch verloren. Am Ende wurde die Aufführung anhaltend bejubelt und ist gelungener Einstand für die neue Intendanz des Hauses zu werten. Bernd Hoppe
.
.
Don Chisciotte von Manuel García am TfN Hildesheim: Seit einigen Jahren wählt sich das Theater für Niedersachsen (TfN) in jeder Spielzeit ein spartenübergreifendes Motto; diesmal ist es der „Ritter von der traurigen Gestalt“ Don Quichote, dessen Erlebnisse sich als Oper, als Musical und als Schauspiel in einem einheitlichen Bühnenbild ereignen. Den Beginn macht mit Don Chisciotte von Manuel García eine absolute Rarität vom Anfang des 19. Jahrhunderts; im Januar und März 2025 folgen das Schauspiel von Rebekka Kricheldorf nach dem Roman von Miguel de Cervantes und das Musical Der Mann von la Mancha.

Komponist, Lehrer und Tenor Manuel Garcia (als Otello von Rossini)/OBA
Manuel García (1775-1832) ist heute nur noch als bedeutender Gesangspädagoge und als Vater der Stars der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts Maria Malibran und Pauline Viardot-García bekannt. Fast schon vergessen ist, dass er 1816 in Rom als Startenor Rossinis Almaviva in der Uraufführung des Barbiere di Siviglia war und in den 1820er-Jahren bei einer Nordamerika-Tour das Publikum mit Barbiere, Rossinis Cenerentola und Otello sowie Mozarts Don Giovanni bekannt machte.
Auch ist er mit einigen Kompositionen hervorgetreten, so mit der Oper Don Chisciotte nach Cervantes berühmtem Roman. Nicht eindeutig geklärt ist, wann die Uraufführung stattfand, wahrscheinlich 1829 in Rom. Jedenfalls ist Don Chisciotte in Hildesheim eine deutsche Erstaufführung; in neuerer Zeit ist die Oper lediglich 2006 in Sevilla auf die Bühne gelangt.
Die Oper greift eine Episode aus dem Roman heraus und verknüpft sie mit seinem Ende, wenn der Titelheld sterbend erkennt, dass seine vermeintlichen Abenteuer Illusion gewesen sind und er in seinem Wahn nicht zwischen Dichtung und Realität hat unterscheiden können. Auch der viel zitierte Kampf gegen die Windmühlen wird in einer Erzählung in die Oper mit aufgenommen. Im Zentrum steht allerdings die abenteuerliche Geschichte zweier Paare, Fernando und Dorotea sowie Cardenio und Lucinda. Cardenio und Fernando, der mit Dorotea verheiratet ist, sind beste Freunde. Als sich Fernando allerdings in Cardenios Verlobte Lucinda verliebt, entführt er sie, um sie selbst zur Frau zu nehmen. Alle treffen auf Don Chisciotte, der sich in die Auseinandersetzung der beiden jungen Paare einmischt. Sein Page Sancio Pancia erzählt ihm, dass die Königin Micomicona (später tritt Dorotea als diese auf) ihn um Hilfe gegen einen gefährlichen Riesen bitte. Gegen diesen kämpft er nun und trifft aber nur den Hut seines Pagen. Zuvor waren auch Don Chisciottes Freunde Radipelo und Ferulino im Wirtshaus des Wirts Marcello und seiner Tochter Brunirosa erschienen. Dort sind inzwischen Fernando und Lucinda eingetroffen; dieser duelliert sich mit Cardenio, was Don Chisciotte unterbricht, um den Streit zu schlichten. Die Bühne füllt sich, als ein Dorfrichter erscheint und Fernando festnehmen lässt.

Manuel Garcias „Don Chisciotte“ am TfN Hildesheim/ Szene/ Foto Christian Heidrich
Im zweiten Teil wird es geradezu schauerlich, wenn Dorotea sich zu dem eingekerkerten Fernando begibt, um sich mit ihm zu versöhnen. Das misslingt, und sie will sich deshalb selbst töten. Der Schuss trifft versehentlich Fernando, der tot zu Boden sinkt, nicht ohne zuvor noch ein schönes Duett mit Dorotea gesungen zu haben (ob dies alles original ist, darf bezweifelt werden). Dorotea wird verhaftet und als Mörderin verbrannt, bis es dann zu einer gespenstischen „Freudenfeier“ kommt, in der eine Geisterbotin erscheint und Don Chisciotte eine bessere Zukunft voraussagt, die er richtigerweise als seinen Tod erkennt.
In Hildesheim lässt die Regisseurin Seollyeon Konwitschny-Lee, die auch eine kurze deutsche Dialogfassung erstellt hat, den Maler Francisco Goya auftreten, der in Cervantes‘ Roman gelesen hat und daraufhin wohl die insgesamt wirre Geschichte träumt. Außerdem wird der Friedensrichter, der den Streit der handelnden Personen schlichten soll, durch Napoleon ersetzt. Dies wird damit begründet, dass die Oper möglicherweise schon entstanden ist, als Spanien von 1807 bis 1814 von napoleonischen Truppen besetzt war. So wird am Schluss des ersten Teils Goyas berühmtes Gemälde Die Erschießung der Aufständischen am 3. Mai 1808 in einer Szene nachgestellt, als der Friedensrichter alias Napoleon in die Menge schießen lässt. Ganz am Ende der Oper wird ein weiteres Bild Goyas nachgestellt, indem sich geisterhafte Erscheinungen über diesen beugen.
Für die drei Bühnenfassungen des Don Quijote hat Anna Siegrot ein Einheitsbühnenbild geschaffen, das eine meist leere Spielfläche zeigt, die von zylindrischen, verschiebbaren Wänden begrenzt wird; von Amelie Müller sind die zeitgerechten, üppigen Kostüme. Schon gleich zu Anfang soll wohl deutlich gemacht werden, dass es sich um Traumbilder handelt, wenn nämlich drei Statisten mit Eselsköpfen zur Ouvertüre den Raum öffnen. Sie führen den Maler Goya, der mit einem langen weißen Nachthemd und einer Nachtmütze bekleidet ist, auf die Bühne an einen Tisch, wo er in Cervantes‘ Roman liest. Im weiteren Verlauf tritt er nur wenige Male wieder auf. Die beiden Hauptpersonen Dorotea und Don Chisciotte werden zuerst als kleine Marionetten gezeigt. Auch in Normalgröße treten sie zunächst als Marionetten auf, lösen sich aber allmählich von ihren Haltefäden – Aktionen, deren Sinn offen bleibt und deshalb nicht überzeugt.
Überhaupt darf bezweifelt werden, ob die Wiederentdeckung der Oper nun wirklich lohnend ist. Denn die szenische Verwirklichung ist höchst problematisch, weil man den Inhalt nicht versteht, wenn die teilweise recht langen Arien und Ensembles unkommentiert aufeinander folgen. Hier halfen weder die deutschen Obertitel noch die wenigen Worte der kurzen Dialoge weiter. In Hildesheim kommt eine erhebliche Überfrachtung hinzu wie die Rahmenhandlung des Goya, das Auftreten Napoleons und auch der die Handlung nicht weiterführende, vom Ritter gesprochene schwierige Text von Montesquieu mit seinem anschließenden Gespräch mit Napoleon. Statt dieser Überfrachtungen wäre es zum Verständnis sehr viel besser gewesen, man hätte einen neutralen Erzähler, vielleicht Goya hinzugefügt, wozu sich der Schauspieler Dirk Flindt bestens geeignet hätte, der hier allerdings kein Wort sprechen darf.
Die gelungene musikalische Verwirklichung zeigte die Solidität des Musiktheaters am TfN. Daraufhin drängte sich der Gedanke auf, dass Garcías gefällige Komposition sich bestens für konzertante Aufführungen eignen würde. In der zweiten Vorstellung nach der Premiere holte am 8.10.2024 GMD Florian Ziemen mit klarer Übersicht und präziser Zeichengebung aus der kleinen, aber tüchtigen TfN-Philharmonie alles heraus, um die deutlich von Rossini beeinflusste Musik zum Klingen zu bringen.

Manuel Garcias „Don Chisciotte“ am TfN Hildesheim/ Szene/ Foto Christian Heidrich
Die gesanglichen Anforderungen sind für alle beachtlich; sie wurden vom Ensemble und einigen Gästen souverän erfüllt. Möglicherweise hat sich García die Titelrolle selbst auf den Leib geschrieben; ob er allerdings in seinem sechsten Lebensjahrzehnt mit den eigenen hohen Ansprüchen zurechtkam, weiß man nicht. Der Hildesheimer Haustenor Yohan Kim jedenfalls hatte damit keine Probleme, indem er seine kräftige Stimme sicher, wenn auch mit leichten Einbußen bei den Koloraturen durch alle Lagen führte. Dorotea war Sonja Isabel Reuter, die trotz angesagter Indisposition mit flinken Läufen und glasklaren Koloraturen zu begeistern wusste. Neu im Ensemble ist der Kanadier Andrey Andreychik, der die Rolle des Pagen Sancio Pancia mit munterem Spiel und markigem Bariton ausfüllte; eine auch bei ihm angesagte Indisposition wirkte sich stimmlich nicht weiter aus. Mit seinem schlanken, intonationsrein geführten Tenor gab Julian Rohde den Cardenio, während der koreanische Bariton Seunghoon Baek als Fernando gefiel. Ebenfalls als Gast trat die Spanierin Carolina Luquin Duarte auf, die als Lucinda mit feinem Sopran positiv auffiel. Der immer wieder bewährte Uwe Tobias Hieronimi war der Wirt Marcello, dessen Tochter Brunirosa beim charaktervollen Mezzosopran von Neele Kramer gut aufgehoben war, die auch noch die geheimnisvolle Geisterbotin gab. Ohne Fehl waren Eddie Mokofeng und Chun Ding Don Chisciottes Freunde Radipelo und Ferulino; Hogeun Kim ergänzte als Napoleon. Wie immer in Hildesheim zeigten Opernchor und Extrachor in der Einstudierung von Achim Falkenhausen ausgewogene Klangfülle.
Im leider schwach besuchten Haus bedankte sich das Publikum bei den Mitwirkenden mit starkem, lang anhaltendem Applaus für die guten Leistungen. Gerhard Eckels
.
.
.
Eine Opernkomponistin 1835 in Italien? Anna die Resburgo von Carolina Ucelli beim Teatro Nuovo, New York. Die Suche nach Carolina Uccelli begann mit einem historischen Druckfehler. Will Crutchfield – Maestro, Musikwissenschaftler, Musikkritiker, Gelehrter – durchforstete die Listen der Opern und Komponisten in Band IV von Francesco Florimos monumentalem Werk, das alle in Neapel in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts produzierten Opern katalogisiert, als er auf einen interessanten Eintrag für eine „Carolina Miceli“ und eine Oper namens Anna di Resburgo stieß, die laut Florimo 1835 am Teatro San Carlo nach einem Libretto von Gaetano Rossi aufgeführt wurde.
Eine Oper von einer Frau? Im Italien der 1830er Jahre? Aufgeführt an einem großen Opernhaus? Für einen Belcanto-Liebhaber und Musikhistoriker in der Tat verlockend, aber nachfolgende Recherchen ergaben nichts über „Miceli“, bis Crutchfield einen korrigierten Eintrag in Giovanni Salviolis viel späterer „Bibliography of the Italian Dramatic Theatre…“ fand, in dem vermerkt war, dass der Komponist nicht Miceli, sondern Uccelli hieß und dass das Theater der Uraufführung nicht das San Carlo Neapel war, sondern das gemeinsam verwaltete Teatro del Fondo. Bei der Suche nach der Partitur wurde das Manuskript eines Kopisten in der Bibliothek des Konservatoriums von Neapel gefunden (wo Donizetti-Zeitgenonosse und Biograph Florimo eineinhalb Jahrhunderte zuvor Archivar gewesen war). Crutchfield nannte es „Hühnerkratzer“, aber auch Beweise für „eine geborene Opernkomponistin“, und es begann die lange Aufgabe, die handschriftliche Partitur für eine Aufführung dieser völlig unbekannten Oper einer völlig unbekannten Komponistin nutzbar zu machen, die sich in die Höhen der Opernproduktion in der Stadt gewagt hatte, die die Karrieren von Rossini, Donizetti, Bellini und so vielen anderen begründet hatte.
 Wer war Carolina Uccelli? Sie wurde 1810 in der Nähe von Florenz als Carolina Pazzini geboren, heiratete einen bekannten Arzt und Professor aus Pisa und gebar ihm eine Tochter, Emma. Im Alter von 17 Jahren begann Uccelli mit der Komposition von Liedern, und eine Sammlung ihrer Lieder und Arien wurde in ihrem siebzehnten Lebensjahr in Mailand veröffentlicht. Im Jahr 1830, als sie 20 Jahre alt war, wurde ihre erste Oper, Saul – das Manuskript ist verloren gegangen – am Teatro della Pergola in Florenz mit Rossinis starker Unterstützung aufgeführt. Anna di Resburgo wurde komponiert, als Uccelli in ihren frühen Zwanzigern war, und in Neapel aufgeführt, als sie 25 war. Sie erlebte einige Aufführungen im Fondo mit mehreren Mitgliedern derselben außergewöhnlichen Besetzung, die einen Monat zuvor Lucia di Lammermoor im San Carlo uraufgeführt hatte; vielleicht gab es Anfang des folgenden Jahres eine weitere Aufführung im San Carlo – und dann war es still. Vielleicht arbeitete Uccelli an einer Oper namens Eufemio da Messina, die jedoch nie produziert (oder fertiggestellt) wurde. Sie schrieb eine Kantate zu Ehren von Maria Malibran, als diese berühmte Sängerin starb, und zog sich dann in ein häusliches Leben zurück, zog ihre Tochter groß, ohne jedoch das Komponieren aufzugeben, wenn auch kleinere Salonstücke und Lieder und Arien für Diven der Epoche, Werke, die die Gesellschaft für eine talentierte Frau als „angemessen“ erachtete, entstanden. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie schließlich nach Paris und reiste mit ihrer Tochter Emma, die inzwischen erwachsen und Sängerin geworden war, auf Konzertreisen herum. Einer ihrer „Auftritte“ war bei einem der berühmten Salonkonzerte, die ihr langjähriger Freund, der pensionierte Rossini, in seiner Wohnung in der Rue d’Antan gab. Sie starb 1858,, ihre Karriere als Opernkomponistin, bevor sie 30 Jahre alt wurde, war längst vergessen, reduziert auf „Miceli“, ein falsches Kürzel in einer langen Liste ihrer Werke von Komponiste, die außer ihr alle Männer waren.
Wer war Carolina Uccelli? Sie wurde 1810 in der Nähe von Florenz als Carolina Pazzini geboren, heiratete einen bekannten Arzt und Professor aus Pisa und gebar ihm eine Tochter, Emma. Im Alter von 17 Jahren begann Uccelli mit der Komposition von Liedern, und eine Sammlung ihrer Lieder und Arien wurde in ihrem siebzehnten Lebensjahr in Mailand veröffentlicht. Im Jahr 1830, als sie 20 Jahre alt war, wurde ihre erste Oper, Saul – das Manuskript ist verloren gegangen – am Teatro della Pergola in Florenz mit Rossinis starker Unterstützung aufgeführt. Anna di Resburgo wurde komponiert, als Uccelli in ihren frühen Zwanzigern war, und in Neapel aufgeführt, als sie 25 war. Sie erlebte einige Aufführungen im Fondo mit mehreren Mitgliedern derselben außergewöhnlichen Besetzung, die einen Monat zuvor Lucia di Lammermoor im San Carlo uraufgeführt hatte; vielleicht gab es Anfang des folgenden Jahres eine weitere Aufführung im San Carlo – und dann war es still. Vielleicht arbeitete Uccelli an einer Oper namens Eufemio da Messina, die jedoch nie produziert (oder fertiggestellt) wurde. Sie schrieb eine Kantate zu Ehren von Maria Malibran, als diese berühmte Sängerin starb, und zog sich dann in ein häusliches Leben zurück, zog ihre Tochter groß, ohne jedoch das Komponieren aufzugeben, wenn auch kleinere Salonstücke und Lieder und Arien für Diven der Epoche, Werke, die die Gesellschaft für eine talentierte Frau als „angemessen“ erachtete, entstanden. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie schließlich nach Paris und reiste mit ihrer Tochter Emma, die inzwischen erwachsen und Sängerin geworden war, auf Konzertreisen herum. Einer ihrer „Auftritte“ war bei einem der berühmten Salonkonzerte, die ihr langjähriger Freund, der pensionierte Rossini, in seiner Wohnung in der Rue d’Antan gab. Sie starb 1858,, ihre Karriere als Opernkomponistin, bevor sie 30 Jahre alt wurde, war längst vergessen, reduziert auf „Miceli“, ein falsches Kürzel in einer langen Liste ihrer Werke von Komponiste, die außer ihr alle Männer waren.
 Anna di Resburgo war 189 Jahre nach ihrer Geburt am 20. Juli 2024 im Alexander Kasser Theatre auf dem Campus der Montclair State University in Montclair, New Jersey, endlich wieder zu hören; dann folgte eine weitere Aufführung ins Rose Theater am Columbus Circle in New York. Die halbszenische Produktion stammt vom Teatro Nuovo (TN), der Belcanto-Schmiede von Will Crutchfield. Vor der Oper gab es für das zahlreich erschienene Publikum ein Klavier- und Gesangskonzert der TN Resident and Studio Artists und eine von Will Crutchfields faszinierenden musikalischen Analysen der kommenden Oper. Die Sängerinnen und Sänger führten acht Konzertarien und Lieder von Uccelli auf, begleitet von Timothy Cheung am Klavier. Die Werke waren eine Offenbarung, zwei davon schrieb der siebzehnjährige Uccelli, das Bellini-eske „Non invan su questa sponda“ und die Arie mit Cabaletta „Frena le belle lagrime“: „Il rimprovero“, das stark an Desdemonas „Weidenlied“ aus Rossinis Otello erinnert; ein Trinklied („Orgia“), ein lebhaftes Tenorstück, „Il menestrello“ („Der Minnesänger“), ein Lied in französischer Sprache und, besonders reizvoll, ein Duett für Sopran und Mezzo („I rematori“), das Uccelli für sich und ihre Tochter Emma schrieb, um es auf ihren Konzertreisen zu singen. Die Texte stammten wahrscheinlich von Uccelli selbst. Viele der Sänger schienen das Studentenalter überschritten zu haben, darunter Jeremy Brauner (Tenor), Laura Nielsen (Sopran), Juan Hernandez (Tenor) und Robert Garner (Bariton).
Anna di Resburgo war 189 Jahre nach ihrer Geburt am 20. Juli 2024 im Alexander Kasser Theatre auf dem Campus der Montclair State University in Montclair, New Jersey, endlich wieder zu hören; dann folgte eine weitere Aufführung ins Rose Theater am Columbus Circle in New York. Die halbszenische Produktion stammt vom Teatro Nuovo (TN), der Belcanto-Schmiede von Will Crutchfield. Vor der Oper gab es für das zahlreich erschienene Publikum ein Klavier- und Gesangskonzert der TN Resident and Studio Artists und eine von Will Crutchfields faszinierenden musikalischen Analysen der kommenden Oper. Die Sängerinnen und Sänger führten acht Konzertarien und Lieder von Uccelli auf, begleitet von Timothy Cheung am Klavier. Die Werke waren eine Offenbarung, zwei davon schrieb der siebzehnjährige Uccelli, das Bellini-eske „Non invan su questa sponda“ und die Arie mit Cabaletta „Frena le belle lagrime“: „Il rimprovero“, das stark an Desdemonas „Weidenlied“ aus Rossinis Otello erinnert; ein Trinklied („Orgia“), ein lebhaftes Tenorstück, „Il menestrello“ („Der Minnesänger“), ein Lied in französischer Sprache und, besonders reizvoll, ein Duett für Sopran und Mezzo („I rematori“), das Uccelli für sich und ihre Tochter Emma schrieb, um es auf ihren Konzertreisen zu singen. Die Texte stammten wahrscheinlich von Uccelli selbst. Viele der Sänger schienen das Studentenalter überschritten zu haben, darunter Jeremy Brauner (Tenor), Laura Nielsen (Sopran), Juan Hernandez (Tenor) und Robert Garner (Bariton).
 Will Crutchfields Vortrag über die Oper, der durch zahlreiche Musikbeispiele veranschaulicht wurde, zeigte seine echte Begeisterung für seine Entdeckung und wies deutlich auf Uccellis „Fingerabdrücke“ hin, darunter ungewöhnliche harmonische Verläufe und experimentelle Orchestrierungen (z. B. eine Begleitung für Trommel und Flöte, zwei sehr ungewöhnliche Instrumente, die zusammen zu hören sind). Vor allem wies Crutchfield auf Uccellis angeborenes Verständnis dafür hin, wie man einen kompletten Opernabend musikalisch „aufbaut“, insbesondere den straffen zweiten Akt. Er wies darauf hin, dass wir ihr Werk vielleicht nicht im Vergleich mit den größten Opern des Jahrhunderts von den großen Komponisten – Verdi, Wagner, Rossini, Donizetti – beurteilen sollten, sondern mit der zweiten Oper dieser überragenden Persönlichkeiten. Im Vergleich zu Un giorno di regno oder Das Liebesverbot oder ähnlichem ist Uccelli der klare Sieger.
Will Crutchfields Vortrag über die Oper, der durch zahlreiche Musikbeispiele veranschaulicht wurde, zeigte seine echte Begeisterung für seine Entdeckung und wies deutlich auf Uccellis „Fingerabdrücke“ hin, darunter ungewöhnliche harmonische Verläufe und experimentelle Orchestrierungen (z. B. eine Begleitung für Trommel und Flöte, zwei sehr ungewöhnliche Instrumente, die zusammen zu hören sind). Vor allem wies Crutchfield auf Uccellis angeborenes Verständnis dafür hin, wie man einen kompletten Opernabend musikalisch „aufbaut“, insbesondere den straffen zweiten Akt. Er wies darauf hin, dass wir ihr Werk vielleicht nicht im Vergleich mit den größten Opern des Jahrhunderts von den großen Komponisten – Verdi, Wagner, Rossini, Donizetti – beurteilen sollten, sondern mit der zweiten Oper dieser überragenden Persönlichkeiten. Im Vergleich zu Un giorno di regno oder Das Liebesverbot oder ähnlichem ist Uccelli der klare Sieger.

Will Crutchfield conducting at Teatro Nuovo’s predecessor, the Bel Canto program at the Caramoor Festival (Photo by Gabe Palacio)/Early America Music
Die Partitur, die von den Solisten des Teatro Nuovo mit ihrem historisch orientierten Orchester und ihren Chören dargeboten wurde, trug den ganzen Enthusiasmus in sich, den Maestro Crutchfield im Vorfeld geäußert hatte. Das Libretto von Gaetano Rossi, das 1819 für Meyerbeers Emma di Resburgo geschrieben wurde, wurde von Uccelli überarbeitet. Die Geschichte geht sogar noch weiter zurück, bis hin zu Méhuls Héléna aus dem Jahr 1803, in der die Geschichte einer abgewendeten Tragödie und der Rettung Unschuldiger in der französischen Provinz spielt. Giovanni Simone Mayr hatte die Geschichte für eine italienische Oper, Elena, mit einem Libretto von Leone Tottola, aufgegriffen, und andere folgten ihm. Rossi verlegte den Schauplatz für Meyerbeer nach Schottland (Roxburgh), das damals im Gefolge von Walter Scotts äußerst populären Romanen sehr in Mode war. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die elfjährige Uccelli Meyerbeers Oper gesehen hat, als sie 1821 in Florenz aufgeführt wurde, und die Geschichte scheint ihm im Gedächtnis geblieben zu sein.
Es ist die Geschichte einer starken Frau, einer Mutter und ihres Kindes, einer glücklichen Ehe und einer Rettung vor Ungerechtigkeit, die es der Familie ermöglicht, trotz aller Widrigkeiten wieder vereint zu sein. In gewisser Weise ging sie der Zeit gegen den Strich, mit schwachen romantischen Heldinnen und byronischen Helden, die tragische Schicksale erleiden. Bevor sich der Vorhang hebt, hat Duncalmo seinen Freund Roggero, den Herrn von Lanerk, heimtückisch ermordet und es so arrangiert, dass Roggeros Sohn Edemondo des Verbrechens beschuldigt wird. (Eine ausführliche Inhaltsangabe und weitere Informationen gibt es dann im Rahmen eines weiteren Beitrags der Reihe Die vergessene Oper, G. H.)
 Die TN-Besetzung war durchweg hervorragend. Besonders wunderbar war Ricardo José Rivera als Norcesto, dessen sonorer Bass jede Belcanto-Wendung beherrscht und dennoch die Komplexität der Figur wiedergibt. Ebenso gut war der Tenor Lucas Levy als Olfredo, der in seiner ungewöhnlichen „Patter“-Arie glänzte. TN-Stammgast Santiago Ballerini (dessen Arbeit mit Crutchfield auf seine Bel Canto at Caramoor-Tage zurückgeht) erwies sich in der Hauptrolle des Edemondo als völlig zu Hause, während Elise Albian als Etelia (die die Oper mit einer pastoralen Arie eröffnet, die das glückliche Ende vorwegnimmt) sehr schön sang. Chelsea Lehnea, eine weitere TN-Stammkundin, sang die Anna sympathisch und mit behender Belcanto-Pyrotechnik, obwohl sie zu den Sopranen gehört, deren Sopran hauptsächlich aus der Kopfstimme zu kommen scheint.
Die TN-Besetzung war durchweg hervorragend. Besonders wunderbar war Ricardo José Rivera als Norcesto, dessen sonorer Bass jede Belcanto-Wendung beherrscht und dennoch die Komplexität der Figur wiedergibt. Ebenso gut war der Tenor Lucas Levy als Olfredo, der in seiner ungewöhnlichen „Patter“-Arie glänzte. TN-Stammgast Santiago Ballerini (dessen Arbeit mit Crutchfield auf seine Bel Canto at Caramoor-Tage zurückgeht) erwies sich in der Hauptrolle des Edemondo als völlig zu Hause, während Elise Albian als Etelia (die die Oper mit einer pastoralen Arie eröffnet, die das glückliche Ende vorwegnimmt) sehr schön sang. Chelsea Lehnea, eine weitere TN-Stammkundin, sang die Anna sympathisch und mit behender Belcanto-Pyrotechnik, obwohl sie zu den Sopranen gehört, deren Sopran hauptsächlich aus der Kopfstimme zu kommen scheint.
Passenderweise waren die Orchesterleiter (in dem von TN praktizierten historischen Stil) beide Frauen: Elisa Citterio war Primo Violino e Capo d’Orchestra und Lucy Tucker Yates war Maestra al Cembalo. Ihr Spiel und ihre Leitung waren einfühlsam und voller Klarheit. Derrick Goff war der Chorleiter. Alle spürten offensichtlich die Bedeutung des Augenblicks und waren diesem besonderen Anlass gewachsen.
Lehnea war die einzige Sängerin, die kostümähnliche Kleidung trug – ein Bauernkleid im ersten Akt und ein weites Queen-Anne-Kleid in leuchtendem Grün im zweiten Akt, die beide im Kontrast zu ihrem kurzen blonden und sehr modernen Haarschnitt standen. Alle anderen trugen formelle Kleidung. Die Inszenierung von Marco Nisticò war jedoch szenisch, oder fast szenischt. Es gab gemalte Bühnenbildprojektionen im Stil des primo ottocento von Adam Thompson und eine effektive Beleuchtung von Devon Allen und Jason Flamos.

Carlolina Ucelli: Fanny Tachinardi Persiani sang die Titelrolle der Uraufführung/ hier auf einbem Stich zu Donizettis „Lucia di Lammermoor“/Wikipedia
Carolina Uccelli hatte das große Pech, ihre Oper nur wenige Wochen nach der Uraufführung von Donizettis Lucia di Lammermoor im selben Neapel aufzuführen. Fanny Tacchinardi-Persiani, die erste Anna, kam nämlich gerade von ihrer siebzehnten Aufführung und versetzte das Publikum mit der Wahnsinnsszene aus Lucia in helle Aufregung . Anna di Resburgo, die eine schottische Kulisse und einige Ähnlichkeiten in der Handlung mit Lucia aufweist, verfügt nicht über so unvergessliche Melodien wie „Cruda funesta smania“, das Sextett, die verrückte Szene oder die Schlussarie des Tenors. Ist es da ein Wunder, dass die arme Uccelli-Oper von dem neuen Meisterwerk, das am anderen Ende der Stadt gespielt wird, in den Schatten gestellt wurde?
Nichtsdestotrotz ist Anna di Resburgo wieder da. Will Crutchfield verspricht eine gedruckte Partitur und (so wagen wir zu hoffen) eine CD. Wir hoffen, dass Carolina Uccellis lange verschollenes Kind wieder da ist und dass das Teatro Nuovo ihm ein wirklich glückliches Ende beschert hat – endlich. Charles Jernigan/ Übersetzung DeepL (alle Aufführungsfotos Steven Pisano/Teatro Nuovo; ein ausführlicher Beitrag zu dieser Ausgrabung folgt ebenfalls in unserer Serie Die vergessene Oper mit Originalbeiträgen von Dirigenten Will Crutchfield)
.
.
.An der Semperoper: Berlioz mit Bilderflut. Für seinen Abschied von der Sächsischen Staatsoper Dresden hatte Intendant Peter Theiler ein anspruchsvolles Werk gewählt: Hector Berlioz´ Opéra-comique Benvenuto Cellini. Gezeigt wurde die Weimarer Fassung, welche am dortigen Hoftheater 1852 zur Uraufführung kam. In Dresden wurde das Werk 1888 an der Königlichen Hofoper erstaufgeführt, erlebte danach 1929 noch eine Produktion, um dann gänzlich aus dem Repertoire zu verschwinden.
Fast hundert Jahre später also ein lokaler Wiederbelebungsversuch, für den die tschechisch-schweizerische Regisseurin Barbora Horáková gewonnen wurde. Gemeinsam mit der Bühnenbildnerin Aida Leonor Guardia überflutet sie den Zuschauer mit einer Überfülle von Bildern und Aktionen, welche ihn an den Rand der Ratlosigkeit, ja Erschöpfung führen. Das Künstlerdrama um den berühmten Bildhauer, das an drei Tagen während des Karnevals in Rom 1532 spielt, verortet sie in der Gegenwart und stellt Cellini als Forscher für KI oder andere moderne Technologien dar. Entsprechend wird die Szene überfüllt mit technischen Videoclips (Sergio Verde), die aber auch zeitgenössische Episoden zeigen (wenn der Pabst von Trump, Putin und Macron geküsst wird). Pausenlos zu sehen sind Projektionen auf dem Rundhorizont – durch Science-fiction-Figuren verfremdete Renaissance-Gemälde, ein zerstörtes antikes Theater, die berühmte Perseus-Statue mit dem abgeschlagenen Haupt der Medusa, ergänzt durch kubistische Varianten und eine Metropolis-Figur. Dominant sind zwei futuristische Kopfhälften an mit Neonröhren versehenen Gerüsten links und rechts, die sich drehen können und auf ihren Rückseiten digitale Raster oder anderes technologisches Gewirr zeigen. Scheußlich sind die Kostüme von Eva Butzkies in ihrer grellen Buntheit und ans Peinliche grenzenden Geschmacklosigkeit. Zweifelhaft scheinen die Auftritte einer Tänzer-Gruppe, die in der Choreografie von Juanjo Arqués das Geschehen bevölkert – als Breakdancer, Gaukler, die Leibgarde des Papstes, der in einem goldenen Fabergé-Ei hereingetragen wird, oder halbnackte Jünglinge, die Cellini beim Gießen seiner Perseus-Statue lasziv garnieren. Rätselhaft sind einige Personen, vor allem Cellinis Gehilfe Ascanio, der in Gestalt von Stepánka Pucálková als außerirdischer Roboter im silbernen Raumanzug mit abgehackten Bewegungen daherkommt. Das größte Fragezeichen gibt der blonde Knabe am Ende auf, der per Knopfdruck die Massen wie Marionetten zusammenfallen lässt. Sollte das die KI vermögen?

„Benvenuto Cellini“ von Hector Berlioz in Dresden/Szene/ © Semperoper Dresden/Ludwig Olah
Über die musikalische Seite der Aufführung lässt sich Positiveres berichten. Mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden fächert Giampaolo Bisanti die farbenreiche Musik imponierend auf. In der Ouvertüre lässt er deren Brio und das schwelgerische Melos aufscheinen, später vor allem die lebhaften Chorszenen zu starker Wirkung kommen. Manches aber ist in der Dynamik nicht ausgewogen, zu sehr auf forte-Attacken orientiert. Der Sächsische Staatsopernchor Dresden (Einstudierung: André Kellinghaus) sorgt für ausgelassene Stimmung und vokale Pracht beim Trinkgelage oder beim Auftritt als Bauarbeiter mit Schutzhelmen während Cellinis Schöpfungsakt mit der Statue. Anton Rositskiy als Titelheld verwandelt sich hier selbst in Perseus, auf einem Treppenpodest stehend und sich mit goldener Farbe anstreichend. Das Solo „Sur les monts“ singt der Tenor sehr kantabel und weich, während seine höhensichere Stimme die exponiert notierte Partie zwar souverän bewältigt, aber nicht immer angenehm klingt. Seinen Konkurrenten Fieramosca gibt Jérôme Boutillier mit zupackendem Bariton, Ante Jerkunica den päpstlichen Schatzmeister Balducci mit auftrumpfender Gebärde. Dem Papst Clemens VII verleiht Tilmann Rönnebeck seinen sonoren Bass. Makellos ist der Gesang von Tuuli Takala als Teresa. Der kraftvolle Sopran der Sängerin klingt mühelos auch bei der Bewältigung anspruchsvollster Passagen und sie überzeugt darüber hinaus mit ihrem lebhaften Spiel. Stepánka Pucálková stattet den Ascanio mit ihrem hellen, zuweilen herben Mezzosopran aus, der im Solo „Tra la la la“ im 2. Akt energisch und übermütig auftrumpft. Auch in der letzten Vorstellung der Serie am 10. Juli 2024 war das Haus gut gefüllt und das Publikum von der Aufführung sehr angetan. Bernd Hoppe
.
.
Mussorgskys Chowanschtschina an der Berliner Staatsoper: Epischer Bilderbogen. Eine Produktion von Mussorgskys Volksdrama Chowanschtschina stellt jedes Opernhaus vor große Herausforderungen – zum einen wegen der nötigen hochkarätigen Besetzung, zum anderen wegen der ereignisreichen Handlung, welche die politischen Machtverhältnisse im Russland des 17. Jahrhunderts thematisiert und für deren Umsetzung es eines erfahrenen Regisseurs bedarf.
An der Staatsoper hatte Claus Guth diese Aufgabe übernommen. Zum Team gehören seine erprobten Mitarbeiter Christian Schmidt (Bühne) und Ursula Kudrna (Kostüme). Entstanden ist eine Aufführung mit vielfältigen künstlerischen Mitteln – darunter die im zeitgenössischen Musiktheater mittlerweile omnipräsenten Live-Kameras, deren Aufnahmen auf diverse Screens im Bühnenhintergrund übertragen werden. Zudem gibt es Filme, welche das Elend des russischen Volkes von der Vergangenheit bis in die Gegenwart zeigen, sowie abgebildete historische Gemälde. Die Personen der Handlung werden in einigen Sätzen charakterisiert, welche über ihnen an die Wand geworfen werden. Das alles ergibt eine Fülle von Informationen, die zu verfolgen vom Vortrag der Interpreten auch ablenken kann.

„Chowanschtschina“ an der Berliner Staatsoper/ Foto Rittershaus
Problematisch ist die Erfindung einer zweiten Zeitebene – die der Gegenwart mit einer Forschergruppe, deren Mitglieder die Geschichte be- und hinterfragen. In ihrer uniformen Schutzkleidung mit Handschuhen erinnern sie an medizinisches Personal. Seltsamerweise sind sie aber nicht nur Beobachter, sondern greifen nahezu permanent in die Handlung ein, fungieren als Ankleider, Requisiteure und Bühnenarbeiter, sorgen für Nebel und transportieren Tote von der Bühne. Im letzten Akt wird das Forschungsprojekt abgebrochen, was die Mitglieder von der Bühne verbannt – sehr zum Gewinn der Aufführung, die nun stringenter abläuft und an Faszination gewinnt. Ein glänzender Einfall ist die Verwendung von tableaux vivants, die in ihrer Anschaulichkeit und Ästhetik von bestechender Wirkung sind und jegliche naturalistische Darstellung vermeiden. Da sieht man den jungen Zaren Peter, von Kindheit an ein begeisterter Anhänger des Militärs, auf einem Schlachtfeld inmitten von Zinnsoldaten oder einen Kriegsschauplatz mit einem zu Tode gestürzten Pferd und erschossenen Soldaten. Ein großer Wurf ist die Choreografie von Sommer Ulrickson, die nach dem ausgelassenen Tanz der Frauen in der Strelitzen-Vorstadt zu ihrem Höhepunkt findet im Palast des Fürsten Iwan Chowanski beim Tanz der ganz in Weiß gekleideten Männer und Frauen, die sich wie Derwische in Trance drehen. Überhaupt sind die Kostüme von Ursula Kudrna in ihrer Pracht, der aufwändigen Verarbeitung und Detailgenauigkeit ein Glanzstück der Inszenierung. Schmidts Bühnenbilder beginnen und enden in einem Arbeitszimmer Putins im Kreml mit einer Statue von Zar Peter hinter dem Schreibtisch. Danach werden die einzelnen Schauplätze skizzenhaft angedeutet, was dem Fragmentarischen des Werkes entspricht, oft mit dem Einsatz der Unterbühne.
Grandios sind die Chorszenen, beginnend im 1. Akt mit dem Klagegesang „Ach, liebes Mütterchen Russland“ bis zum kollektiven Suizid am Ende, wenn alle in schwarzen Gewändern und mit brennenden Kerzen Gott preisen und dann in der Tiefe versinken, wo sie den Flammentod finden. Lichtdesigner Olaf Freese hat dankenswerterweise auf rotes Licht und die Projektion von züngelnden Flammen verzichtet, dafür die Szene mit schwarzen Rußpartikeln überschüttet, welche in ihrer Düsternis ein beklemmendes Bild abgeben. Der Chor und der Kinderchor der Berliner Staatsoper (Einstudierung: Dani Juris) singen mit überwältigender Präzision, mit Kraft und Fülle. Simone Young hat sich mit der Staatskapelle Berlin der Fassung von Dmitri Schostakowitsch mit dem Finale von Igor Strawinsky angenommen (erstaufgeführt 1960 in Leningrad). Ihre Lesart ist betont lyrisch, die Musik kann schroffer, kantiger und spröder klingen. Die flirrenden Orientalismen im 4. Akt erinnern gar an Borodin und Rimsky-Korsakow.
Eine glänzende Besetzung legt der Staatsoper Ehre ein, angeführt von zwei Ausnahme-Bässen, die sich ein Atem beraubendes Duell liefern. Der Finne Mika Kares als Fürst Iwan Chowanski im roten Uniformmantel der Strelitzen imponiert mit machtvoller Stimme, Taras Shtonda als Dossifei im grauen Gewand mit orgelndem Organ steht ihm nicht nach. Namiddin Mavlyanov gibt mit potentem Tenor Iwans Sohn Andrei. Prachtvoll gewandet in Samt und Spitze ist Marina Prudenskaya die Marfa, bei der Prophezeiung ganz in Schwarz und mit prophetischem Ausdruck. Evelin Novak ist eine Emma mit expressivem Sopran, Anna Samuil die Susanna mit greller Höhe. Das Publikum der Premiere am 2. Juni 2024 feierte alle Mitwirkenden enthusiastisch. Bernd Hoppe
.
.
Grandioses in Brandenburg: Richard Strauss´ Elektra wurde am Theater Brandenburg als ein Psychodrama gegeben, das in seiner packenden Darstellung an die so genannten „Revenge-Movies“ Hollywoods erinnerte, in denen sich Frauen, die oft bereits dem Wahnsinn verfallen sind, spektakulär für erlittene Gewalt rächen. Mord, Rache und Gewalt wurden so in voller Wucht präsentiert. Die Stärke der Brandenburger Elektra liegt darin, dass das Psychogramm einsamer, verletzter und mit teils tödlicher Wut gefüllter Seelen packend entfesselt wird.
Das Bühnenbild besteht aus stehenden und hängenden Metallelementen mit unterschiedlich angeordneten Verstrebungen aus Panzertape, die einem Tarnnetz der Armee gleichen. Sie werden passend zur Szene mit faszinierenden Lichteffekten ausgeleuchtet, so dass eine Bildlandschaft mit faszinierenden Impressionen entsteht. In der Mitte der Bühne steht die Urne des toten Königs Agamemnon, über die sein Königsmantel hängt, den Elektra später überstreift.
Für die Kostüme zeichnet Hannes Ruhland verantwortlich. Gelernter Damenschneidermeister und an der Modeschule München ausgebildeter Stylist war er langjährig als freischaffender Designer und bei Escada tätig. Heute betreut er unter anderem seine eigene Kollektion „Shapes & Patterns“. Durch die luxuriöse Wahl eines derart beschlagenen Designers wartet die Brandenburger Elektra mit vollendeten, die Charaktere subtil zeichnenden Kostümen auf. Barbara Kriegern trägt ein militärisch geschnittenes Kleid mit integrierten Shorts, über das sie zeitweise den Königsmantel trägt. Geschickt werden so Weiblichkeit, gesellschaftlicher Rang und der mörderische Auftrag versinnbildlicht. Orest ist gleichfarbige uniformiert während Klytämnestra und Chrysothemis blutrot tragen. So werden schon durch Kostümschnitt und Farben die Lager der unterschiedlichen Parteien verdeutlicht Die Mägde erinnern in Gewändern an die Hexen in Macbeth. Aegisth ist ein viriler junger Krieger mit Goldpanzer.
Regisseur Alexander Busche erweist sich als Meister der Licht- und Personenführung. Zentrum des Raums ist eine metallenen Vase, die einer Urne gleicht und auch die Asche Agamemnons Bergen könnte. Die unterschiedlichen Szenen werden mit eindrucksvollen Lichteffekten untermalt. Mal schlangengleich verschlagen und mal elegant verführerisch bewegt sich Barbara Krieger gefährlich amazonengleich aber auch verführerisch im Dialog mit Klytämnestra durch den Raum. Orest ist ihr äußerlich in sich ruhender Gegenpol, der nur selten wütend auffährt. Hier ist das Stück entsprechend der Musik inszeniert und unterstützt die Entwicklung des Dramas
György Mészáros konnte das packend rauschhafte Musiktheater mit den Brandenburger Symphonikern packend umsetzen. Gespielt wurde die orchestral reduzierte mit etwa fünfzig Musikern, die hinter dem Bühnenbild spielten. Neben der Wucht der Emotionen gelangen auch die Zwischentöne, Kontraste und kammermusikalische Elemente. Mészáros bewältige auch die schwierige Aufgabe ohne unmittelbaren Kontakt mit den Sängerinnen und Sängern ein großes Drama zu erzeugen. Insgesamt überzeugte das Orchester durch ein differenziertes und packendes Klangbild. Den Musiker gelang eine ergreifenden Farbpalette und es wurde mit grandioser innerer Beteiligung gespielt.

„Elektra“ am Theater Brandenburg/Szene mit Barbara Krieger und Yvonne Elisabeth Frey / Foto Detlef Kurth
Barbara Kriegers Elektra war von lyrisch glühender Intensität. Mit immensem vokalem Einsatz und einer breiten Palette an Stimmfarben gelangen ihre die Momente der eigenen Verletzlichkeit aber auch der tückischen Gefahr, die von Elektra ausgeht, mit faszinierender Seelentiefe. In ihren Monologen und den Dialogen mit Orest und Klytämnestra entwickelt sie eine verzehrende Intensität und große darstellerische Präsenz. Sie war technisch unglaublich sicher und so mit der Partie verwachsen, dass sie ihre stimmlichen Qualitäten durchweg ausspielen konnte. Darstellerische Intensität, paarte sich mit atemberaubendem stimmlichen Umfang von der Tiefe bis in die höchsten Lagen. und berückendem Timbre. Die Stimme behielt stets einen sonoren Klang, blieb in der Gesangslinie und prunkte mit großer Wortdeutlichkeit. Schauspielerisch ging sie in der Rolle vollendet auf. Eine besondere Herausforderung für sie lag auch darin, dass sich Brandenburg für die ungekürzte Fassung entschieden hatte. Ein beeindruckendes Rollendebut.
Als Chrysothemis bestach Yvonne Elisabeth Frey mit hellem lyrisch-dramatischen Sopran. Mit jugendlichem Feuer goss sie ihre Träume und Sehnsüchte in blühende und raumfüllende Klänge. Einer der Glanzpunkte war auch der Dialog mit Elektra im Finale. Ihre Rolle gestaltete sie mit Verve und Intensität.
Gráinne Gillis Klytämnestra war mit dunkel volltönendem Mezzosopran und teils keifenden Höhen weniger ein starker Widerpart als eine Frau, der schon der Tod dämmerte und die darüber verzweifelte. Wut und Verletzlichkeit stellte sie mit großer Authentizität und involviertem Spiel dar.
Frederik Baldus war ein raumgreifender Orest mit lyrisch heldischem Bariton. Trotz seiner weich lyrischen Tongebung gelangen ihm dramatische Attacken, so dass er den furchteinflößenden Rächer glaubwürdig darstellte. Durch seine Rollenidentifikation machte er insbesondere die Wiedererkennungszene zu einem großen Moment der Vorstellung.
Sotiris Charalampous war ein Playboy, der die Rolle des Aegisth mit italienischem Spinto und unglaublich warmer und voluminöser baritonaler Tongebung und prächtigen hohen Tönen füllte. Eine beglückende Leistung.
Die Mägde Denise Seyhan, Oleksandra Diachenko, Anna Werle, Nataliia Ulasevych, und Natallia Baldus erinnerten an Macbeth Hexen und glänzten mit prächtigem stimmlichen Einsatz.
Grandios wurde musiziert und gesungen. Dies und die szenische Umsetzung wurde vom Publikum frenetisch gefeiert. Eine großartige Leistung, die in ihrer Wucht jedem großen Opernhaus zur Ehre gereicht hätte. Michael Stange/ 24.05.2024
.
.
Schostakowitsch an der Oper Leipzig: Ein Fabergé-Ei und andere Rätsel. Den russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch hat die Musikstadt Leipzig seit Jahrzehnten im Visier: 1965 inszenierte Joachim Herz am Opernhaus der Stadt Katerina Ismailowa als DDR-Erstaufführung. Es handelte sich um die auf Geheiß von Stalin vorgenommene Umarbeitung der Urfassung Lady Macbeth von Mzensk, uraufgeführt in Leningrad 1934, womit diese inhaltlich und in ihrer musikalischen Substanz deutlich entschärft wurde.
Die neue Version kam 1963 in Moskau heraus, wird aber heute kaum noch aufgeführt. So zeigte auch die Oper Leipzig als letzte Premiere der Saison das Original des Komponisten – quasi als Vorbereitung auf das bevorstehende Schostakowitsch-Festival Leipzig 2025.
Die Neuproduktion von Francisco Negrin ist optisch spektakulär dank des aufwändigen Bühnenbildes von Rifail Ajdarpasic und der historisierenden, aber auch symbolträchtigen Kostüme von Ariana Isabell Unfried. Der Vorhang in der Manier konstruktivistischer Malerei eines Kasimir Malevich nimmt einzelne Elemente des Bühnenaufbaus vorweg: So ist das russische Wort „Muka“ in kyrillischen Buchstaben zu lesen, was mit „Pein“, aber ebenso mit „Mehl“ zu übersetzen ist. Der Schauplatz mit seinen steilen Treppen und einer Empore zeigt dann auch eine Unzahl vom Mehlsäcken, aufgestapelt oder in der Luft hängend. Auch die Mühlräder auf dem Vorhang finden sich auf der Bühne wieder, ebenso ein Ei, das zunächst nur in seiner ovalen Form zu erkennen ist. In der Mühle aber thront es als prachtvoll verziertes Fabergé-Juwel in Blau/Gold in der Höhe und gibt das erste Rätsel der Aufführung auf. Ist es – einst Sammlerstück des russischen Zaren Alexander III. – ein heiliges Kultobjekt gleich einer Ikone, das Symbol für erträumten Reichtum oder für die ersehnte Fruchtbarkeit, welche dem Paar Katerina und Sinowij nicht vergönnt war? Katerina wird das Teil später zertrümmern und damit den Zerfall des Systems verdeutlichen, wie dieses auch im sich mehr und mehr auflösenden Bühnenaufbau gezeigt wird.

Schostakowitschs „Lady Macbeth von Msenk“ in Leipzig/Szene/Foto Kirsten Nijhof
Die Arbeiter in der Fabrik tragen Kleidung aus grobem Sackleinen mit dem Aufdruck „Muka“, laufen quasi als personifizierte Mehlsäcke herum. Drastisch karikiert mit Rüsselnasen und Schweinsohren sind die Polizisten in der Wache, die von oben herunter fährt. In ihren blauen Uniformjacken hampeln die Polizisten wie Marionetten in grotesker Überzeichnung umher. Bei der Hochzeit von Katerina und Sergej sieht man neben dem eleganten weißen Brautkleid und dem schnittigen weißen Anzug des Bräutigams Hochzeitsgäste bei der Polonaise mit schrill bunten Kopfbedeckungen. Dazu bildet der Beginn des letzten Aktes einen schmerzenden Kontrast, wenn die Gefangenen im Straflager sich in ihren grauen Lumpen mühsam vorwärts schleppen. Am Ende sorgt der Regisseur für weitere Irritationen, wenn Sonjetka nicht von Katerina, sondern einem Unbekannten in die Tiefe des Flusses gestoßen wird und die Gefangenen gemeinsam mit der Titelheldin untergehen, statt weiterzuziehen nach Sibirien.
Grandios ist die musikalische Realisierung des anspruchsvollen Werkes. Der Chor und der Zusatzchor der Oper Leipzig (Einstudierung: Thomas Eitler-de Lint) singen mit überwältigender Fülle und Präzision. In der Mühle sind sie auf den Treppen und der Empore statuarisch postiert und zu Einheitsgesten mit ausgestreckten oder verschränkten Armen angehalten. Ergreifend sind ihre klagenden Gesänge am Ende. Ähnlich überzeugend ist die Leistung des Gewandhausorchesters Leipzig unter Leitung des italienischen Dirigenten Fabrizio Ventura. Er versteht es fast durchgängig, Bühne und Graben zu koordinieren, ohne die Klangmassen der Komposition zu negieren. Hämmernde, schneidende Akkorde, geschärfte Dissonanzen, schmerzende Aufschreie stehen im Kontrast zu Tönen von filigraner Zartheit oder sanft wiegendem Melos. In der Beischlaf-Musik wird das Orchester noch von Bläsern aus den beiden Seitenlogen verstärkt. Plakativ ist diese Szene der Kopulation in rotes Licht (Michael Röger) getaucht.
Ingela Brimberg profiliert die Titelrolle mit staunenswerter Kondition. Ihr strenger, wuchtig ausladender Sopran mit zuweilen greller Höhe meistert die Partie souverän und findet in den Liebesszenen auch zu blühendem Klang. Die Sehnsucht und das Verlangen der Figur vermag sie glaubhaft zu übermitteln trotz der etwas biederen Ausstrahlung mit blondem Haarkranz und nicht unbedingt attraktiven Körperlichkeit. Auch ihr Liebhaber Sergej in Gestalt von Brenden Gunnell ist optisch nicht unbedingt der Typ des unwiderstehlichen Verführers, singt aber mit potentem Tenor, während Matthias Stier als Katerinas Ehemann Sinowij matt tönt und damit dem Charakter seiner Figur entspricht. Randall Jakobsh als Katerinas Schwiegervater Boris ist mit ersticktem, verquollenem Bass ein Schwachpunkt der Besetzung.
In den Nebenrollen überzeugen Franz Xaver Schlecht als Polizeichef mit markantem Bassbariton, Nora Steuerwald als gebührend leichtfertige Sonjetka mit jugendlichem Mezzo, der Tenor Dan Karlström (Der Schäbige) mit einer Paradenummer als betrunkener Hochzeitsgast sowie mit profunden Bässen Ivo Stanchev als zwielichtiger Pope und Peter Dolinsek als menschlicher Alter Zwangsarbeiter. Das Premierenpublikum am 25. Mai 2024 honorierte die Leistungen des gesamten Ensembles herzlich und anhaltend. Bernd Hoppe
.
.
Albéric Magnars Guercoeur in Straßburg: Das also soll das Paradies sein? Ein dunkler, fast schwarzer Raum, ein Wartezimmer im Jenseits, wo die Schatten das Reich der Vérité preisen. Obwohl sich Guercoeur bereits seit zwei Jahren hier befindet, sehnt er sich nach dem Leben und seiner Frau Giselle zurück. Die Schatten einer Frau, eines jungen Mädchens und eines Dichters, die im Paradies Ruhe und Frieden gefunden haben, können ihn nicht umstimmen. Der Ritter, der sein Volk von einem Tyrannen befreite und als Konsul handelte, will sein Werk vollenden. Die Gottheiten Beauté, die Schönheit, Bonté, die Güte, und Souffrance, das Leiden, die die majestätische Vérité wie eifrige Tanten umkreisen (Kostüme: Ursula Renzenbrink), überzeugen sie, Guercoeur seinen Wunsch zu erfüllen. Albéric Magnards Guercoeur dürfte eine der wenigen Opern sein, die nach dem Tod der Titelgestalt beginnt bzw. dessen Rückkehr auf die Erde intensiv begleitet.

Magnards „Guercoeur“ in Straßburg/Foto Klara Beck
Guercoeur darf nach dem Willen seines Schöpfers Albéric Magnard in das Leben zurückkehren, um Versäumtes nachzuholen. Vielleicht lag ein solcher Stoff irgendwie in der Luft, denn kurz nach Magnards 1897-1901 entstandener Tragédie lyrique hat Franz Molnar 1909 seine Vorstadtlegende „Liliom“ geschrieben, in der er den Titelhelden für einen Tag auf die Erde zurückkehren lässt; das Musical hat das Thema („Carousel“) weitergesponnen und der Film sich seiner gerne bemächtigt. Guercoeur kehrt also auf die Erde zurück und erkennt im „Les illusions“ überschriebenen ersten Teil des zweiten Akts, dass Giselle sich mit seinem Vertrauten Heurtal zusammengetan hat. Auf Drängen Giselles vergibt Guercoeur ihr den Treuebruch. Schwerer wiegt der Verrat des einstigen Zöglings, der den Rufen des Volkes „Wir haben genug von der Freiheit“ folgt und die von Guercoeur initiierte Republik in eine Diktatur umwandeln und sich zum Diktator küren lässt. Vergebens ruft Guercoeur die Meute zur Besinnung auf, „Tötet doch mich, tötet die Freiheit“. Sie stürzen sich auf ihn. Der tödlich verwundete bittet La Verité um Verzeihung für seinen Hochmut und stirbt.
Stéphane Degout ist in jedem Moment großartig. Es gelingt ihm, den steifleinenen Zeilen und dem sperrigen Charakter mit seinem hochpräsenten, charaktervoll profunden Bariton und der durchgehend fesselnd präzisen Artikulation zum Leben zu erwecken. Nach der Dunkelheit des Paradieses zeigen Christof Loy und Bühnenbildner Johannes Leiacker die Erde als hellen Gegenentwurf zum Paradies mit einer schmalen, spitzwinkeligen Kammer zwischen heller Vorder- und dunkler Rückseite, in der man das arkadisch-paradiesische Bild „Paysage avec figures de danse“ des nach seiner lothringischen Herkunft genannten Barockmalers Claude Lorrain, eigentlich Claude Gellée, erblickt. Beim Aufruhr des Volkes steigen ein paar Männer auf die Stühle. Mehr braucht es für diesen vergessenen Dreiakter nicht, der jetzt an der Straßburger Opéra National du Rhin zu überhaupt erst dritten Mal auf einer Bühne gezeigt wurde.

Magnards „Guercoeur“ in Straßburg/ Foto Klara Beck
Das ist merkwürdig. Hatte sich doch 1988 Michel Plasson mit einer überzeugenden EMI-Einspielung für Magnard und seinen Helden mit dem aus Krieg und Herz, Guerre und Coeur, zusammengesetzten Namen stark gemacht. Doch folgenlos. Erst 30 Jahre später hatte Osnabrück 2019 die deutsche Erstaufführung gewagt, die einer sensationellen Wiederentdeckung gleichkam.
Der Komponist mit dem höchst seltenen Nibelungen Namen Albéric, also Alberich, wurde 1865 als Lucien Denis Gabriel Albéric Magnard in Paris geboren. Der einflussreiche und wohlhabende Vater Francis Magnard war ab 1879 Redakteur und später Herausgeber des Le Figaro, wo Albéric eine Plattform für seine Musikkritiken fand. Nach dem Abschluss des Jurastudiums studierte Magnard am Conservatoire bei Dubois und Massenet, später bei d’Indy und schloss eine enge Freundschaft mit Guy Ropartz. Als 21jähriger erlebte er in Bayreuth Tristan und Isolde, 1890 schrieb er anlässlich der ersten kompletten Aufführung der Troyens in Karlsruhe dies sei das Hauptwerk der französischen Oper des 19. Jahrhunderts. Durch das Vermögen des Vaters war er nach dessen Tod 1894 finanziell abgesichert und unabhängig, musste keine Kompromisse eingehen, hatte jedoch Probleme, seine Werke, die er ab 1902 selbst zu drucken begann, zur Aufführung zu bringen. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs schickte Magnard seine Frau und seine beiden Töchter an einen sicheren Ort, während er auf seinem Anwesen Manoir de Fontaines in Baron (Oise) einem deutschen Trupp entgegentrat und am 3. September 1914, quasi am Vorabend der Schlacht an der Marne, in den Flammen des Hauses umkam. Das Feuer vernichtete auch die zwei Akte von Guercoeur, die der treue Ropartz, der in Nancy bereits 1908 den dritten Akt aufgeführt hatte, aus dem Gedächtnis rekonstruierte. Erst 1931 erfolgte in Paris die posthume Uraufführung der gesamten Oper.

Alberic Magnard/Wikipedia
Sinn- und Erlösungssuche verbinden sich in Guercoeur zu einer spröden Bühnenaktion im Nachhall spätbarocker Allegorien und Mysterienspiele, in der Stimmungen und Gefühle in den breiten sinfonischen Teilen großen Raum einnehmen. Hinzutritt eine fast religiöse, französisch katholische Anmutung, wie sich noch bei Messiaen zu spüren ist. Der Bezug zu Parsifal scheint nicht nur durch die Anlage der beiden kontemplativen Außenakte und des dramatischen Mittelteils sowie der mystischen Chöre offenkundig, die sublime Musik- und Textausdeutung erinnert an den Berlioz der Nuits d’été und Les Troyens, man hört und spürt Chaussons theatralisch ebenso blutleeren Le roi Arthus, Debussy und Dukas, auch Bruckner, und ahnt den anbrechenden Expressionismus. Auf jeden Fall ist die Musik von großer Intensität und Überzeugungskraft und im dritten Akt, der wie ein musikalisch illustriertes Heiligenbild wirkt, von ausgewählter Schönheit. In einem weiten, melodiös magischen Hymnus feiert Vérité – bei zeitweise erhellten Zuschauerraum – Liebe und Freiheit, „“L’homme, enfin conscient de sa tâche, doit grandir dans l’amour et dans la liberté. La fusion des races, des langages, lui donnera le culte de la paix“.

Postkarte mit der Ruine des Hauses Albéric Magnards in Baron (Oise); 1914 wurde er von deutschen Soldaten angegriffen und er erschoss zwei davon; aus Rache zündeten die anderen sein Haus an, und er kam in den Flammen um/Wikipedia
In den weit und kraftvoll ausschwingenden Linien einer französischen Brünnhilde – Plasson hatte dafür Hildegard Behrens ausgesucht – entfaltet Catherine Hunold mit seidig schönem Sopran, der in den kraftvoll dramatischen Steigerungen noch Eleganz und wohlige Sanftmut bewahrt, eine paradiesische Zukunft, die auch ein wenig an die Visionen von Smetanas Libussa erinnern. An den Schlussgesang schließen sich noch das seltene Beispiel eines Quartetts der vier Frauen, die fernen Chöre und das Schlusswort „Espoir“, Hoffnung, an. Eugénie Joneau als Bonté, Gabrielle Philiponet als Beauté und vor allem die stimmlich sprühende Altistin Adriana Bignagni Lesca als Guercoeurs ständige Begleiterin Souffrance geben die Gottheiten als vornehm gekleidete Gesellschaftsdamen des frühen 20. Jahrhunderts. Antoinette Dennefeld singt die Giselle mit energiegeladenem Mezzosopran, der vielversprechende Julien Henric setzt seinen markanten, zu heldischen Steigerungen fähigen Tenor als Heurtal vorteilhaft ein. Das Paradies versinkt im gänzlichem Dunkel, über dem Loy und Leiacker einen kitschig schönen Sternenhimmel setzen.
Der Begeisterung ist kein Ende. Ingo Metzmacher, der die Partitur an sich drückt, wird für die großartige Koordination himmlischer und irdischer Personen und mystischer Chöre und die sublime Ausdeutung mit dem Orchestre philharmonique de Strasbourg zu recht gefeiert. Rolf Fath
.
.
Hans Sachs an der Musikalischen Komödie Leipzig: Er war Schuster und Poet zugleich, der Nürnberger Hans Sachs. Bei seinem Namen denkt man unweigerlich an Richard Wagners Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“, die 1868 in München uraufgeführt wurde. Es war der größte Erfolg Wagners zu Lebzeiten, nach dem „Rienzi“. Dabei hat Albert Lortzing seine gleichnamige Komische Oper „Hans Sachs“ bereits 28 Jahre zuvor in Leipzig anlässlich des Johannes-Gutenberg-Jubiläums herausgebracht, das 1840 in Leipzig zur 400-Jahr-Feier der Erfindung der Buchdruckerkunst mit großem Aufwand gefeiert wurde.
Aber schon nach kurzem, hoffnungsvollen Erfolg fiel das Werk der Vergessenheit anheim. Wagner kannte es natürlich, und hat ihm einige Namen (am deutlichste erkennt man in Görg des späteren David) und Motive entnommen, auch wenn er das Stück dramaturgisch völlig anders gestaltete und ihm eine gesellschafts- wie kunstutopische Stoßrichtung gab, die Lortzing fremd war. Bei Lortzing stehen Liebe, Poesie und Vaterland im Vordergrund: „Das Herz allein schafft Freud‘ und Pein“, „Lieb‘ ist die höchste Poesie“ oder „Der Liebe Glück, das Vaterland!“ sind die immer wieder besungenen Parolen des Werks, das ehemalige Reichsherrlichkeit und vorkapitalistische Idyllik beschwört.
Das Libretto von Albert Lortzing (das auf der Vorlage des gleichnamigen Schauspiels von Johann Ludwig Deinhardstein basiert), kommt reichlich bieder und nicht selten rührselig daher. Lortzing hat es zusammen mit den Bühnenautoren Philipp Reger und Philipp Jakob Düringer verfasst.

Lrtzings „Hans Sachs“ an der Musikalischen Komödie Leipzig/Szene/Foto Kirsten Nijhof
Der Unterschied zwischen Wagner und Lortzing ist eklatant: Wagner ging es um nichts weniger als die Auseinandersetzung von alter und neuer Musik, um nicht zu sagen „Zukunftsmusik“. Mit den „Meistersingern von Nürnberg“ –schrieb Wagner eine Komische Oper, in deren altnürnbergischer Renaissancedekoration er ein modernes Künstlerdrama von geradezu programmatischem Charakter versteckte. Hans Sachs ist darin die humanistisch idealisierte Integrationsfigur einer „ästhetischen Weltordnung“, wie Udo Bermbach es einmal sehr treffend ausdrückte. Mit ihr redet Wagner einer demokratischen Gesellschaft das Wort, in der Natur und Kultur, Kunst und Leben versöhnt werden. Die „Meistersinger“ enthalten darüber hinaus die (griechisch inspirierte) Utopie einer das Leben anleitenden, das Alte mit dem Neuen versöhnenden Kunst auf dem Theater. Walther von Stolzing ist der Anwalt des Neuen in der Musik. Nichts davon in Lortzings eindimensionaler Dramaturgie, die vergleichsweise nur sehr eingeschränkt dem Geist der Revolution huldigt. Seine anderen Bühnenwerke sind in ihrer vormärzlichen Sozialkritik deutlicher und radikaler.
Bei Lortzing geht es vor allem um die durch Intrige bedrohte Liebesgeschichte des jugendlich-jungen (!) Hans Sachs. Der Schuster und Meistersänger ist verliebt in Kunigunde, die Tochter des Goldschmieds Steffen, der zugleich auch der Bürgermeister von Nürnberg ist. Doch Kunigunde ist bereits dem eitlen Augsburger Ratsherrn Eoban Hesse versprochen, den Steffen als Schwiegersohn bevorzugt. In einem Sängerwettstreit treten die Rivalen gegeneinander an. Trotz der Gunst des Volkes unterliegt Sachs und wird aus der Stadt vertrieben. Meister und die Ratsherren lieben und achten ihn (im Gegensatz zu Wagners Stück) nicht. Erst das Auftreten und Eingreifen des Kaisers als „Deus ex machina“ rehabilitiert und nobiliert Sachs als Meistersänger. Er erhält nicht nur mit allen Ehren seine Bürgerrechte der Stadt Nürnberg zurück, sondern darf sich auch mit Kunigunde zum glücklichen Lebensbund vereinen.
Die Liebe des Schusterpoeten zur Tochter des wohlhabenden, gesellschaftlich arrivierten, Goldschmieds und Bürgermeisters trifft auf dessen und der Nürnberger Ehrbaren strikte Ablehnung. Dieser Konflikt ist Anlass für sentimentalische Ohrwurmmelodik, er wird aufgelöst durch die Enthüllung einer dreisten Intrige (Görg stiehlt Sachsens Meisterlied), und ist die Bestätigung feudal-imperialen Sozialstrukturen (die Bürgergesellschaft als Untertanenkollektiv).
Bei aller Verehrung Albert Lortzings: Sein „Hans Sachs“ bleibt – entgegen anderslautender Wertschätzungen mancher Lortzingspezialisten – weit hinter der dramaturgischen wie melodischen Originalität und raffiniert kompositorischen Musikalität von „Zar und Zimmermann“, „Wildschütz“, „Casanova“ oder „Regina“ zurück. Natürlich gelingen dem versierten Theatermann Lortzing handwerklich gediegene Arien, Terzette, Quartette, Ensembles und effektvolle Chöre. Aber die Musik zündet nicht wirklich, obwohl Tobias Engeli das Orchester der Musikalischen Komödie ordentlich anzufeuern weiß und sein Bestes gibt, der Oper interessante Klänge und Harmonien zu entlocken. Gewiss, man horcht immer wieder auf, aber verglichen mit dem „Wildschütz“, einer geradezu mozartisch angehauchten Buffa, die handwerklich zum Besten gehört, was die Deutsche Komische Oper des 19. Jahrhunderts aufzubieten hat, die aber auch eine erotische Komödie turbulenten Überkreuzspiels einer an Irrungen und Wirrungen reichen Handlung ist, segelt Lortzings „Hans Sachs“ recht brav im Fahrwasser biedermeierlicher Lustspiel-Betulichkeit.
Dass die – an sich erfreuliche – Leipziger Ausgrabung des Stücks langweilt, liegt weniger am Dirigenten. Auch nicht an den durchweg überzeugenden Solisten (Hans Sachs – Justus Seeger; Kunigunde – Mirjam Neururer; Görg – Adam Sánchez; Cordula – Sandra Maxheimer; Eoban Hesse – Andreas Rainer: Meister Steffen – Milko Milev und Kaiser Maximilian I. – Christian Henneberg): Es ist die Regie, die in karnevalsbunter Kinderzimmerfröhlichkeit und mit kostümlichem Durcheinandereiner von Pappzylinder-, und Zipfelmützen-Spaßigkeit (Spießigkeit) das Stück verharmlost und entortet. Zwar wird am Beginn der etwa dreistündigen Aufführung der Schriftzug „Nürnberg“ auf die Rückwand des blauen Kastens projiziert, in dem alle drei Akte spielen. Doch es ist ein reines Lippenbekenntnis.
Der Leipziger „Hans Sachs“ spielt irgendwo und nirgendwo auf, über, an und zwischen blauen Bänken und Tischen, Podesten und Treppchen, die von den Akteuren fleißig hin—und hergeschoben werden. Auch eine blaue Brechtgardine, die sich zum Vorhang aufbläht oder aufleuchtende Neonwölkchen und gelegentliche Auftritte aus dem Zuschauerraum machen die putzige, (handwerklich nicht ungeschickte) Inszenierung der jungen Leipziger Regisseurin Rahel Thiel nicht überzeugender. Am Gelungensten ist noch ihr (freilich etwas holzhammerhafter) Regie-Einfall, einen kleinen geflügelten Amor, der sich am liebsten Huckepack (vor allem von Hans Sachs) durch die Handlung tragen lässt, einzufügen. Doch dass sie allerhand diverse Texte und Liebeslieder auf die Bühne projiziert, ja sogar rezitieren lässt, verwässert das Stück unnötig und verbessert es nicht. Es wird so noch langatmiger. Das eklatanteste Eigentor der Produktion ist allerdings der absurde Einfall, Sachsens Schlussansprache aus Wagners „Meistersingern“ in Wort und Ton einzufügen. Das ist denn doch eine andere musikalische Liga! Diese unfaire Konfrontation zweier grundverschiedener, ja unvergleichlicher musikalischer Welten bricht der Aufführung das Rückgrat. Das hat Lortzing nicht verdient (14. 04. 24). Dieter David Scholz
.
.
Der Schwanenritter in der Mönchskutte: Lohengrin-Debüt von Michael Spyres an der Straßburger Opéra National du Rhin. Gewiss war es eines der mit Spannung erwarteten Debüts der Saison. Michael Sypres sang seine erste Wagner-Partie, den Lohengrin, dem Schlag auf Schlag der Erik und schließlich im Sommer der Siegmund auf dem Grünen Hügel folgen sollen. Für das Lohengrin-Debüt hatte er sich das ihm durch die Berlioz-Aufnahmen unter John Nelson vertraute Straßburg ausgesucht, wo er möglicherweise hoffte, in idyllischer Abgeschiedenheit unter dem Radar der Öffentlich arbeiten zu können. Jeder wollte dabei sein. Der Erfolg war sicher.

Michael Spyres als Lohengrin in Straßburg/Foto Klara Beck
Spyres hatte mit seiner Aufnahme mit Arien von Wagner und Zeitgenossen vorbildliche Vorarbeit geleistet. Zweifellos kann Spyres seinen Schwanenritter und seine weiteren Wagner-Absichten auch auf größeren Bühnen präsentieren als im historischen, in etwa der Größe des Weimarer Hoftheaters entsprechenden historischen (1821) Gebäude der Opera national du Rhin. Es ist nicht ohne Reiz, dass der neben seinen Kollegen gedrungen wirkende Sypres in der Inszenierung des als Opernregisseur noch kaum aufgefallenen vierzigjährigen Florent Siaud nicht als strahlender Ritter erscheint, sondern als dunkler Fremder in einer Art Mönchskutte, der zögernd seine Kapuze abstreift und sie wieder überzieht, wenn er am Ende im Dunkel verschwindet. Die strahlende Silberrüstung trägt indes der junge Gottfried von Brabant, den seine Schwester Elsa – eine hübsche Idee – auf das Sternbild Cygnus aufmerksam macht, das sie während des Vorspiels gemeinsam durch das Fernrohr auf dem nächtlichen Himmel suchen. So verfällt sie, als sie in Ketten vor des Königs Gericht gebracht wird, irgendwie auf den Schwanenritter, den sie an dem Zeichen, die sie beide auf den Armen tragen, sofort als ihr Gegenstück erkennt.
Michael Sypres singt „Nun sei bedankt“ mit der ebenmäßig schönen Linie, die man bei ihm schätzt, dunkel abgetönt, sicher in den Übergängen und Höhen. Ein kleines Vibrato deutet in „Wenn ich im Kampfe für dich siege“ Emotionen und Anteilnahme aus. Dieser Lohengrin ist gleichermaßen klug aufgebaut, durchgehend kraftvoll, souverän und sicher gesungen, vielleicht ein wenig zu gleichförmig, zwar verfügt Sypres über ein zartes Piano und erzeugt auch mit halber Stimme einen festen und tragfähigen Ton, doch nicht nur in der Brautgemacht-Szene wünscht man sich in „Das süße Lied verhallt“ die erwähnte Süße, in „Atmest du nicht“ dazu eine poetische Duftigkeit und in der Gralserzählung vielleicht einen geheimnisvoll entrückteren Ton. Dagegen sind die heldischen und legatogeschmeidigen Phrasen kein Problem, wie Spyres bis auf kleine Schwächen am Ende der Gralserzählung überhaupt die heroischen und kraftvollen Passagen, „Höchstes Vertraun“, bewundernswert meistert.
Spyres sing ein fabelhaftes Deutsch, das sinnhafter klingt als bei Timo Riihonen, der in diesem Fach zuhause ist und einen vor allem höhenstarken Heinrich gibt. Tatsächlich am Ort der Uraufführung in Weimar hatte Johanni van Oostrum in den frühen Jahren ihrer Karriere bereits die Elsa gesungen. Die angekündigte Indisposition (13. März 2024) zeigte sich an den scharfen Höhen, doch ab dem zweiten Akt und vor allem im Brautgemacht sang sie mit lyrischer Innigkeit und jugendlich klarem Ausdruck. Ähnliche Wechselbäder, wie sie ihrem Mann Telramund (mit knorrigem Bariton Josef Wagner) als kühle Herrin und Macherin im Hintergrund, sinnlich lodernder Vamp und hexische Seherin, die Raben vom Himmel holt, verursacht, durchläuft Martina Serafins Ortrud stimmlich mit ungestützt entgleisender Schärfe, wüster Mittellage und dann wieder absolut siegesgewiss breitem Sopran.

Michael Spyres und Johanni van Oostrum im Straßburger „Lohengrin“/ Foto Klara Beck
Auffallend, der mit viel Kraft, doch etwas knödelig gesungene Heerrufer von Edwin Fardini. Die Chöre aus Straßburg und von der Opéra Angers Nantes drängeln sich auf der ohnehin engen Bühne, die Romain Fabre mit Stufen vollgebaut hat, und setzten handfest dramatische Akzente, während Aziz Shokhakimov, der usbekische Chef des Orchestre Philharmonique de Strasbourg, in den ersten beiden Akten auf gemäßigte Tempi und seelenvolle Innenschau achtete und – wie kürzlich bei seinem Debüt an der Bayerischen Staatsoper bei Pique Dame – wenig gestaltend eingriff, aber im dritten Akt das Drama mit ungemeiner Wucht vorandrängte. Bei Regisseur Romain Siaud begegnen sich verwandte Seelen, hellenistische Rückgriffe und große Politik in Gestalt der sich ideal ergänzenden Elsa und Lohengrin, der Tempel und Oasen im Umfeld des Lohengrin und des klotzigen Marmorsaals, in dem König Heinrich vor einer imperialen Skulptur am breiten Tisch Gericht hält. Die angekündigte politische Dimension des Stückes verschwand vor romantisch dunklem Himmel und suggestiven Videos, die nicht alle Beteiligten vorteilhaft einfangen. Rolf Fath
.
.
Pique Dame an der Deutschen Oper Berlin: Der renommierte britische Regisseur Graham Vick hatte die Grundlagen für eine Neuinszenierung von Tschaikowskijs Pique Dame an der Deutschen Oper Berlin erarbeitet, bevor er überraschend im Juli 2021 verstarb. Nun hat der Engländer Sam Brown die Arbeit nach der Konzeption seines Mentors vollendet und zur Premiere gebracht (9. März 2024). Stuart Nunn nutzt für seine Ausstattung Szenen aus Jakow Protasanows Verfilmung von Puschkins Roman aus dem Jahre 1916 in Schwarz/Weiß, der auch die Vorlage für Modest Tschaikowskys Libretto bildete. Schon auf dem Vorhang sind in einem verzierten Bilderrahmen Motive aus dem Film zu sehen: eine Spielkarte, Hermanns Gesicht mit aufgerissenen Augen, Geldscheine, eine Pistole… Mehrere hohe Wandelemente, die sich drehen und einen geschlossenen Raum ergeben können, bilden die Bühnenkonstruktion – in der ersten Szene des Sommergartens noch mit einem großen, goldverzierten Gittertor und Geländern geschmückt, was ein konventionelles, aber stimmiges Bild ergibt. In der Folge wechselt die Optik stilistisch, zeigt Räume in Ausschnitten, die von Neonröhren eingefasst werden, welche auch aufblitzen oder flackern können, was beispielsweise zur Illustration des Gewitters dient. Mehrfach kommt die Unterbühne zum Einsatz – die entstehenden Vertiefungen machen vor allem in der Szene am Newa-Kanal Sinn.
Der Regisseur erzählt die Geschichte weitgehend nach dem Libretto, wertet allerdings die alte Gräfin auf, indem er ihr mehr Auftritte zugesteht, als in der Vorlage vorgesehen. Im Sommergarten und auf dem Maskenball erscheint sie in prachtvoller barocker Robe, in Lisas Schlafzimmer im Nachthemd und Morgenmantel und nach dem Ball in einem raffinirten schwarzen Seidengewand. Darin wirkt sie durchaus verführerisch und scheint auch bereit zu sein für ein erotisches Abenteuer mit Hermann. In seiner Traumszene sieht man sie leibhaftig in der Baracke, seltsamerweise in Lisas hellblauem Ballkleid, um ihm das Geheimnis der drei Karten zu verraten. Schließlich ist sie auch im Spielsalon präsent, wieder im schwarzen Gewand. Fast inszeniert Brown eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Figuren, die darin endet, dass Hermann nach dem tödlichen Schuss in ihren Armen stirbt.

Tschaikowskijs „Pique Dame“ an der Deutschen Oper Berlin/ Szene mit Doris Soffel als Gräfin/Foto Maurcus Lieberenz
Eine solch konzeptionelle Anlage braucht eine Interpretin von Format, die nach Absage von Hanna Schwarz in Doris Soffel gefunden worden war. Mühelos avanciert die Mezzosopranistin mit ihrer mondänen Erscheinung zum Mittelpunkt des Geschehens. Herrisch weist sie ihr Personal zur Ordnung, mit leidenschaftlichem Verlangen drängt sie Herrmann auf die Couch, mit starker Aura beschwört sie in ihrem Chanson eine vergangene Welt herauf, erzeugt eine Spannung, wie sie an diesem Abend sonst kaum zu erleben war. Sehr differenziert singt sie die Verse – fahl, wehmütig, sehnsuchtsvoll, begleitet vom kunstvollen Spiel ihrer Hände, die letzten Worte in faszinierend tranceartiger Stimmung. Erschauern macht ihr höhnisches Gelächter nach der Offenbarung des Kartengeheimnisses, während sie sichtlich betroffen zu sein scheint über den tragischen Tod dieses Mannes.
Martin Muehle war das stimmliche Ereignis der Premiere mit einem Tenor von unerschöpflichen Reserven, welche ihm erlaubten, die gefürchtet strapaziöse Partie ohne Ermüdungserscheinungen durchzustehen. Die Wucht seines Gesangs, die metallische Höhe und die Emphase im Ausdruck adelten seine singuläre Interpretation, die an allergrößte Vorbilder denken lässt. Wunderbar sein Liebesbekenntnis für Lisa („Verzeih, du himmlisches Geschöpf“), fiebrig die erregte Auseinandersetzung mit ihr am Kai („Vergessen sind die Qualen“), überwältigend die existentielle letzte Arie im Casino („Was ist unser Leben?“). Daneben enttäuschte Sondra Radvanovsky als Lisa, deren Sopran einen klirrenden Beiklang aufwies und in der Höhe viele grelle Töne hören ließ. Der Schluss der großen Arie und das nachfolgende Duett mit Hermann waren eine tour de force von schrillem, peinigendem Gesang. Vom Regisseur zu einem neurotisch verklemmten, verängstigten Geschöpf verzeichnet, ist sie anfangs auch in ihrem Sommerkleid mit Baskenmütze und Brille eine ungewohnte Erscheinung, wird erst in der hellblauen Ballrobe mit goldenen Ornamenten zu einer Person von Rang. Dass sie nach ihrem Freitod im Spielsalon im weißen Hemd aufgebahrt liegt wie auf einem Seziertisch, bedeckt mit Geldscheinen, gehört zu den Merkwürdigkeiten der Inszenierung. Diese gipfeln auf dem Ball, wo die gesamte Szene in glutrotes Licht getaucht ist. Linus Fellborn hatte schon im ersten Bild mit seinem willkürlichen Licht-Design irritiert. Beim Ball sorgt eine Diskokugel für Geflimmer, eine handfeste körperliche Attacke auf Zarin Katharina für Verwunderung, während das Opernballett der Deutschen Oper in Korsagen und Strapsen die exaltierte Choreografie von Ron Howell, dem Witwer Graham Vicks, absolvieren muss. Das Schäferspiel ist gestrichen, was Kuris Tucker als Pauline nach ihrem Duett mit Lisa und der melancholischen Romanze im 2. Bild die Möglichkeit für einen weiteren Auftritt nimmt. Thomas Lehman als Fürst Jeletzkij aber darf eine der schönsten Arien des Werkes singen („Ich liebe Sie“) und tut dies mit Empfindsamkeit und Wohllaut. Der andere Bariton, Lucio Gallo als Tomskij, kann mit der Ballade von den drei Karten („Einmal in Versailles“) und dem auftrumpfenden Lied „Wenn die lieben Mädchen“ imponieren.
Die Mitglieder des Chores der Deutschen. Oper Berlin (Einstudierung: Jeremy Bines) sind szenisch und gesanglich stark gefordert. In der Eingangsszene erscheinen sie als überspannte Damen und Herren der oberen Gesellschaft mit modischen Hüten, kostbaren Pelzen und Sonnenbrillen, während uniformierte Knaben des Kinderchores (Christian Lindhorst) zu ihrem plärrenden Gesang einen Obdachlosen mit Maschinengewehren bedrohen und körperlich malträtieren. Auf dem Ball ergehen sie sich als Gäste in wollüstigem Treiben samt homoerotischen Aktionen. Alle ihre Auftritte erfüllen sie glänzend und berühren am Ende ungemein mit ihrem Trauergesang „Herr, verzeih ihm“. Erfreulich war das Wiedersehen mit Sebastian Weigle, der mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin Tschaikowskijs reiche Komposition in ihrer Vielfalt und Farbigkeit beeindruckend auffächerte. Ein zwiespältiger Abend – vom Premierenpublikum dennoch mit reichem Beifall bedacht. Bernd Hoppe
.
Szymanowsky König Roger am Anhaltinischen Theater Dessau: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sah sich der polnische Komponist Karol Szymanowski einer tiefgreifenden Orientierungslosigkeit in einem Europa der Revolutionen, der Kriege und der kulturellen Glaubenskämpfe gegenüber. Reisen in den Mittelmeerraum wandten seinen Blick dem mediterranen Fluidum des 12. Jahrhunderts zu, das ihm Bilder rettender Ideenentwürfe entgegensetzte. Der Normannenkönig Roger wurde damals Herrscher von Sizilien und residierte in Palermo. Die Geschichte der Oper ist fiktiv, doch zentrale Personen und Motive bilden die kulturell-religiöse Gemengelage des damaligen Europa ab, ebenso wie die Cappella Palatina in Palermo – Schauplatz des ersten Aktes – die von byzantinischen, normannischen und arabischen Stilelementen geprägt ist. König Roger ist konfrontiert mit einer beunruhigend starken Bewegung im Volk, ausgelöst durch einen reisenden Propheten, den »Hirten«, der den sinnen- und rauscherfüllten Kult des Dionysos predigt. Roger und sein gelehrter arabischer Berater Edrisi halten dagegen. Rogers Lebensgefährtin Roxane läuft zum Hirten über, der sich schließlich als Gott Dionysos selbst zu erkennen gibt, umgeben von einer Schar wild tanzender Bacchanten. Nach langer Gegenwehr ist Roger bereit, dem Beispiel seiner Frau zu dem Hirten zu folgen und sich seinen Gefühlen hinzugeben. Erfüllt blickt er der aufgehenden Sonne entgegen.
Das Werk wurde erstmals am 19. Juni 1926 in Warschau uraufgeführt. Szymanowski und Iwaszkiewicz verbanden in ihrem Text Motive aus Euripides’ Bakchen mit den mittelalterlichen Erzählungen über den sizilianischen Herrscher. Szymanowskis Opernmusik indes steht einzigartig in der Musikgeschichte da. Sie changiert zwischen archaisch anmutenden ›byzantinischen‹ Chorsätzen, ausschweifender Tanzextase, fein ausgestalteter Deklamation und großer lyrischer Geste, all dies getragen vom impressionistisch schillernden, äußerst farbig ausgestalteten Orchesterpart. Die Musik erinnert an Skrjabin, zieht alle Register der Musik ihrer Zeit und hat doch eine eigene Handschrift.
Stefano Giannetti hat das Stück seiner Zeit und seiner geographischen Verortung enthoben, es aber auch nicht aktualisiert, sondern in ruhigem, ritualisiertem Spiel streng und doch suggestiv vorgeführt. Guido Petzold hat ihm einen schlichten großen Bühnenraum vor weißem Rundhorizont gebaut. Eine verbogene, gespaltete Stele im Mittelpunkt. Durchblicke, Schattenspiel und Desillusionierung (Herabfahren des Rundhorizonts) sind von symbolischer Klarheit, die großen Chöre und der Kinderchor werden geschickt geführt, immer wieder schöne Tableaus und wirkungsvolle Massenszenen-. Stefano Giannettis choreographische Ambitionen empfehlen sich in einer stilisierte Gebärdensprache, eigenwilliger Schreittechnik und vorwiegend illustrierend modernem Ausdruckstanz (Sehr engagiert das Ballett des Anhaltischen Theaters).

Szymanowskys „König Roger“ in Dessau/Szene/Foto Thomas Ruttke
Was die Regie angeht: Der religiöse und machtpolitische Aspekt der Handlung wird in den Vordergrund gestellt. In der Person des Hirten wird jeder Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, auf absoluten Glauben in Frage gestellt. “ Ein Revolutionär ist ein Mensch, welcher nein sagt“ ist eine der Kernaussagen des Revolutionärs, des Führers in einen neuen Glauben. Die Frage, wer der Hauptdarsteller ist, der König oder der Hirte, ist nicht so leicht zu beantworten. Beide Figuren sind Hauptdarsteller: Protagonist ist König Roger und sein Antagonist, sein Gegenspieler ist bis zur Bekehrung Rogers der Hirte. Kostümlich (Judith Fischer) steht eindeutig der Hirte, in königlichem Gold gewandet, viel nacktes Fleisch zeigend, mit Juwelen behangen, im Zentrum. Eine erotische Erscheinung. Ansonsten eher schlichte Kostüme. König Roger wird vorgeführt als Zweifelnder, dem verwirrende Einblicke in die Abgründe der eigenen Seele offenbar werden, der sich aber nicht in dionysischem Rausch selbst auflöst, sondern sich am Ende der Sonne, dem Sonnengott Phöbus Apollon zuwendet, Die souveräne Personalführung Giannettis lässt keine Fragen offen, die Homoerotik Szymanowskis, gelegentlich mitinszeniert, bleibt weitgehen außen vor.
In der dreiaktigen Oper, eher ein Mysterienspiel, ein ekstatisches Stationendrama oder ein musikalisches Psychogramm, geht es um die Konfrontation von Christentum und Sinnlichkeit, Eros und Agape. Der Ausspruch Nietzsches kommt einem in den Sinn: „Das Christentum gab dem Eros Gift zu trinken. Er starb zwar nicht daran, aber entartet, zum Laster.“ Die Hinkehrung zu Sexualität und Blutrausch, auch rauschhafter Selbtsauslöschung sind seit der Jahrhundertwende in den Fokus des Musiktheaters gerückt, man denke nur an Penthesilea, Salome oder Elektra. Auch König Roger fügt sich in diese „dekadente“ Linie ein: Die glitzernde, farbige Mittelalter-Oper spielt in Sizilien im 12. Jahrhundert. In seiner 1926 in Warschau uraufgeführten Oper erschuf der polnische Komponist Karol Szymanowski im Rückgriff auf eine zurückliegende, exotische Welt eine Klangwelt, die archaische Chorblöcke mittelalterlicher Strenge den dionysisch-ekstatischen Ausbrüchen des Neuen gegenüberstellt und so Kulturen und Gegensätze aufeinanderprallen lässt, in schwebend unbestimmter Harmonik, die von kühnen Dissonanzen durchsetzt sind
Elisa Gogou hat mit großer Präzision und nicht nachlassendem Elan, bei aller Sensibilität ihrer Gestaltung, Rausch, Ekstase, Klangmagie und -Farbe in den Mittelpunkt gerückt und dem außergewöhnlichen Stück zu seinem Recht verholfen, einer Musik die mit ihrer zwischen Spätromantik und Moderne angesiedelten Klanggewalt immer wieder ins Oratorische aufrauscht, aber auch mit suggestiven Chorälen und zarten Melodien betört, nicht zuletzt dank der superben Anhaltischen Philharmonie Dessau. Auch Chor und Kinderchor leisten unter Leitung von Sebastian Kennerknecht und Dorislava Kuntscheva außerordentliches. Auch was die Gesangssolisten angeht, ist die Aufführung geradezu sensationell: die englische Sopranistin Ania Vegry singt eine lupenreine Roxane, sehr schön auch die Stimme der Jagna Rotkiewicz als Diakonissin.,
Der arabische Gelehrte Edrisi, wird vom Bariton Christian Sturm nobel gestaltet, der südkoreanische Bass Caleb Yoo singt einen eindrucksvollen Erzbischof (als Einziger im historischen Ornat), der Hirt von Alexander Geller besticht mit feinem lyrischem Tenor und der Bariton Kay Stiefermann setzt dem Ensemble die Krone auf, auch wenn er sie als Darsteller am Ende abgibt. Ein stimmlich würdevoller, König Roger und ein großer Darsteller.
Gerade weil es still geworden ist um Karol Szymanowski in den letzten Jahren, nicht zuletzt wegen seiner Homosexualität im immer noch homophob katholisch-repressiven Polen, ist es umso verdienstvoller, dass sich Generalintendant Johannes Weigand vehement für das Hauptwerk, König Roger wie für den Komponisten einsetzt. Man könne es gar nicht oft genug spielen, meinte er nach der Premiere am 2. März 2024. Man wird diese Aufführung nicht vergessen. Dieter David Scholz
.
.
Braunschweig: Béatrice et Bénédict von Hector Berlioz. Äußerst selten kann man hierzulande die Opéra-comique Béatrice et Bénédict von Hector Berlioz erleben, anders als dessen monumentale Opern Les Troyens oder Le damnation de Faust. Vielleicht wäre sie bekannter, wenn sich Berlioz bei seiner letzten Oper für den Titel der Shakespeareschen Vorlage Viel Lärm um nichts entschieden hätte, allerdings für ein Werk des Musiktheaters ein etwas problematischer Name. Berlioz hat das Libretto selbst verfasst und dabei die Vorlage von fünf Akten auf zwei verkürzt, indem er die ernste Handlung um Hero und Claudio – aufgeladen mit Intrigen und Betrug – zugunsten der komischen Handlung um die Titelfiguren Béatrice und Bénédict in den Hintergrund rückte. Die Oper entstand im Auftrag des Spielbankbesitzers von Baden-Baden Edouard Banouzét, der dort das neue Theater mit einem angemessenen Werk eröffnen wollte. Obwohl die vom Komponisten im Sommer 1862 dirigierte Uraufführung ein voller Erfolg war, geriet das Werk schnell in Vergessenheit. Die freundlich-harmlose Komödie handelt vom sizilianischen General Don Pedro und dessen Adjutant Claudio, der nach siegreicher Heimkehr aus der Schlacht mit der schönen Hero verheiratet werden soll. Und dann gibt es da Béatrice und Bénédict, die in ständigem Streit herzlich miteinander verbunden sind, aber eine Hochzeit strikt ablehnen. Don Pedro und die Freunde schaffen es mit einer kleinen, gutmeinenden Intrige, dass sich die beiden über ihre tiefen Gefühle zueinander dann doch klar werden und es zum guten Ende zu einer Doppelhochzeit kommt.
Für sein letztes Bühnenwerk hat Berlioz eine duftig leichte Musik geschrieben, die er in einem Brief an Peter Cornelius so beschrieben hat: „…sie ist heiter, bissig und teilweise poetisch; das lächelt mit den Augen und den Lippen“. Und diesen Grundcharakter der heiteren Musik brachte Braunschweigs scheidender 1. Kapellmeister Mino Marani mit dem gut aufgelegten Staatsorchester in bester musikantischer Manier zum Klingen, wobei manche Instrumentalisten zu einzelnen Stücken sogar auf der Bühne auftraten. Die sehr fein ausmusizierte, aber nun gerade nicht so mitreißende Ouvertüre hatte die Regisseurin Franziska Severin dadurch szenisch aufgelockert, dass sie die genannte Schlacht, die inhaltlich im Folgenden keine Rolle mehr spielt, pantomimisch darstellen ließ. Hierzu hatte sie sich zunutze gemacht, dass es so genannte Reenactment-Vereine (=Wiederaufführung) gibt, die gern historische Ereignisse rekonstruieren und eben auch aufführen. So nun im sizilianischen Messina, wo die Bewohner sich in der Darstellung einer imaginären Schlacht gefielen. Nach dem den Sieg bejubelnden Eingangschor behielten die meisten Akteure ihre bunten, fantasiereichen historisch-mittelalterlichen Kostüme an, legten sie nur stückweise ab oder traten in ihrer „normalen“ bürgerlichen Kleidung auf. Im Übrigen spielte sich das Ganze auf der praktischen Drehbühne um einen mediterranen Gasthof mit Kiosk ab (Ausstattung: Benita Roth).
Die harmlose Geschichte um die beiden „Streithähne“ und deren allmählich ernster werdenden Gefühle zueinander lief in einer reichlich überaktiven Atmosphäre ab. Hierbei wurden praktischerweise nur die musikalischen Nummern im französischen Original gesungen, während die deutschen Sprechtexte dem Verständnis des Inhalts sehr zu Gute kamen. Der überbordende Fantasiereichtum der Regisseurin in den großen Szenen, wenn der Chor zu tun hat, ist zu bewundern; wie sie hier die einzelnen Choristen agieren ließ, das hatte Format. Allerdings ging der Überaktionismus in den einzelnen Arien und Ensembles oft zu weit. Hier hatte man das Gefühl, dass die Regisseurin der Musik nicht so recht traut und deshalb geradezu zwanghaft fast immer Unnötiges hinzufügte, wie z.B. Traumbilder in der großen Arie Que viens-je d’entendre? im zweiten Akt, wenn Béatrice versucht, sich ihrer Gefühle für Bénédict klar zu werden. Auch beim Duett Hero/Ursule am Schluss des 1.Aktes, dem wunderschönen Notturno, störten die hinzugefügten Figuren wie der Tänzer im Tutu, ein Hamlet mit Totenkopf oder die Kinder. Die nächtliche, besinnliche Atmosphäre wurde erst am Schluss mit den Lichtern in den Büschen und den friedlich aufsteigenden Luftballons erreicht.

„Béatrice et Bénedict“ vo Hector Berlioz am TfN Braunschweig/Szene/Foto Thomas M. Jauk
Musikalisch war der Premierenabend ein Genuss: Vom ausgezeichneten, mit sicherer Hand und präziser Zeichengebung des Dirigenten geführten Staatsorchester war schon die Rede. Zum großen Erfolg der Premiere trug wesentlich das durchweg spielfreudige und insgesamt stimmlich erfreuliche Ensemble bei. An erster Stelle ist eine der Braunschweiger Publikumslieblinge Milda Tubelyté als Béatrice zu nennen. Sie machte mit gestenreichem Spiel überzeugend deutlich, dass in der resoluten Frau unter der äußerlich rauen Schale doch ein weicher Kern schlummert. Dabei beeindruckte einmal mehr ihr gut durchgebildeter heller Mezzosopran, den sie höhensicher und stets bruchlos durch alle Lagen zu führen wusste. Ihr Bénédict war Matthew Pena, der seinen nicht gerade kräftigen Tenor flexibel einsetzte, wobei manche Höhen zu eng gerieten. In ihrem ersten Duett fiel positiv auf, wie perfekt sie die zungenbrecherischen Koloratur-Passagen absolvierten. Den charaktervollen Bariton von Zacchariah Kariithi in der kleineren Rolle des Claudio hätte man gern öfter gehört; seine Hero war Victoria Leshkevich anvertraut. Sie sang ihren Part angenehm auf Linie und ließ dabei ihren runden Sopran schön aufblühen. Im schon erwähnten Notturno kam die Stimme mit ausgeprägtem Mezzo-Timbre von dem spanischen Gast Anna Alàs i Jové als Kiosk-Betreiberin Ursule hinzu. Beide Stimmen verbanden sich aufs Feinste miteinander, sodass das wunderbare Duett zu einem der musikalischen Höhepunkte des Abends wurde. Einige der komischen Eckpunkte der Oper setzte Maximilian Krummen als eitler Komponist und Dirigent Somarone. Mit sonorem Bass gab Jisang Ryu den gefeierten Schlachtensieger Don Pedro, während der in Braunschweig aus mehreren Auftritten in Musicals nicht unbekannte Randy Diamond prononciert die Sprechrolle des Leonato ausfüllte; Sebastian Andreas Mulik ergänzte sicher das Ensemble als Bote und als den die Eheschließungen beurkundenden Notar. Der von Georg Menskes und Johanna Motter einstudierte gefiel erneut durch trotz turbulenten Spiels ausgewogene Klangfülle.
Mit lang anhaltendem, mit Bravos vermischtem Beifall bedankte sich das Premierenpublikum bei allen Mitwirkenden und dem Regieteam (Premiere am 17. Februar 2024). Gerhard Eckels
.
.
An der Deutschen Oper Berlin: Erfolg mit Zeitgenössischem. Nach mittelalterlichen Quellen schrieb der Autor Martin Crimp das Libretto zu einer dreiteiligen Oper mit dem Titel Written on Skin. Erzählt wird die Geschichte eines reichen Großgrundbesitzers, Protector genannt, der einen jungen Mann, The Boy, als Illustrator für ein Buch mit seinen Werken und Wohltaten verpflichtet. Die Frau des Protectors, Agnès, beginnt aus sexuellem Verlangen ein Verhältnis mit dem Jungen, worauf der Protector ihn ermordet und dessen Herz seiner Frau als Mahlzeit serviert. Auch sie will er töten, doch sie entzieht sich ihm durch einen Sprung aus dem Fenster.
Komponiert hat der 1960 geborene britische Dirigent und Pianist George Benjamin. Seine Musik ist fast immer von großer Durchsichtigkeit, teilt jedem Protagonisten bestimmte musikalische Floskeln zu, lässt nervöse Motive, stotternden Duktus, aggressive Klangblöcke und schmerzende Schläge hören, findet aber auch zu sinnlichem Rausch. Marc Albrecht fächert mit dem Orchester der Deutschen Oper das Geflecht der Komposition sorgsam auf, findet stets die Balance zwischen Bühne und Graben, so dass die Sänger nie gefährdet sind, in ihrer stimmlichen Präsenz zu verlieren. Die Partien sind anspruchsvoll, vor allem die der Agnès, die mit ihrem Sopran stratosphärische Regionen erklimmen muss. Georgia Jarman wird diesem Anspruch souverän gerecht, auch in der Extremhöhe klingt ihre Stimme nie grell oder schrill. Zudem ist ihre szenische Präsenz bemerkenswert – insgesamt ein faszinierendes Porträt. Einen glänzenden Auftritt absolviert der Countertenor Aryeh Nussbaum Cohen. Seine Stimme ist klangvoll, voluminös und jederzeit angenehm im Klang. In einer Rahmenhandlung, welche dem Stück beigegeben ist, kommentieren drei Engel das Geschehen und werden selbst zu dessen Akteuren. Der Counter verwandelt sich so vom First Angel zu The Boy und der Sängerdarsteller vermag in beiden Rollen durch seinen Gesang und die emotionale Darstellung zu berühren. Mark Stone lässt als Protector einen markigen Bariton hören, Anna Werle ergänzt mit strengem Mezzo die Besetzung als Second Angel und danach als Agnès´ Schwester Marie.

George Benjamins „Written on skin“ an der Deutschen Oper Berlin/Szene/Foto Bernd Uhlig
Die Uraufführung des Werkes 2012 beim Festival von Aix-en-Provence als Koproduktion mit den Bühnen von Amsterdam, Toulouse und London war ein Sensationserfolg, nicht zuletzt wegen der Inszenierung von Katie Mitchell. Die britische Theaterregisseurin hatte mit Ausstatterin Vicky Mortimer eine bildstarke und atmosphärisch dichte Inszenierung besorgt. Das Einheitsbühnenbild zeigt den Längsschnitt durch ein Haus, dessen Wohnräume rechts in die Vergangenheit verweisen und sogar ein Baum durch die Decke gewachsen ist, während links nüchterne Sachlichkeit der Jetztzeit mit Büroraum, Küche und Garderobe vorherrscht. Jon Clark hat die Räume in wechselnde Lichtstimmungen getaucht und damit sehr atmosphärische Wirkungen erzielt. Auch in den Kostümen sieht man eine Zweiteilung zwischen Historie und Gegenwart.
Am 27. Januar 2024 konnte sich das Publikum in der Deutschen Oper von der Qualität der Produktion überzeugen und feierte am Ende der Premiere alle Mitwirkenden sowie den anwesenden Komponisten anhaltend. Bernd Hoppe
.
.
An der Komischen Oper: Rimski-Korsakow nahe am Musical. Auch die erste Premiere der Komischen Oper im neuen Jahr ist eine Übernahme: Rimski-Korsakows Oper Solotoi petuschok (Der goldene Hahn) kommt vom Festival d’Aix-en-Provence und wurde dann an der Opéra National de Lyon und beim Adelaide Festival als Koproduktion dieser drei Bühnen gezeigt. Am 28. Januar 2024 hatte die Inszenierung von Barrie Kosky an seinem ehemaligen Stammhaus Premiere und fügte seiner langen Erfolgsliste einen weiteren hinzu. Wie zumeist waren seine erprobten Mitstreiter mit am Werk: Bühnenbildner Rufus Didwiszus erdachte eine triste Heidelandschaft mit vertrockneten Grasbüscheln in raffiniert grauen Pastelltönen, die auch als Hommage an Caspar David Friedrich gewertet werden könnte. Franck Evin hat sie diffus, aber sehr stimmungsvoll beleuchtet. Auf der rechten Seite steht ein kahler Baumstumpf mit vertrockneten Ästen, auf dem sich der Goldene Hahn, das Geschenk eines Astrologen, niedergelassen hat und von dort sein warnendes Krähen in König Dodons Reich schickt, wenn dem Land Gefahr droht. Victoria Behr hat ihm ein schillerndes exotisches Kostüm entworfen, das ihn als eine Art Faun erscheinen lässt. Auch Verbindungen zum Goldenen Idol im Ballett La Bayadère oder dem Goldenen Sklaven in Fokines Choreografie der Scheherazade sind denkbar. Gleichfalls attraktiv gewandet ist die Königin von Schemacha mit üppigem Federkopfputz und silbern glänzender oder elegant violetter Robe. Einen deprimierenden, beklagenswerten Anblick bietet dagegen der König in ergrauter Feinripp-Unterwäsche, die ihm jede Würde und herrscherliche Aura nimmt.

Rimskys Oper „Der goldene Hahn“ an der Komischen Oper Berlin/Szene/Foto Barbara Rittershaus
Leider hat auch der Regisseur die Figur arg verzeichnet, sie zum debilen Trottel degradiert. Ein weiteres Problem der Aufführung sind die Balletteinlagen von Otto Pichler, dem am Haus für seine Mitarbeit in Operetten und Musicals geschätzten Choreografen. Hier aber sind seine Ideen stilistisch deplatziert, wenn vier Tänzer in silbern glitzernden Slips und Tutus oder Ganzkörpertrikots auftreten, sogar Can-Can tanzen und hemmungslos kreischen. Das hat man schon oft gesehen und in Werken der leichten Muse auch goutiert, aber hier… An schräge Revuen erinnert zudem der Auftritt der Chorsolisten als Volk im 3. Akt – ein Panoptikum aus Transvestiten, Drag Queens und allerlei Paradiesvögeln mit monströsen bunten Frisuren, irrwitzigen Masken und überkandidelten Kostümen. Vor den grausamen Vorgängen der Handlung schreckt Kosky freilich nicht zurück. Schon die beiden Söhne Dodons, die Prinzen Gwidon und Afron, die sich gegenseitig aus Eifersucht um die begehrte Königin umgebracht haben, hängen kopfüber kopflos am Baum. Seinem aufsässigen General Polkan lässt Dodon auf Geheiß der Königin das Haupt abschlagen. Er selbst tötet mit mehreren Axtschlägen den Astrologen, der die Königin als Preis für den Goldenen Hahn verlangt hatte, und erscheint danach von Blut besudelt als Bild des Grauens. Er dagegen kommt durch die brutalen Schnabelhiebe des Goldenen Hahns zu Tode, was dem Stück eine bitterernste Wendung gibt und das Volk ratlos zurücklässt. Auch ist anzuerkennen, dass das Team die Handlung nicht als aktuelle Politsatire aufgeführt, sondern ihr die märchenhaft-surrealen Elemente zugestanden hat.
Musikalisch ist der Abend ohnehin pure Freude, angefangen von James Gaffigan, dem neuen Generalmusikdirektor des Hauses, der mit dem Orchester der Komischen Oper Berlin die breite Farbpalette der Komposition spannungsvoll erklingen lässt – ihre schwelgerische Lyrik, die feinen instrumentalen Details, die schillernden Orientalismen und auch die grellen Einwürfe. Zuverlässig wie stets die Chorsolisten (Einstudierung: David Cavelius), die ihre Auftritte, den ersten gar mit Pferdeköpfen und Strapsen, den zweiten als wehklagende Masse, mit Klangfülle absolvieren.
Glänzend besetzt sind die Rollen, allen voran Dodon in Gestalt von Dmitry Ulyanov als pralle Figur und mit voluminös ausladendem, poltrigem Bass ausgestattet. Wenn er der verführerischen Schönheit der Königin verfällt, singt und tanzt vor ihr, womit er sich lächerlich macht und ihren Spott hervorruft. Der Sänger hat keine Scheu vor vulgären oder peinlich anmutenden Szenen, wirft sich mit totalem körperlichem Einsatz in die Herausforderungen, welche die Regie ihm abverlangt. Exponiert notiert ist die Partie der Königin von Schemacha, der Kseniia Proshina nicht nur eine attraktive Erscheinung verleiht, sondern auch mit klarem, substanzreichem Sopran sinnlich und virtuos singt und nur ganz wenige grelle Spitzentöne hören lässt. Auch die Partie des Astrologen ist eine Herausforderung wegen ihrer extremen Tessitura. James Kryshak bewältigt sie bravourös und überzeugte auch in den verschiedenen stummen Auftritten vor dem Vorhang als zitternde, sich mühsam fortbewegende Alte im Mantel mit Pelzkragen und Handtasche oder als ächzend stöhnender alter Mann oder als Bonvivant im Gleichschritt in Frack und Zylinder. Die Titelrolle ist zweigeteilt – Julia Muzychenko singt sie mit kraftvollem, herbem Mezzo und Daniela Ojeda Yrureta spielt sie mit androgynem Geheimnis. Die Besetzung komplettieren Pavel Valuzhin als Gwidon, Hubert Zapiór als Afron, Alexander Vassilev als Polkan sowie Margerita Nekrasova als Aufseherin Amelfa mit dunklem Alt. Die Premiere endet im Jubel des Publikums und lässt die letzte Inszenierung des Werkes am Haus von Andreas Homoki endgültig in Vergessenheit geraten. Bernd Hoppe
.
.
Aalto Musiktheater Essen: Louise Bertins Fausto. Im Kerker fleht Gretchen, die ihr neugeborenes Kind umgebracht hat, um Gottes Hilfe, „Dio, te solo invoco! Vieni al mio soccorso“. Bereits lange vor Boitos Mefistofele gab es einen italienischen „Faust“, also einen Fausto. Dass dieser in Paris in dem von der Aristokratie favorisierten Theater, das seine sämtlichen Aufführungen in italienischer Sprache herausbrachte, uraufgeführt wurde, gehört zu den Besonderheiten der Kunstform. In Frankreich war Louise Bertins Fausto ohne Vorbild und Vergleich; es war die erste „Faust“-Vertonung für die französische Opernbühne. Zudem war dieser 1831 am Théâtre-Italien uraufgeführte Fausto das Werk einer Komponistin, die als 20jährige im privaten Kreis, der immerhin Rossini einschloss, eine Guy-Mannering Oper nach Walter Scott präsentiert hatte, dann entsprechend an der Opéra-Comique untergebracht hatte (1827 Le loup-garou auf ein Originallibretto von Eugène Scribe) und die einige Jahre danach mit La Esmeralda auch das dritte staatliche Opernhaus betrat, wo der Vierakter zu dem Victor Hugo eigenhändig seinen Roman Notre-Dame de Paris in ein Libretto umgeformt hatte, die erste Oper eine Komponistin an der Grand Opéra war.

Louise Bertins Oper „Fausto“ (erstmals in der Tenorfassung) in Essen/Szene/Forster
Die zweite sollte erst 1895 der gerade in Dortmund neu erprobte La Montagne Noire von Louise Holmès sein, dem sich nun der Essener Versuch mit Louise Bertins Faust-Oper, deren Partitur bis vor wenige Jahre unbemerkt in der Pariser Bibliothèque Nationale schlummerte, so geschickt anfügt. Das erwähnte „Dio, te solo invoco! Vieni al mio soccorso“ in Bertins Fausto ähnelt stark den Zeilen, die 1859 Barbier und Carré der Marguerite in Gounods Faust in den Mund legte, „Dieu juste, à toi je m’abandonne“. Hier wie dort vernimmt der Zuschauer am Ende die himmlischen Stimmen, die Margarita bzw. Marguerites Rettung verkünden: „Ell’ è salvata“ bei Bertin zu den Klängen des Ave Maria bzw. bei Gounod „Sauvée“. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, dass bei Gounod Faust niedersinkt und Mephisto unter dem Schwert des Erzengels niederstürzt, während bei Bertin, die darin älteren Faust-Bücher wie der Historia von D. Johann Fausten folgt, Mefistofele den Faust zu den Worten „È in mio poter“ in seine Gewalt bringt und mit sich reißt. Faust II, in dem Fausts Tod und seine gnadenreiche Erlösung mitgeteilt werden, wurde erst 1832 veröffentlicht.
Bereits zu dem Zeitpunkt, als Bertin an ihrer komischen Oper für die Opéra-Comique arbeitete, beschäftigte sie sich mit dem Thema und stellte 1826 die viertelstündige Schlussszene des Fausto („Ultima Scena di Fausto“) für Sopran, Alt und Bass mit Klavierbegleitung im Salon vor. Bis dahin kannte sie weder die Huit Scenes de Faust ihres Freundes Berlioz noch die für die französische Goethe-Rezeption so zentrale Übersetzung von Gérard de Nerval, wenngleich Faust durch verschiedene andere Quellen und Übertragungen geradezu en vogue im französischen Kulturleben war. Bereits 1827 sagte das Théâtre-Italien Bertin zu, ihre Faust-Oper 1830 herauszubringen. (Dazu auch der Artikel zur Oper in operalounge.de)
Louise Bertin (1805-77) litt an Kinderlähmung und war auf Gehhilfen angewiesen; sie wuchs in jeder Hinsicht privilegiert in einem Elternhaus auf, in dem u.a. Rossini, Victor Hugo und Berlioz verkehrten, die Eltern förderten ihre musischen Neigungen, Francois-Joseph Fétis und Anton Reicha übernahmen die musikalische Ausbildung und es war kaum von Nachteil, dass ihr Vater Louis-Francois Bertin der Herausgeber der einflussreichen Zeitung Journal des débats war. Bertin schrieb den Text ihres Fausto auf Französisch, Luigi Balocchi, der offizielle Librettist des Théâtre-Italien, übertrug ihn ins Italienische. Den Konventionen der italienischen Oper der Zeit folgend, konzipierte Bertin die Titelrolle anfangs für einen Mezzosopran, konkret die Rossini-Altistin Rosmunda Pisaroni. Als die geplante Uraufführung möglicherweise aufgrund der Juli-Unruhen von 1830 oder Problemen mit der als Margarita vorgesehenen Maria Malibran um ein Jahr verschoben werden musste, wurde die Partie dem Tenor Domenico Donzelli (ein Pollione von Rang) übertragen, der im gleichen Jahr auch den Pollione in der Norma kreierte; die Margarita sang nun Henriette Méric-Lalande. Nach drei Aufführungen verschwand Fausto von der Bühne.
Die reizvolle Besetzung mit Mezzosopran und Sopran lässt sich auf der im Vorjahr in Paris anlässlich eines Konzerts – das damit die vierte Aufführung des Werkes war – entstandenen Bru Zane-Aufnahme mit Karine Deshayes und Karina Gauvin unter Christophe Rousset erleben, dabei merkt man auch wie nahe dieser Fausto beispielsweise bei Mercadante ist – ein bisschen Francesca da Rimini – während die spätere La Esmeralda einen deutlichen Halevy-Touch hat. Fausto ist einerseits eine konventionelle und etwas altmodische italienische Oper der Romantik, andererseits ein Werk, an dem Rossini und Meyerbeer „die Originalität von Klang und Melodie und wahre dramatische Kraft“ lobten. In vier sehr überschaubaren Akten bringt Bertin viel unter.
Die schicksalsgewaltige und bei einer Aufführungsdauer von gerade mal zwei Stunden mit zehn Minuten fast überdimensionierte Ouvertüre zeigt Bertin als ambitionierte Macherin. Das klingt alles dramatisch auffahrend, ist mit solistisch heraustretenden Posaunen durchsetzt und bis zum letzten Donnerhall nach der Schlussstretta von Margarita, Fausto, Mefistofele und Chor als Wechselspiel der Gefühle von intensiven Affekten bestimmt. Andreas Spering und die Essener Philharmonie realisieren diese Klangfülle weniger elegant und wendig als zupackend und wuchtig, doch stets dem theatralischen Moment verpflichtet.

Louise Bertins Oper „Fausto“ (erstmals in der Tenorfassung) in Essen/Szene/Forster
Bertins Ausdruckswillen führt dazu, dass sie auf engem Raum mit unterschiedlichen Klanglichkeiten spielt, oft leidenschaftlich und raffiniert agiert, dann aber auch mit langweiligen Seccorezitativen erstaunlich nachlässig bleibt. Mag anfangs die schwer und dunkel lastende Don Giovanni-Atmosphäre eine Aura von Jenseitigkeit evozieren, so wirkt der Goethe getreu über den Büchern brütende Fausto in seiner Auftrittsarie zerrissen zwischen den extremen Lagen der Partie, die den für das Rare und Besondere zuständigen Mirko Roschkowski gewaltig herausfordert. Er meistert die lyrische weiche Mittellage, auch die Aufschwünge in die Höhe mit süßer voix mixte und zarter Kopfstimme, manchmal bricht die Stimme aus, aber Roschkowski hat, wie seine dramatische Arie zu Beginn des vierten Aktes zeigt, durchaus auch heldisches Format, wirkt dabei authentisch und bodenständig, doch das alles ergibt keine Figur und kein Rollenporträt, was sicher an der Komponistin und ihrer brüchigen Partitur liegt. Denn auch Margarita, die anders als bei Goethe, sich früh und aus eigenem Antrieb Faust nähert, überzeugt am ehesten im wogenwellenden „Signora amabile“-Duett mit Fausto im zweiten Akt. Das düstere Gebet, mit dem die Schwangere zur Jungfrau Maria betet, ist ebenso wie die Einwürfe nach der Ermordung ihres Bruders und die Kerkerszene effektvoll, aber etwas ungeschickt und klangmager über dem massiven Orchester angelegt. Zumindest wirkt Netta Ors Sopran in solchen Passagen in der Mittellage maulig unattraktiv, während ihr die verzierten, raschen und hoch liegenden Passagen eher liegen. Einen Vorwurf darf man ihr nicht machen, da sie kurzfristig für die vorgesehene Kollegin eingesprungen ist. Mit merklicher Lust und Hingabe übernahm Regisseurin Tatjana Gürbaca den darstellerischen Part und zeigte eine herausfordernd selbstbewusste Margarita, über der die Regisseurin Gürbaca am Ende ein goldenes Feuerwerk niederregnen lässt. Als Regisseurin hat Gürbaca souverän ihren Job gemacht. Der klinische weiße, nicht eben originelle Operationssaal von Marc Weeger, in dem Fausto an einem Probanden schnippelt und seinen Bericht in die Schreibmaschine tippt, wird später nach hinten geblendet, die Wissenschaftsabteilung von der Huren-Tragödie (den Begriff schmieren die Nachbarn Margarita auf die weiße Kittelschürze) abgelöst. Im gleichen Zug wird der Chor der Hexen, Dörfler und Nachbarn zu einer bösen und anonymen, auf langen Bänken Gericht haltenden Masse. Einfach und praktisch.
Fausto ist eine Semiseria. Für die deshalb notwendigen heiteren Momente ist fast ausnahmslos Mefistofele zuständig, das von Faust herbeigerufene und als Alter Ego geschaffene Wesen vom Operationstisch mit Ypsilon-Schnitt auf der nackten Brust. Almas Svilpa singt den Mefistofele mit mattem Streubass, der im wendig wippenden Duett mit Margaritas Nachbarin Catarina (mit präsentem Mezzo: Natalija Kukhar) und im rossinihaften Silbengeplappere Virtuosität und quecksilbrige Spielfreude entwickelt. Reinster Rossini, wie aus einer seiner frühen komischen Opern, ist Valentinos Arie „Ah, mi batte il cor nel petto“, zugleich die einzige Bravourarie der Oper, die der rumänische Tenor George Virban im Kurzauftritt als Margaritas kleiner Bruder mit geschmackvoller Geschmeidigkeit servierte. Daneben Baurzhan Anderzhanov mit seriöser Bassgewalt als Wagner und der auch in solistischen Minipartien geforderte Chor des Aaalto Theaters. Rolf Fath
.
.
Oper Dortmund: La Montagne Noire von Augusta Holmès. Der accent grave auf dem „e“ irritiert: Holmès. Augusta Mary Anne Holmes wurde 1847 als Tochter eines irischen Vaters und einer schottischen Mutter in Paris geboren, wo sie 56 Jahre später auch starb. Sie lebte zeitlebens in Frankreich und betrachte sich als Französin, weshalb sie bereits Jahre bevor sie 1879 offiziell eingebürgert wurde, den Makel des englischen Namens beseitigte und sich fortan Holmès schrieb. Schwerer wog, dass ihr wegen der fehlenden französischen Staatsbürgerschaft ein Studium am Pariser Konservatorium verwehrt blieb. Privatunterricht, darunter, zusammen mit Vincent d’Indy und Ernest Chausson, bei César Frank bot den nötigen Ausgleich für die junge Dame, die früh durch ihre Kompositionen auffiel, welche sie anfangs unter dem männlichen Pseudonym Hermann Zenta veröffentlichte. Ganz so hart, wie sie es schildert, dürfte der Kampf nicht gewesen sein, den Holmès als Komponistin und Frau zu bestehen hatte. Durch den Tod des Vaters, mit dem gemeinsam sie noch die Rheingold- UA und schließend Wagner in Tribschen besucht hatte, war sie abgesichert und wohlhabend genug, um ein unabhängiges Leben zu führen und über ihr Vermögen zu bestimmen, das im Falle einer Heirat an ihren Gatten gefallen wäre. Holmès blieb unverheiratet, was sie nicht davon abhielt, mit dem verheirateten Schriftsteller Catulle Mendès eine Beziehung einzugehen und mit ihm fünf Kinder zu haben. Sicherlich spricht aus manchen Sätzen der Türkin Yamina, die in La Montagne Noire, den montenegrinischen Krieger Mirko skrupellos manipuliert und für ihre Ziele einspannt, ganz offen die Komponistin. Zumindest in den Passagen, wo die versklavte Yamina den Bäuerinnen, die ihre Gatten ebenso verehren und ihnen gehorchen wie Christus, ihre Unfreiheit vorhält.

Augusta Holmes´“Montagne noir“ in Dortmund/ Foto Björn Hickmann
La Montagne noire ist die einzige der vier Opern von Holmès, die aufgeführt wurde und zwar als zweite Oper einer Komponistin, die jemals an der Pariser Opéra zur Uraufführung gelangte – die erste war die Esmeralda der Louise Bertin, deren Fausto in zwei Wochen in Essen neuerlich auf die Bühne gelangen wird. Beide Male, also in Dortmund wie in Essen, hat auch der Palazzetto Bruno Zane, der sich um die entsprechenden Editionen kümmert, die Hände mit im Spiel. La Montagne Noire kam im Februar 1895 heraus, dirigiert vom damaligen Chefdirigenten Paul Taffanel, die Yamina sang die dramatische Sopranistin Lucienne Bréval, die später Kundry und Brünnhilde und mehrere Partien in den Uraufführungen u.a. von Massenet, Dukas, Février sang, den Mirko übernahm der dramatische Tenor Albert Alvarez, der ein Jahr zuvor den Nicias in Thais kreiert hatte, und Marcel Renaud, der erste Bariton des Hauses, sang seinen Blutsbruder Aslar. Der Erfolg für die im 17. Jahrhundert in Montenegro spielende Oper war durchwachsen. Die Aufführung der Oper Dortmund ist die erste Produktion seit der Uraufführung vor 129 Jahren. Sie schließt sich im Sinn einer ausgesprochen phantasievollen und klugen Dramaturgie des Opernintendanten Heribert Germeshausen an die deutsche Erstaufführung von Ernest Guirauds Frédégonde sowie Spontinis Fernand Cortez an.
Zum Zeitpunkt ihrer Montagne Noire-Uraufführung war Holmès eine angesehene Komponistin, die mit ihren patriotischen Tondichtungen Irlande und Pologne Anfang der 1880er Jahre Aufmerksamkeit erregt hatte und spätestens 1889 mit den Ode triomphale en l’honneur de Centenaire de 1789, wofür sie 900 Choristen und 300 Musiker zur Erinnerung an die Revolution aufbot, eine Berühmtheit wurde. Fast jeder kennt in Frankreich, und nicht nur dort, heute noch ihren Weihnachtsschlager Trois anges sont venus ce soir. Einigermaßen verwunderlich war die Wahl des Stoffes, einer wackeligen Heldengeschichte aus Montenegro (= La Montagne Noire), das in stete Konflikte mit den Türken verwickelt 1878, kurz bevor Holmès sich dem Thema zuwandte, unabhängig geworden war. Holmès schrieb den Text selbst, was die einzige tatsächliche Wagner-Reminiszenz bei dieser Oper ist, die in die Zwickmühle zwischen Wagner-Begeisterung und politisch motoviertem Widerstand gegen diesen Wagnerisme geriet und nach 13 Aufführungen verschwand; der Holmès-Geliebte Mendès gehörte übrigens zur Vielzahl der von Wagner begeisterten Literaten.

Augusta Holmes´“Montagne noir“ in Dortmund/ Foto Björn Hickmann
Den Kern des Drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux bildet zum einen die in einer religiösen Zeremonie sanktionierte Blutsbrüderschaft der siegreich aus dem Kampf gegen die Türken heimgekehrten Mirko und Aslar, wofür Holmès sich in der slawischen Geschichte umsah und Mirko dem Helden Marko Kraljević und den Priester, Père Sava, dem Gründer der serbisch-orthodoxen Kirche nachempfand. Zum anderen die Liebe des bereits mit Héléna verlobten Mirko zu Yamina. Es sind die Muster der Grand opera Ende des 19. Jahrhunderts. Man spürt die etwas farblose Weitschweifigkeit der frühen historischen Opern von Massenet, man erkennt Saint-Saens und seine Dalila in der Figur der Verführerin Yamina, überhaupt ist es interessant, wie negativ, brutal und herzlos die geradezu idealtypisch angelegte femme fatale durch eine Frau gezeichnet wird. Immerhin lässt ihr Holmès am Ende die Freiheit, während die beiden Kämpfer Mirko und Aslar tot sind. Durch seine Liebe zu Yamina und die gemeinsame Flucht hat Mirko seine Gemeinschaft, seine Verlobte und seinen Blutsbruder verraten. Aslar folgt den Fliehenden, kann aber den völlig verzückten Mirko nicht zur Umkehr bewegen, weshalb er ihn tötet und selbst im Gefecht mit den Türken umkommt. Die heimischen Legenden stilisieren beide zu Freiheitshelden, wie es im fünften Bild anklingt, das in Dortmund in der Originalfassung uraufgeführt wurde. In diesem Dreieck kommt Héléna zu kurz. Sie ist die stille Dulderin, die, anders als ihr Vorbild Micaela, sich im Gebet an die Madonna sogar auf den Beistand von Mirkos Mutter Dara stützen kann. Anna Sohn singt das zart zwitschernd und anmutig, während Alisa Kolosova die Dara drastisch und orgelnd als Mutterautorität gibt. Sie bleibt eine dralle Randfigur wie der mit grobmaschigem Schwarzbass singende Denis Velev als Père Sava.
Das gilt ein wenig leider auch für den Mirko, den Sergey Radchenko wie einen Bruder des übertölpelten und fremdgesteuerten Don José mit schönen heldischem, silbrigem Trompetenton und feinen Zwischentönen gibt. Doch seine langen Erzählungen, gleich zu Beginn des zweiten Aktes, geraten etwas prosaisch, was nicht unbedingt an fehlender gestalterischer Phantasie liegt, sondern an der Langatmigkeit der Holmès, der Langweiligkeit der Situationen, an der fehlenden Dramatik, am großen Bogen. Man bewundert das, doch man liebt es nicht. Zwischen diesen Polen ist die unsympathische Yamina, die alle Facetten der Verführung ausspielen kann, scheinbar die duldsame Sklavin gibt, dann wieder die doppelzüngige Schlange ist, eine gesanglich dankbare Partie und ein Puzzle aus Carmen, Dalila, Charlotte. Aude Extrémo gibt sie mit lodernder Intensität, erdiger Tiefe, gleißender Höhe, schäumender Leidenschaft und einigen Brüchen, ohne dass sich das zu einem Porträt fügt.

Augusta Holmés/Wikipedia
Eine Figur, die in ihrer geraden Aufrichtigkeit Statur gewinnt, ist Aslar, in dessen Bravourarie am Ende des zweiten Aktes Mandla Mndebele mit Wärme und schöner Höhe glänzt. Trotz der exotischen Farben, fehlt es dem Vierakter an Sinnenreiz- und Glanz, da gibt es Siegesfeiern und Trinkszenen im ersten und vierten Akt, Haremsdamen und Krieger, doch vieles wirkt blutleer, dabei hat Holmès glänzend instrumentiert und wird im dritten und vierten Akt in dieser Hinsicht noch virtuoser und ekstatischer, wobei man an Camille Saint-Saëns denken muss, der von Mademoiselle Holmès sagte, „In ihrer Musik explodieren die Blechbläser wie Feuerwerkskörper; die Töne prallen aufeinander, die Modulationen kollidieren mit einem stürmischen Lärm…alle Klangfarben des Orchesters, einer Art intensiver Kultivierung unterworfen, erzeugen maximale Effekte und die Violinen werfen Raketen ab, vor denen selbst das Klavier zurückweichen würde; die große Trommel, die Becken, die Harfe tanzen einen wilden Reigen.“
Diese zunehmende Sinnlichkeit des Gesangs und instrumentale Virtuosität reizen Motonori Kobayashi und die Dortmunder Philharmoniker, unterstützt von Chor und Extrachor, präzise und mit pompöser Klangfülle aus, wodurch der Schlussapplaus heftiger als zur Pause ausfällt. Emily Hehl hat dieses balkanesische Drame lyrique ausgesprochen überlegt und sorgfältig auf die Bühne gewuchtet und ihm durch die Gestalt einer Gusla-Spielerin, welche die in uralten Erzählungen tradierte Heldengeschichte des Marko Kraljević vorträgt, einen Rahmen gegeben. Im deftigen rezitierenden Schrei-Gesang gibt Bojana Peković einen glühenden Ton vor, den die Dorfgemeinde nur schwer aufnehmen kann. Zusammen mit den sanft stilisierten Trachten und den bildträchtigen Überwürfen für die Frauen und weißen Faltenröcken für die Männer (Kostüme: Emma Gaudiano) kreiert Hehl in der typischen grauschieferigen Frank Philipp Schlössmann-Kiste, die nach hinten spitz abknickt, sich geschickt heben und schieben lässt, eine zwischen Raum und Zeiten schwebende Geschichte, in der ein Esel ebenso seinen Platz hat wie ein Auto, die im Krieg erbeuteten türkischen Teppiche ebenso wie abnehmbare Heiligenscheine. Rolf Fath
.
.
Belcanto-Glanz an der Deutschen Oper Berlin: Seit ihrer Premiere im Dezember 1980 ist Filippo Sanjusts Inszenierung von Donizettis Lucia di Lammermoor ein beliebter Klassiker im Repertoire der Deutschen Oper Berlin, suggerierten die Kulissen aus bemalter Pappe doch eine Aufführung im Stil der Uraufführung des Werkes. Nun betrat mit Anna Bolena eine weitere Belcanto-Heldin des Komponisten die Bühne in der Bismarckstraße. Hoch waren die Erwartungen der Liebhaber dieses Genres – und zumindest musikalisch wurden sie erfüllt. Enrique Mazzola hatte sich für die kritische Edition der Fondazione Donizetti di Bergamo entschieden, was mehrere unbekannte Passagen zu Gehör brachte und die Aufführung deutlich verlängerte. Er dirigierte das Orchester der Deutschen Oper Berlin mit feinem Gespür für die kantablen Lyrismen der Komposition, wusste aber auch deren dramatische Szenen (wie das 1. Finale) effektvoll auszubreiten.
Erfreulich war die durchweg kompetente Besetzung, die keinen Schwachpunkt aufwies. Die Bedenken, ob Federica Lombardi, gerühmt als Figaro-Contessa, für die Titelpartie der richtige Stimmtyp sein könnte, hatten sich schnell zerschlagen, denn die italienische Sopranistin ließ eine potente Stimme mit aparten Farben, feinen piani und leuchtenden legato-Bögen hören. Und sie besaß auch das dramatische Potential, um die entsprechenden Szenen ihrer Partie („Giudici! ad Anna!“) zu bewältigen. Nur selten (so im Rezitativ der Schluss-Szene) gerieten einzelne Spitzentöne grell, aber insgesamt ist der Sängerin eine respektable Leistung zu bescheinigen. Nach dem dramatisch pulsierenden Duett mit Percy und der fulminanten Auseinandersetzung mit ihrer Konkurrentin Giovanna krönte sie ihre Leistung mit dem souverän bewältigten Finale. Voller Innigkeit ertönte das Gebet „Cielo, a’ miei lunghi spasimi“, furchtlos ging sie den gefürchteten Schlussteil des langen Solos, „Coppia iniquia“, an und erbrachte den Beweis, dass auch eine Sängerin von lyrischem Charakter die Partie überzeugend interpretieren kann. Für mich bot Vasilisa Berzhanskaya als Giovanna die spektakulärste Leistung der Aufführung. Ihr glutvoller Mezzo von ausladendem Volumen, durchschlagender Höhe und satter Tiefe besaß dramatischen Aplomb und lodernde Leidenschaft, was ihre Duette mit Anna und Enrico zu den akklamierten Höhepunkten der Aufführung werden ließ. In Riccardo Fassi hatte sie einen attraktiven Partner in der Partie des Königs – stattlich in der Erscheinung, von viriler Aura und mit voluminösem, kultiviertem Bass aufwartend. Mit René Barbera stellte sich in der Partie des Percy ein idiomatischer Belcanto-Tenor vor – stilistisch untadelig, von strahlendem Klang und sicher in den Extremnoten. Als Page Smeton ließ die amerikanische Mezzosopranistin Karis Tucker eine angenehme, warme Stimme hören, als Annas Bruder Rochefort komplettierte Padraic Rowan die Besetzung mit sonorem Bariton. Glänzend absolvierte der Chor der Deutschen Oper Berlin (Einstudierung: Jeremy Bines) seine Auftritte.

Donizettis „Anna Bolena“ an der Deutschen Oper Berlin/ Szene/ Foto Bettina Stöß
Die Produktion kommt vom Opernhaus Zürich, verantwortet hat sie David Alden in der Ausstattung von Gideon Davey. Letzterer hat die Bühne mit einer hellen, hohen Wand eingefasst, mehrfach wird in den Raum ein halbrundes Holzpaneel herabgelassen, in dessen oberen Öffnungen wie in imaginären Logen Personen postiert sind. Einzelne Versatzstücke wie der Königsthron, das Ehebett, rote Ledersofas, ein Knochenmann mit schwarzer Krone und ein Krankenbett illustrieren die Schauplätze. Unbedeutend sind die Video-Projektionen von Robi Voigt im Hintergrund in düsterem Schwarz/Weiß mit Vögeln, Hunden, Wolken, Wasserfällen und Totenköpfen.
Die Kostüme stellen eine Mixtur aus historischen Gewändern und Kleidung der 1940/50er Jahre für den Chor dar. Von gediegener Eleganz und im Stil der Zeit sind die Roben für die Königin aus feinen Stoffen und mit raffiniertem Faltenwurf. Giovanna trägt zunächst ein modisches Kostüm mit Pelzstola, am Ende aber ein prachtvolles Gewand als die künftige Regentin. Historisch gewandet ist der König, was dessen ohnehin imposante Erscheinung noch attraktiver macht.
Aldens Inszenierung wird bestimmt von einer fast durchweg ironisierten, oft albernen Chorführung. Die Höflinge in Gehrock und Zylinder geraten in ihren Auftritten mit Masken, Regenschirmen und Aktentaschen an den Rand der Karikatur. Gelegentlich müssen sie als Gärtner den ausgerollten Kunstrasen trimmen und am Ende hüpfen sie und auch die Hofdamen übermütig herein, offenbar im Freudentaumel über die neue Königin, während von oben Konfetti herab rieselt, britische Flaggen herunter stürzen und Enrico vor Giovanna schwarze Rosen verstreut. Auch in der Personenführung gibt es eigenwillige Momente, so wenn der König in einem Anfall von Jähzorn das Ehebett zertrümmert oder die Ledersofas mit Fußtritten attackiert. In der Jagdszene bedient sich der Regisseur gar im Sado/Maso–Fundus und lässt Männer mit schwarzen Gesichtsmasken als Hunde hereinkriechen. Neu ist der Einfall, die kleine Elisabeth, Annas Tochter und spätere englische Königin sowie Donizettis tragische Heldin in seinem Roberto Devereux, auftreten zu lassen. Die 4. Vorstellung am 26. Dezember 2023 endete im anhaltenden Jubel des Publikums. Bernd Hoppe
.
.
Verona: Ponchiellis einaktige Buffa Il parlatore eterno und Puccinis Il tabarro im Teatro Filarmonico „Lecco 18. X. 1873“. Keiner ahnt, was damals geschah. Keine Schlacht, kein anderes historisches Ereignis, das in der Geschichte der Stadt am Comer See irgendeine Rolle spielen könnte. Allerdings darf sich Lecco rühmen, einer der Schauplätze der Promessi Sposi von Alessandro Manzoni zu sein. In Lecco wurde 1824 auch Antonio Ghislanzoni geboren, der Medizin studierte, als Sänger zur Bühne ging, aufgrund seiner Mitarbeit bei radikalen Zeitungen in den politisch unruhigen Zeiten zerrieben wurde, nach Paris floh und später in Italien mehrere Zeitungen herausgab. Am berühmtesten wurde er durch seine Libretti für Verdis Aida und La forza del destino.
Außerdem schrieb er Libretti für Carlos Gomes, Errico Petrella, darunter I promessi sposi, Antonio Cagnoni, Lauro Rossi und Amilcare Ponchielli, dem er den Auftrag für I Lituani an der Mailänder Scala vermittelte und mit dem Einakter Il parlatore eterno über eine Schaffenskrise hinweghalf. Dieser Ewige Schwätzer wurde im Oktober 1873 in Lecco aufgeführt. Im März des folgenden Jahres gab Ponchielli mit den Lituani sein erfolgreiches Debüt an der Scala, die fortan sein Stammhaus wurde. Die kann halbstündige Kurz-Buffa ist nicht mehr als eine Fußnote in Schaffen Ponchiellis, ein Scherzo comico, als welche sie in der Edizione von Angelo Rusconi firmiert. Erst 2006 wurde der Scherzo im Teatro Sociale in Lecco neuerlich gespielt, inszeniert übrigens von Stefano Trespidi, der ihn in seiner Funktion als Vice Direttore Artistico der Fondazione Arena ins Teatro Filarmonico nach Verona holte, wo er 2021 unter Corona-Einschränkungen erstmals gezeigt und nun neuerlich aufgelegt wurde.

Ponchiellis „Parlatore eterno“ in Verona 2023/Szene/Foto Ennevi per la Fondazione Arena di Verona – Teatro Filarmonico
Il parlatore eterno, bei der sich Ghislanzoni auf die gleichnamige französische Komödie aus dem Jahr 1805 stützte (Le Parleur éternel von Charles-Maurice Descombes) dürfte einzigartig sein. Die Hauptfigur ist der junge Arzt Lelio Cinguetta, der alle anderen Beteiligten totquatscht bzw. vom Anfang bis zum Ende ununterbrochen redet, so dass sie höchsten mal ein „aber“/„ma“ einwerfen können, darunter seine Geliebte Susetta, deren Eltern, sein Rivale Egidio, eine Kammerzofe und ein Gendarm, die zu Stichwortgebern im Chor der Nachbarn degradiert werden. Anders als Cimarosas Maestro di cappella oder Donizettis Pigmalione ist der Parlatore tatsächlich eine Solo-Show für einen an Rossini geschulten Baritono brillante, der im munteren Plappergesang, den Silbengirlanden und ariosen Aufschwüngen erzählt, weshalb er des Nachts ins Haus der Geliebten eindringt, sich mit seinem Rivalen schlägt und so lange auf Susettas Eltern einschwätzt, bis sie erschöpft ihre Einwilligung zur Hochzeit geben. Rossini ist die Referenz, auch andere Buffonisten der Zeit. Wenn Lelio wie Rossinis Almaviva aber zur Gitarre greift, schimmert ein eigener unverkennbarer Ponchielli-Ton zwischen den Noten auf, der auf die venezianischen Festivitäten der Gioconda, den Tanz der Stunden und die Gesänge der Matrosen, vorausweist. Dieses Changieren zwischen den Buffo-Traditionen des frühen 19. Jahrhunderts und den Forderungen nach einer modernen italienischen Oper im letzten Drittel des Jahrhunderts erfüllt Ponchielli durch eine feingliedrige Orchestersprache, die raffinierter strukturiert ist, als sie auf den ersten Moment klingen mag.
Die Dirigentin Gianna Fratta braucht ein wenig, bis sie sich mit dem Orchester der Fondazione Arena di Verona warmläuft, doch dann erfasst sie den Charme von Ponchiellis einziger Buffa. Der Parlatore ist eine kleine Nichtigkeit, kein großer Wurf, aber eine Stück, das im Gegensatz zur manchmal etwas eckig heterogenen Gioconda wie aus einem Guss ist. Trespidi hat den Scherzo auf der von Filippo Tonon mit weißen Holzwänden sparsam, aber eindringlich möblierten Bühne einfachst inszeniert, die Nachbarn – der Coro der Fondazione Arena di Verona – wie Biedermeierpüppchen in den Proszeniumslogen verteilt und die Stichwortgeber locker aufgereiht. Es ist der Abend des jungen Bassbaritons Biagio Pizzuti, der den Lelio mit der gebotenen schaumschlägerischen Leichtigkeit und Singlust auf die Bühne zauberte.
Wie kann man das Scherzo comico auffüllen. Im Teatro Filarmonico gab es als herben Gegensatz den grellen Neorealismus von Puccinis Il tabarro, den das Regieteam Paolo Gavazzeni, Neffe des Dirigenten Gianandrea Gavazzeni, und Piero Maranghi auf dem von Leila Fteita über die gesamte Bühnenbreite angelegten Seinekahn in den glühende Farben des Abendrots als melodramatischen Schocker inszenierten.
Auch im Tabarro braucht Fratta ein wenig, bis sie in den Fluss der Musik eintauchte (22. November). Gevorg Hakobyan ist ein Michele von raumgreifender stimmlicher Präsenz, mit gut sitzendem und bedrohlich geschärftem Bariton, wuchtig auch der kernige tenorale Draufgänger Samuele Simoncini als Luigi. Der aparten sopranzarten Alessandra di Giorgio, die man in keiner der Partien hören will, die operabase.com für sie verzeichnet, fehlt es dagegen für die Giorgetta an sicherer Höhe, Stimmkraft und Persönlichkeit. Rolf Fath
,
,
Fast unbemerkt vom internationalen Opernbetrieb gab es im Herbst von 2023 eine kleine Sensdation im italienischen Pompeji, das ja eher durch seine antiken Stätten andernweit bekannt ist. Eine seit langem vergessene Oper, die ihre (zu kurze) Auferstehung verdiente, war bereits rund 190 Jahre nach der Geburt des Musikers und Komponisten Temistocle Marzano wiederentdeckt worden. Marzano, Lieblingsschüler von Mercadante, wurde von Salerno, seiner Adoptivstadt , damit geehrt, dass sie seine Oper I Normanni a Salerno im Januar 2006 mit Erfolg in eben dieser Stadt, Salerno, wiederaufführte. Nun gab es, nach einer weiteren Aufführung 2006 in Neapel, eine erneute konzertante Folge im stimmungsvollen Teatro Mattiello von Pompeji, wo der unermüdliche Musikfan Eugenio Palantino es wieder geschafft hatte, diese Oper zur Aufführung zu bringen. Das war am 20 Oktober 2023 in der Produzione Critica di Eugenio Paolantonio.

Marzanos „Normanni a Salerno““ in Pompeji 2023//Foto IMG
Die wirklich hervorragenden Sänger waren in den drei Hauptpartien Davide Maria Sabatino (einfach toll mit schönem Bass als Gualmaro), die bezaubernde Chiara Polese als leuchtende und Aufsehen erregende Bianca, Davide Battinielli (ausserordentlich tapfer und vor allem im zweiten Teil mit leuchtenden Spitzentönen als unglücklicher Ainulfo) sowie mit fabelhaftem Bariton Paolo Cutolo. Dazu kam der Coro filarmonico Jubilate Deo und das exzellente Orchestra Temistocle Marzano unter der federnden Leitung von Maestro Giuseppe Polese. Leider gab es nur „brani scleti“, also die Highlights der Oper, die der Dirigent per Zwischenbericht dem Publikum nahebrachte. Dottore Eugenio Palantino, als Vorsitzender der Temistocle-Marzano-Gesellschaft, trat ebenfalls vor dem eigentlichen Begin auf, bedankte sich beim Sindaco/Bürgermeister von Pompeji, Dott. Carmine Lo Sapio, für seine Unterstützung, weil ohne diesen die Aufführung nicht zustande gekommen wäre. Das Ganze ist nun, in abendliche Dunkelheit gehüllt, bei youtube zu erleben.
Diese Oper, die 1872 das Teatro Verdi von Salerno eröffnete, ist danach wegen ihrer musikalischen Komplexität nun eben nur dreimal gegeben worden. Vier Akte, drei Stunden Musik, fünfzig Orchestermitglieder, vierzig Choristen, mehr als fünfzig Tänzer und Statisten – das erfordert einen enormen Aufwand.
Die Orchesterleitung der Wiederentdeckung in Pompeji hatte man Giuseppe Polese anvertraut, der sich in der Vergangenheit für seinen Einsatz im italienischen Musiktheater einen Namen gemacht hatte. Und die allgemeinen Bemühungen umfassten quasi den ganzen Ort, wie man den zum Teil anrührend-naiven Aufführungsfotos entnehmen kann – es war ein Werk der Liebe.
Die Geschichte spielt im 12. Jahrhundert, als die Normannen unter Wilhelm Eisenarm, Sohn von Tancredi d’Altavilla, der Stadt Salerno gegen den Ansturm der Sarazenen zu Hilfe eilen. Die Geschichte erinnert an den Widerstand der Bevölkerung von Salerno und an die unglückliche Liebe zwischen Bianca, Tochter des Königs Guaimaro und Verlobte von Guglielmo, zu Ainulfo, Verräter am eigenen Volk und an seinem Glauben. Dieser dringt heimlich in den Palast ein, um Bianca vor ihrer Hochzeit zu entführen, womit er scheitert. Er droht, den König Guaimaro zu ermorden, und begeht schließlich Selbstmord, um der Selbstjustiz durch das Volk zu entgehen.
Die Oper I Normanni a Salerno wurde zum ersten Mal am Teatro Verdi von Salerno am 11. Juni 1872 gezeigt und hatte bei Publikum und Kritik großen Erfolg. Dirigent war der Komponist selbst, der nicht zuletzt wegen dieses Erfolgs berechtigte, aber später nicht erfüllte Hoffnungen hegte, dass sein Werk auch an größeren Bühnen aufgeführt werden würde..
Temistocle Marzano hat nur wenig über sein Leben hinterlassen und ist im Musikbetrieb absolut unbekannt. Herausragend ist sein Studium bei Mercadante. Neben seiner Oper I Normanni erinnert man sich vielleicht noch an La Perseveranza (Mailand 1872). Informationen über sein Leben sind fragmentarisch. Er wurde 1820 in Procida geboren und starb 1896 in Salerno. Seine Studien vollendete er am Real Collegia di Musca und am Conservatorio S. Pietro a Majella in Neapel, wo er mit Florimo (Belinis Freund) und Cesi zusammmentraf und von Zingarelli und Mercadante (seit 1840 Direktor des lnstitutes) unterrichtet wurde. Mercadante selbst hielt ihn für seinen besten Schüler. Nach seiner Ausbildung ging Marzano (so sein Biograf Longo) nach Civittavecchia, dann nach Salerno, wo er am Jesuitenkolleg als Maestro Concertatore angestellt war, danach als Leiter des bekannten Theaters La Flora. Von 1869 bis zu seinem Tode stand er dem Orchester und der der Scuola des Waisenhauses (Scuola Musicale dell’Orfanotrofio Umberto I.) und der eigens gegründeten Banda Municipale (1887) vor. Später wurde dann er Direktor des Teatro Verdi in Salerno; und als glühender Patriot und Maestro di Capella Pontificio für Pius IX. verfasste er ein reiches geistliches Oeuvre (darunter ein Requiem, ein „Magnificat„ und eine Messe) neben umfangreicher Gelegenheitsmusik.

Marzanos „Normanni a Salerno““ in Pompeji 2023/Maria Chiara Polese und Davide Battinelli mit dem Dirigenten Giuseppe Polese /Foto IMG
Die Oper I Normanni muss man, ohne zu übertreiben, als eindrucksvoll bezeichnen. Der musikalische Stil Marzanos erinnert (eben in der Folge Mercadantes) weniger die überschäumenden Einfälle einer buffa Rossinis, als vielmehr Echos von Bellini und Donizetti sowie letzten Endes auch von Verdi. Die Einflüsse einer Lucia auf Bianca, der weiblichen Hauptrolle, sind nicht zu überhören. Die Rivalität zwischen zwei Familien und der Konflikt zwischen Vaterlands und persönlicher Liebe finden sich sowohl bei Bellini als auch in den Normanni.
I Normanni a Salerno sind eine opera seria in starken Farben, deren interessante Musik einerseits die vielfältigen Einflüsse des Königlichen Musikkollegs von Neapel widerspiegeln und andererseits die des zeitgenössischen(!) melodramma Verdis. Die Charakterzeichnung eines Don Carlo oder eines Ernani findet sich auch in der Psychologie einer Figur wie der des eifersüchtigen und gewalttätigen Ainulfo oder dem eher heroischen Guaimaro, der einem Bass anvertraut ist und nicht – wie damals üblich – einem Tenor. Die Rollen sind so beschaffen, dass sie nicht leichte, sondern kraftvoll heroische spinto-Stimmen für die Sopran-, Tenor- und Baritonpartie erfordern. Und in der Tat ist die Baritonrolle des Guglielmo einem Silva oder Posa nicht unähnlich.
 Der Wunsch nach dem Zeitgemäß/Modischen lässt sich auch an der Verwendung von zeitgenössisch beliebten Musikstücken erkennen: man findet Triumphmärsche, Fanfaren, brillante Walzer, romantische Melodien, volkstümliche Tarantellen, Gebete und vieles von dem, was wir auch bei Verdi hören – etwa den raschen Wechsel zwischen in sich abgeschlossenen Gesangsnummern und Rezitativen. Es fehlen durchaus nicht originelle harmonische Lösungen und ungewöhnliche Melodien. Bestimmte musikalische Themen sind einzelnen Personen zugeordnet, Leitmotiven vergleichbar, aber später auch in Verdis Aida und dann von Puccini verwendet. Der Chor ist in die Handlungen eingeflochten, wie in den Opern Verdis, und kommentiert die Aktion, drückt die Meinung des Volkes aus, vergleichbar mit der Rolle des Chores im antiken Drama. Ihm gebührt auch das Erflehen des göttlichen Eingreifens, was im Intermezzo von Cavalleria erneut der Fall ist. Die Verbindungen Mascagnis mit Salerno sind ja hinreichend bekannt: Franz Carella benannte 1925 nach dem Komponisten und Freund das historische Liceo Musicale und 1933 das Orchestra Sinfonica „Mascagni“, das dieser begründet hatte und bis zu seinem Lebensende leitete.
Der Wunsch nach dem Zeitgemäß/Modischen lässt sich auch an der Verwendung von zeitgenössisch beliebten Musikstücken erkennen: man findet Triumphmärsche, Fanfaren, brillante Walzer, romantische Melodien, volkstümliche Tarantellen, Gebete und vieles von dem, was wir auch bei Verdi hören – etwa den raschen Wechsel zwischen in sich abgeschlossenen Gesangsnummern und Rezitativen. Es fehlen durchaus nicht originelle harmonische Lösungen und ungewöhnliche Melodien. Bestimmte musikalische Themen sind einzelnen Personen zugeordnet, Leitmotiven vergleichbar, aber später auch in Verdis Aida und dann von Puccini verwendet. Der Chor ist in die Handlungen eingeflochten, wie in den Opern Verdis, und kommentiert die Aktion, drückt die Meinung des Volkes aus, vergleichbar mit der Rolle des Chores im antiken Drama. Ihm gebührt auch das Erflehen des göttlichen Eingreifens, was im Intermezzo von Cavalleria erneut der Fall ist. Die Verbindungen Mascagnis mit Salerno sind ja hinreichend bekannt: Franz Carella benannte 1925 nach dem Komponisten und Freund das historische Liceo Musicale und 1933 das Orchestra Sinfonica „Mascagni“, das dieser begründet hatte und bis zu seinem Lebensende leitete.
Unüberhörbar sind in Marzanos Oper ebenfalls die Einflüsse der später von Mascagni verwendeten Tradition, die auf dem Blasorchester, der banda, von Salerno fußt und die unüberhörbar in der Instrumentation der Normanni vorhanden ist – der Hörnerchor, die Basstuba und die Blechbläser generell. Natürlich ließ auch Verdi sich von den bande musicali Italiens beeinflussen. Und Marzano war ja eine Zeitlang Chef der regionalen banda. Das positive Urteil des kompetenten und strengen Publikums der damaligen Zeit wird von den musikalischen Fachleuten heute bestätigt und lässt keinen Zweifel aufkommen an der Qualität und damit der Bedeutung der Musik Marzanos. Bianca Lo Giudice/ Übersetzung DeepL
.
.
Marianna Bottinis Elena e Gerardo in Rugby. Marianna Bottini wurde 1802 in Lucca geboren. Im Alter von 20 Jahren schrieb sie ihre einzige Oper, Elena e Gerardo. Ein Jahr später heiratete sie, und das war das Ende ihrer musikalischen Karriere. Obwohl ihre geistliche Musik weiterhin aufgeführt wurde, lag diese Oper vergessen in einem Archiv in ihrer Heimatstadt. Erst jetzt wurde sie von Random Opera für eine einzige Aufführung im Temple Speech Room in Rugby (am 28. Oktober 23) wiederentdeckt, einer kleinen Stadt in der Mitte Englands, die für ihren Eisenbahn-Knotenpunkt und ihre Public (d. h. private) Schule bekannt ist, in der das Spiel Rugby Union geboren wurde.

Zu Bottinis „Elena e Gerardo“ in Rugby“/The Temple Room/operabase
Die Handlung erinnert an Romeo und Julia. Elena hat heimlich Gerardo geheiratet, der sich zu Beginn der Oper auf einer diplomatischen Mission im Ausland befindet. Sie ist deprimiert und ihr Vater Pietro beschließt, dass die Heirat mit dem Mann, den sie liebt, das Heilmittel sein wird. Leider denkt er, dass es sich dabei um Vittorio handelt, einen engen Freund von Elena, der in sie verliebt ist, und den besten Freund von Gerardo. In dem Glauben, dass ihr Vater sie für Gerardo bestimmt hat, willigt Elena in die Heirat ein. Doch als Gerardo zurückkehrt und sich herausstellt, dass Elena bereits verheiratet ist (auch wenn Gerardo noch keinen Namen hat), verstößt Pietro sie, Elena bricht wie tot zusammen, und wir werden mit ihrer Beerdigung konfrontiert. Obwohl Vittorio sie großmütig an Gerardo abtritt, ist Pietro so gekränkt, dass er sie vor die Wahl stellt, zwischen echter kindlicher Pflicht und ebenso echter Liebe zu ihrem Mann zu wählen. Schließlich lenkt Pietro ein und die Oper endet glücklich.
Der Flyer der Random Opera versprach: „Ein barockes Belcanto-Juwel, ein Werk voller virtuoser Koloraturen, die an ihren Zeitgenossen Rossini erinnern“. Über das Wort „barock“ mag man sich streiten, aber nach einmaligem Hören trifft der Rest dieser Beschreibung voll zu. Der Abend war praktisch ein einziges Vergnügen. Es gibt in der Tat sehr viele Rossini-Koloraturen, und diese wurden größtenteils sehr eindrucksvoll dargeboten. Herausragend war die Sopranistin Kelli-Ann Masterson als Elena, die eine schöne, ungezwungene Stimme hatte, die in Bottinis ausgefeilten Koloraturen schwelgte. Ebenfalls bewundernswert in dieser blumigen Musik waren Mezzo Katie Macdonald als Gerardo (eine Hosenrolle) und Tenor Rhydian Jenkins als Vittorio. Der Temple Speech Room ist um einiges resonanter als ideal, und dies betraf die Artikulation von Martin Lamb als Pietro, der ansonsten hervorragend war. Sián Griffiths als Laura, Elenas Vertraute oder vielleicht ihre Mutter (ich entschuldige mich für meine Verwirrung), vervollständigte die Besetzung. Es gab einen ausgezeichneten kleinen Chor, von dem fünf die Hauptrollen verkörperten, und ein sehr angemessenes Kammerorchester. Der Dirigent war Thomas Payne, ein Absolvent des Jette-Parker-Programms des Royal Opera Houses; er hielt alles zusammen, alle seine Tempi schienen genau richtig zu sein und er zeigte eine echte Affinität zur Belcanto-Oper. Der Generaldirektor der Random Opera, Richard Tegid Jones, führte Regie, und seine Darsteller überzeugten mit ihrem Spiel und ihren Bewegungen. Alle sahen auf der Bühne gut aus. Es gab kein Bühnenbild und die Requisiten beschränkten sich auf ein paar Stühle. Die Kostüme sahen für meine ungeübten Augen überzeugend nach dem frühen neunzehnten Jahrhundert aus.
Was das Musikalisache betrifft, hatte ich ein Problem. Ich weiß, dass ich in dieser Hinsicht eine kleine Obsession habe, aber mir sind viele „stumpfe“ Phrasenenden aufgefallen, vor allem, aber nicht nur, in den Rezitativen. Meiner Meinung nach hätten Appoggiaturen eingefügt werden müssen. Ist es Zufall, dass Bellini und Mercadante, die ihre Appoggiaturen ausgeschrieben haben, beide in Neapel studiert haben, während Rossini, Donizetti und Bottini, deren Opern Sänger brauchen, um sie einzufügen, alle in Bologna studiert haben? Unterschiedliche Traditionen vielleicht, aber sie alle schrieben in der gleichen lingua franca.

Marianna Bottini née Motroni-Andreozzi (7 November 1802 – 25 Januar 1858)
Und was ist mit der Oper selbst? Ich zögere, nach einmaligem Hören ein verbindliches Urteil zu fällen, aber ich fand den Abend sehr aufregend. Immer wieder sind mir gelungene orchestrale Details aufgefallen, vor allem in den Holzbläsern. Ich hörte auch Dinge, die mich an den frühen Bellini und Donizetti erinnerten; in einem Moment kam mir Donizettis Chiara e Serafina in den Sinn. Manches wirkte wie ein Rückblick auf die Jahrhundertwende und die Komponisten, die in Band 1 (1800 -1810) von Opera Rara’s „A Hundred Years of Italian Opera“ vorgestellt werden. Es stimmt, dass Rossini nie zu weit weg war, wenn auch ohne die ultimative rhythmische Energie, die ihn auszeichnet – aber auch keiner seiner „Nachfolger“ erreicht sie ganz. Diejenigen, für die Belcanto-Oper nichtssagend oder oberflächlich ist, werden Elena e Gerardo nicht nach ihrem Geschmack finden. Aber diejenigen unter uns, die blumigen Gesang an sich berührend finden, werden es sicher genießen. Die Koloraturen halten zu Beginn des zweiten Aktes inne, wenn Gerardo den „Tod“ von Elena über ihrem leblosen Körper auf dem Katafalk betrauert, eine lange und bemerkenswerte Szene mit ausdrucksstarkem Arioso. Es gibt nicht viele Doppelarien, aber es gibt eine Vielzahl von Formen, von einsätzigen Arien bis zu mehrteiligen Ensembles. Die Oper ist dramaturgisch nicht perfekt. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass das Libretto ein wenig nach Jugendliteratur riecht, aber Marianna war kaum aus dem Teenageralter heraus, als sie es schrieb – ja, sie schrieb sowohl Text als auch Musik. Und ja, Pietro bleibt etwas zu lange der starrköpfige Patriarch. Aber alles in allem kann ich dem Urteil von Random Opera nur zustimmen, dass Elena e Gerardo ein Werk ist, das eine Wiederbelebung und Aufführung verdient. Es ist sicherlich eine bemerkenswerte Leistung für eine Zwanzigjährige um 1820, und wir müssen bedauern, dass, wie bei vielen anderen Frauen auch, die gesellschaftlichen Konventionen ihre Karriere stoppten, bevor sie richtig begonnen hatte.
Dem Programmheft ist zu entnehmen, dass es sich bei dem autographen Manuskript nicht um ein fertiges Werk handelt, sondern eher um einen ersten Entwurf mit Markierungen für orchestrale Details. Die Aufgabe, die Aufführungsausgabe zu erstellen, wurde von den Musikwissenschaftlern Ian Schofield und Matthew Smith übernommen, und Richard Jones erkennt auch den Beitrag von Professor Alessandra Fiori an, die zufällig ihre eigenen Forschungen am Istituto Boccherini in Lucca durchführte, wo die Partitur aufbewahrt wird. Unser Dank gilt ihnen allen. Und den Sängerinnen und Sängern, die ihre Partien nur für eine einzige Aufführung gelernt haben. Jetzt, da es eine Aufführungspartitur gibt, ist zu hoffen, dass andere Kompanien sie übernehmen werden. Mir wurde gesagt, dass die Aufführung gefilmt wurde und auf youtube verfügbar sein wird. Alan Jackson (mit Dank an den Autor und die Londoner Donizetti Society)
.
.
Straßburg, Opéra National du Rhin: Laurent Pellys Lakmé: Noch einmal schwirrt Koloraturgezwitscher durch den Blumenhain, klingeln Glöckchen dazu, entsagt eine Priesterin ihrer Liebe. Léo Delibes Lakmé läutet so etwas wie eine Endphase der exotischen Oper, die sich in Frankreich seit Rameau in ferne orientalische Regionen vorwagte und mit einigen Opern Massenets, die sich vom indischen Lahore bis in altägyptische und römische Gegenden träumten, nochmals einen Höhepunkt erlebte. Auch die Musik klingt bei der Wiederbegegnung auf liebeswerte Weise ein wenig angestaubt und gestrig und hat sich nicht so gut gehalten wie andere Werke, die damals an der Opéra-Comique uraufgeführt wurden, etwa Carmen oder Les contes d’Hoffmann.
In Straßburg war Lakmé beispielsweise ein Menschenalter nicht zu sehen, was wundert, da bestimmte, aus der Mode gekommene Werke, die Paris hochnäsig übersah, umso intensiver in der französischen und belgischen Provinz gepflegt wurden. Nach annähernd 70 Jahren kehrte Léo Delibes Oper nun auf die Bühne der Opera National du Rhin in einer Produktion zurück, die bereits in Nizza und an der Opéra-Comique zu sehen war, also dort, wo das Stück nach seiner Uraufführung im April 1883 mehr als unglaubliche 1600 Aufführungen erlebte. Laurent Pelly adaptierte sogar einige wenige der ursprünglichen Sprechexte, die Delibes später für die heute gebräuchliche „internationale“ Fassung durch Rezitative ersetzte.

Delibes´“Lakmé“ an der Strasburger Oper/Szene/Foto Klara Beck
Bemerkenswerter als durch den Rückgriff auf die Originalfassung ist Pellys Inszenierung jedoch durch den kompletten Verzicht auf den indischen Zierrat, die bemalten Veduten, Soffitten und Seitenschals, die Farbenpracht und den Ausstattungsluxus, die bislang als unverzichtbar galten und wie ich sie erstmals in den 1980er Jahren in Bologna erlebte in einer Inszenierung von Alberto Fassini und in der Ausstattung von Pasquale Grossi, die inklusive Luciana Serras Lakmé sogar bis nach Chicago exportiert wurden, von wo aus Grossis Kulissen weiterreisten. Erstaunlicherweise erzielt Pelly aber mit seinen reduzierten Mitteln eine zauberisch verspielte und suggestive Wirkung.
Auch Pelly und seine Ausstatterin Camille Dugas arbeiten mit Soffitten und seitlichen Kulissen, doch alles ist in zarten Elfenbeinfarben gehalten, luftig und leicht. Durch den rückwärtigen hellen Horizont geht ein Riss, Symbol für die verletzte Unschuld der Lakmé, durch den die Europäer, in diesem Fall eine Gruppe von Engländern, in den verbotenen Tempelbereich blicken, wo sich der Engländer Gérald in Lakmé, die Tochter des Brahmanen Nilakantha, verliebt.
Ein bisschen Kolonialismus und indischen Unabhängigkeitskampf haben die Autoren Gondinet und Gille der rührenden Liebesgeschichte untergemischt. Die Liebe ist unmöglich. Ein „rêve“, ein Traum, wie es immer wieder im Text heißt. Wie ein Traum wirkt auch diese federleichte wie aus Papierbahnen gemachte Szenerie, die mit Schattentheater und Gesten und Ritualen fernöstlicher Theaterkunst, etwa des No-Theates, angefüllt ist und in den letzten Momenten der Lakmé nach dem Genuss einer tödlichen Blüte auch den japanischen Butoh-Tanz aufgreift, der als Widerstand gegen westliche Einflüsse entstand. Lakmé wird wie eine Preziose in einem kostbaren Käfig gehalten und in viele Schichten durchscheinender Gazebahnen gekleidet, die Mallika während des Duetts abwickelt. Die sanfte Magie dieser einfachen Theatermittel, die selbst eine Stadtlandschaft hurtig auf die Bühne zaubern, entspricht der welken Exotik von Delibes‘ Musik, die auf gekonnte Weise Sehnsucht und Theaterhandwerk verbindet und durch die Verwendung wiederkehrender Motive ebenso banal wie verführerisch ist.

Delibes´“Lakmé“ an der Strasburger Oper/Szene/Foto Klara Beck
Man merkt, wie aufmerksam Delibes auf die Werke seiner Kollegen, etwa auf Offenbach und dessen Contes d’ Hoffmann, reagiert. Guillaume Tourniaire kostet die nostalgischen Momente dieser exotischen Spätblüte aus, stellt mit dem Orchestre symphonique de Mulhouse dieses besondere französisch elegische Flair zwischen Kaffeehaus und Großer Oper her; selbst der nicht ganz schlackenfreie Klang passt. Sabine Devieilhe, eine fragile Koloratursängerin in der Nachfolge ihrer Landsmänninnen Natalie Dessay und Patricia Petibon ist vermutlich die Lakmé unserer Tage. In der berühmten Air des clochettes „Où va la jeune Hindoue“ lässt sie nicht nur feinste Koloraturakrobatik aufleuchten, sondern wartet mit kunstvoller messa di voce und fast zerbrechlichen Nuancen auf. Ihr Sopran wirkt selbst im intimen Straßburger Haus nicht besonders groß, doch er schimmert in elegischen Farben und zielt mit zärtlichen Silben während des Liebestods mitten ins Herz der Zuhörer. Mit harscher Emission und hartem Ton gibt Julien Behr den Kolonialoffizier Gérald, der sich in „Fantaisie au devin mesonge“ mit heldisch draufgängerischem Klang freisingt. Behr ist eine sichere Wahl für diese Partie. Mit kraftvollem und prägnantem Bassbariton sang und gestalte Nicolas Courjal den wütenden Nilakantha, auffallend keck gab Guillaume Andrieux Gérards Freund Frédéric, der das reizende comiquehafte Quintett des ersten Aktes anführt, während Ambroisine Bré als Lakmés Begleiterin Mallika im Blumenduett unauffällig blieb. Ingrid Perruche war die naseweise Mistress Bentson. Nachdrücklicher Applaus (2. November) für eine verblasste Ikone der französischen Oper. Rolf Fath
.
.
Die Fondazione Arena und das Teatro Filarmonico zeigten Amleto des Veroneser Komponisten Franco Faccio nach einem Libretto von Arrigo Boito. Die Oper wurde 1865 in Genua am Teatro Carlo Felice mit großem Erfolg uraufgeführt. Einige Jahre später wurde sie an der Mailänder Scala wiederaufgenommen, wo sie vom Publikum so schlecht aufgenommen wurde, dass Franco Faccio beschloss, die Partitur zurückzuziehen und sie in Vergessenheit geraten zu lassen.
Die Inszenierung des Filarmonico ist somit die erste italienische Aufführung in der Gegenwart. Eine innovative und mutige Entscheidung des Veroneser Opernhauses. Die Oper ist in der Tat aus mehreren Gründen interessant, angefangen bei dem kuriosen Libretto von Arrigo Boito, das der „scapigliatura“ gewidmet ist, einer für die damalige Zeit neuen und provokanten literarischen Strömung. Eine gute Übung also für Boitos spätere große Shakespeare-Reduktionen, die von Verdi vertont wurden.
Gewiss, Boito scheint es manchmal zu übertreiben mit Zitaten, mit Begriffen aus der Zeit Dantes, mit gewagten metrischen Mischungen. Das war damals im Mailand der Mitte des 19. Jahrhunderts in Mode: neue Kunst, prätentiös, mutig. Die Musik von Franco Faccio hat manchmal Mühe sich anzupassen, aber sie überzeugt an mehreren Stellen, vor allem in der großen Begräbnisszene des dritten Aktes. Natürlich bleiben die ‚geschlossenen Stücke‘ erhalten, aber sie werden immer mit Originalität und Experimentierfreude behandelt. Man hört die Offenheit für die europäische Sinfonik. Man spürt, dass Wagner jenseits der Alpen angekommen ist.

Faccios „Amleto“ am Teatro Filarmonico Mailand/Szene/Foto EnneviFoto
Die dramaturgische Umsetzung war prägnant, theatralisch, voller Mischungen aus Tragik und Komik: Das an Ophelia gerichtete „fatti monachella…“ (etwa: „Mach dich zum Nönnchen“) ist in diesem Sinne erhellend. Boito und Faccio sind kompromisslos und wählen keine einfachen Wege: Besonders im ersten Akt haben wir eine straffe Handlung, in der der Chor fast immer präsent ist und die Figuren zwischen den Chorpassagen theatralisch agieren müssen. Auch das abschließende Duell ist nicht ohne Action und verlangt vom Protagonisten, der sich in der Szene mit den Totengräbern mit Laerte prügeln muss, eine gewisse Körperlichkeit.
Die Inszenierung von Paolo Valerio war im Wesentlichen klassisch, effektiv vor allem in den düsteren Szenen wie die der Totengräber und der Beerdigung Ophelias, in denen es ihm gelingt, den Chor wirkungsvoll zu bewegen. In den theatralischeren Szenen hingegen fehlt es an Erfindungsgeist und man verlässt sich auf banale Tableaux vivants und theatralische Posen.
In der Scheinkomödie werden die wandernden Schauspieler, die an den Hof von Elsinore gekommen sind, durch den derv Puppenspieler Hamlet in Marionetten verwandelt, die an roten Fäden hängen. Die Idee ist interessant, die szenische Umsetzung leider weniger. Seltsamerweise übersetzt Boito sie im Libretto sehr frei als ‚Sänger‘ (Cantori) und nicht als Schauspieler, denn auch sie müssen im Stück ein Drama mit Musik spielen. Alles dreht sich also um die Oper: Boito will die Welt der Oper erneuern, und sein Hamlet soll ein Beispiel dafür sein.
Zu zahlreich und nicht immer aussagekräftig sind die Projektionen, die ständig auf mehreren Tripolinvorhängen gezeigt werden. In der emblematischen Szene von Hamlets Selbstgespräch kommt ein Spiegel zum Einsatz, der etwas zu sehr an die identische Lösung von Kenneth Branagh in der Hamlet-Verfilmung von 1996 erinnert. Die Kostüme von Silvia Bonetti sind auf der einen Seite sehr geradlinig, aber auf der anderen Seite nicht besonders originell, dafür aber sehr gut geeignet, einen illustrativen Effekt zu erzielen.
Das Fehlen einer gründlichen Theaterarbeit ist spürbar, so dass es allzu oft an Realismus mangelt. Die Inszenierung ist jedoch fair, ebenso das ehrliche Bemühen, die Komplexität der Oper theatralisch darzustellen.
Insgesamt war das Sängerensemble gut, wobei Angelo Villari die Schwierigkeiten der Hauptrolle mit einer festen, klangvollen und wohlklingenden Stimme souverän meisterte. Ihm zur Seite stand der Claudio von Damiano Salerno: eine klare Stimme, hervorragend intoniert und präzise in der Phrasierung. Marta Torbidoni überzeugte als Gertrud mit Stimme und Volumen und gab eine entschlossene und willensstarke Königin. Gilda Fiume übertreibt, indem sie die schwierige Partie der Ophelia zu zart gestaltet.
Vorsichtig, aber immer professionell der Rest der großen Besetzung: Francesco Leone, Alessandro Abis, Davide Procaccini, Saverio Fiore, Abramo Rosalen, Enrico Zara, Francesco Pittari, Marianna Mappa, Nicolò Rigano, Maurizio Pantò, Valentino Perera. Giuseppe Grazioli dirigierte mit Aufmerksamkeit und brachte besonders die pompöse Seite der Partitur zur Geltung. Raffaello Malesci (22. Oktober 2023)
.
.
Scheidungskinder im Theater Bielefeld: Leoncavallos Zazà: Zazà ist Künstlerin. In Leoncavallos Oper, deren Text er unter Mitarbeit von Carlo Zangarini verfasste, tritt sie im Alcazar in Saint-Étienne als Varieté-Künstlerin auf. Im gleichnamigen, 1898 in Paris uraufgeführten Schauspiel von Pierre Berton und Charles Simon ist sie ei-ne Prostituierte, die sich ihren Platz im Unterhaltungsbusiness erkämpfen muss.
Bei dem Leiter des Musiktheaters des Theaters Bielefeld Michael Mund ist Zazà eine Zirkuskünstlerin (Nadja Loschky leitet seit Beginn dieser Spielzeit nicht mehr die Musiktheater-Sparte und ist – wie das Theater Bielefeld schreibt – gegenwärtig Mitintendantin und künftig Alleinintendantin.). Manuel La Casta hat anstelle des Backstage-Milieus einen schäbigen Artistenbereich hinter einem kleinen Zirkuszelt auf die Bühne gestellt. Unter den Leuchtketten und zwischen den phantasievollen Tänzer- und Akrobatenkostümen (Irina Spreckelmeyer) ist die Trostlosigkeit des Artistenalltags mit aufgetürmten Koffern, ram-schigen Utensilien und Requisiten erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Über dieser Installation zum Thema Trostlosigkeit des Artistendaseins, wozu eine Bärtige im 1900-Unterkleid und Brustkorsett noch vor Leoncavallos kurzer Introduzione über Reinheit und Nichts, Freiheit, Wahnsinn und Tod räsoniert, knallt die Musik Leoncavallos, die Bielefelds Kapellmeisterin Anne Hinrichsen gewaltig aufbäumend und exzessiv in den Artistenalltag fahren lässt und mit den Bielefelder Philharmonikern eine Intensität erzeugt, die sich über die vier Akte wölbt und Zazà zur großen Schicksalstragödie stilisiert Das Publikum ist gebannt (15. Oktober 2023). Die Tingeltangel-Diseuse Zazà benimmt sich kapriziös wie der Star eines erstklassigen Etablissements, rümpft ob des besseren Engagements, das ihr der Ex-Geliebte und Partner Cascart in Aussicht stellt, die Nase. Alles nur, weil sie sich aufgrund einer Wette mit Bussy in den Kopf gesetzt hat, den Geschäftsmann Milio Dufresne zu ver-führen. Milio lässt sich verführen, liebt Zazà irgendwie wohl auch, die sich ihrerseits heftig verliebt hat und sich an ihn krallt. Milio steht vor einer Reise nach Amerika. Zazà wird misstrauisch, reist nach Paris, erkennt, dass er verheiratet ist und eine Tochter hat und beichtet ihm das bei seinem Abschiedsbesuch in Saint-Étienne, worauf er sie als Hure beschimpft. Da ist es, das böse Wort. Zazà stellt alles richtig: Nichts hat sie erzählt. Trotzdem ist die Affäre zu Ende, „tutto è finito“. Wie sich die Kurtisane aus der „Kameliendame“ in Verdis Traviata zur selbstlos Verzichtenden adelt, wirft die Oper auch über die Künstler-Prostituierten Zazà den Mantel selbstlo-ser Hingabe.

Leoncavallos „Zaza“ in Bielefeld/Szene/ Foto Sarah Jonek
Zazà bewahrt Milios Tochter Totò vor dem Schicksal, ohne Vater aufzuwachsen. So wie sie, nachdem dieser ihre Mutter Anaide verlassen hatte, ohne Vater aufwuchs. Sie weiß, was Anaide als Alleinerziehende durchzustehen hatte und versorgt sie jetzt mit Geld, wohl wissend, dass es für Anaides Alkoholkonsum draufgeht. Mit erdig-markantem Dunkelmezzo macht Alexandra Ionis viel aus der markanten Episo-denrolle. Manuel La Casta zeichnet die Stationen der Tragödie eindrucksvoll nach. Von Zazàs sauber einfacher Unterkunft bis zum bürgerlichen Wohlstand in Milios Pariser Heim, wie ihn sich Zazá auch vorstellen könnte. Immer sind die Zimmer nur hinter Türen zu erahnen. Hier die Künstler-Absteige mit einfachen Stühlen auf dem Flur, dort das Klavier hinter der Tür, eine kunstvolle halbrunde Kommode und Sitzmöbel im Milios Entrée mit Hausdiener. Das hat viel Atmosphäre, die Loschky mit berührenden Porträts auffüllt. Anfangs natürlich die Kollegen und Freunde Zazàs, die bis auf den Liedchen-Textdichter Bussy (Todd Boyce mit leichtem, aber prägnantem Bariton) in den hurtigen Skizzen kaum greifbar werden: Andrei Skliarenko als Courtois, Yoshiaki Kimura als Duclou, Cornelie Isenbürger in der Doppelrolle als Zazà Konkurrentin Floriana und Milios Gattin, Dumitru Sandu als Augusto (Choreographie: Sarah Delterne).
Die 1900 in Mailand unter Toscanini uraufgeführte vieraktige commedia lirica behandelt einen Paris-Stoff, wie in Leoncavallos La Bohème von 1897, die bald von der bereits ein Jahr zuvor uraufgeführten Boheme des Kollegen Puccini überstrahlt wurde. Das Künstlerleben von Paris hatte Leoncavallo ab 1882 als Komponist von Chansons und Begleiter von Café-Sängern, dann als Gesangslehrer, Korrepetitor und Begleiter von Stars wie Emma Calvé und der Massenet-Muse Sybil Sanderson verinnerlicht. Das ist in den Außenakten seiner Zazà zu spüren, deren Hinterbüh-nen- und Tingeltangel Situation ein Vergnügungsetablissement in der französischen Provinz nachzeichnet. Genauer das Alcazar in Saint-Étienne, ein Café-chantant, wie es Leoncavallo genau kannte, und die Wohnung von deren Star Zazà. Wenig glanzvoll, herabgesunken. Genauso ist das Drama der Zazà ein schludriger Kameliendame-Abklatsch. Zazà beschließt ihren geliebten Milio für sei-ne Familie freizugeben. Den Ausschlag gibt beim Überraschungsbesuch in Milios Pariser Heim die Begegnung mit seiner niedlichen Tochter Totò. Und als Totò, eine Sprechrolle, am Klavier auch noch das Ave Maria von Cherubini spielt, ist Zaza endgültig von ihrer gutne Mission überzeugt. Interessant ist das Ave Maria bzw. der Klaviervortrag, weil das Mädchen durchgehend über der Musik spricht. Ähnlich wir-kungsvoll hatte bislang nur Giordano das Klavier solistisch im zweiten Akt seiner Fedora eingesetzt. Wirkungsvoll ist vieles in Zazà, auch das in der Musik immer wieder durchschimmernde Pagliacci-Idiom aus Wollust und „La commedia è finita“-Schicksalsergebenheit, Wirkungsvoll ist aber vor allem die Titelrolle, welche die aus Bosnien und Herzegowina stammende Dušica Bijelić mit müdem Funkeln in den Augen spielte, das zum Leuchtfeuer wird, und mit einem jener flirrenden, nervös vibrierenden Sopranstimmen sang, die erst in emotionalen Aufschwüngen und Ausnahmesituationen ihre wahren Dimensionen erweisen. Brav und artig daneben der kroatische Kollege Nenad Čiča, der mit schmal hellem und gut fokussiertem Tenor den Milio gibt, der in dem hübsch geträllerten Liedchen „È un riso gentile quall’alba d’aprile“ hinter der Fassade des leichtfertigen jungen Herren den skrupellosen Verführer verbirgt. Die kleine Arie ist einer der wenigen Solonummern der Oper. Bekannter freilich ist der Bariton-Schlager im vierten Akt, mit dem Cascart Zazà nach der Enttäuschung zu trösten versucht; aus „Zazà, piccola zingara“ hätte der sich ins outriert Sprechstöhnen verflüchtigende angenehme Leichtbariton Evgueniy Alexiev mehr machen müssen. Nicht vergessen werden soll Giulia Rabec als Totò. Rolf Fath
..
.Annaberg-Buchholz: Späte Uraufführung von Alberto Franchettis Komödie Don Buonaparte. Der Dorfpfarrer in Nöten: Aus Siena sind ein Advokat, ein Ritter und ein Klosterbruder bei der Nachricht, Don Geronimo werde bald als Kardinal nach Paris ziehen, herbeigeeilt, damit er sie rette. Alle drei haben sich in dubiose Machenschaften verwickelt und erwarten von dem künftigen Kirchenfürsten, dass er das Gesetz breche und ihnen helfe. Findig weisen sie ihn in die italienische Bestechungspraxis ein. Don Geronimo ist entsetzt und jagt sie aus dem Haus, „Schurken, Halunken“ und was er ihnen noch alles hinterher ruft. Hätte uns nicht bereits zuvor Don Geronimos leidenschaftliches Liebesbekenntnis zu der „von Gott geküssten“ Toskana an den bauernschlauen Gianni Schicchi erinnert, der sein Florenz in den höchsten Tönen besingt, würde uns spätestens bei den Schmeicheleien der drei Betrüger die florentinische
Bagage in Puccinis Erbschleicher-Komödie Gianni Schicchi einfallen. Beim Gedanken an Paris, wohin ihm seine Schäfchen folgen wollen, kann Don Geronimo nicht verstehen, dass jemand, der hier geboren ist und die Felder bestellt hat, bereit wäre, diesen gepriesenen Flecken Erde zu verlassen. Don Geronimo Buonaparte, Pfarrer eines kleinen Dorfes in den toskanischen Bergen, erfährt eines Tages im Jahr 1804,
dass sein Neffe Napoleon Kaiser geworden ist, ihn der Papst in Rom zum Kardinal ernennen will und er sodann mit großem Gepränge zur Krönung nach Paris reisen soll. Die Nachricht versetzt das Dorf in Aufruhr. Mit dem beschaulichen Leben ist es vorbei, da viele ihren Nutzen aus dem Aufstieg ihres Pfarrers ziehen wollen. Don Geronimo wägt die angebotene Ehre gegen sein ruhiges Leben ab und entscheidet sich für seine Dorfgemeinde.
Beide Toskana-Komödien stammen aus der Feder Giovacchino Forzanos. Die erste schrieb er – zusammen mit Suor Angelica – für Puccinis 1918 uraufgeführtes Trittico, die zweite gut zehn Jahre später als Vehikel für einen populären Schauspieler. . Während das Bühnenstück und der daraus entstandene Film Erfolge wurden, blieb die auf Forzanos Komödie basierende Oper von Alberto Franchetti unaufgeführt.
Das holte nun Annaberg-Buchholz nach, wo am 14. Oktober 2013 das Eduard-von-Winterstein- Theater in den italienischen Farben illuminiert war und sowieso alle und alles auf die musikalische Komödie „mit Ergänzungen von Helmut Krausser“ von einem „der Großen der Giovane Scuola, der jungen Schule Italiens, zu der auch solche legendäre Komponisten wie Giacomo Puccini, Pietro Mascagni und Ruggero Leoncavallo gehören“ eingestimmt waren. Der Abend endete mit donnerndem Applaus.
Nach Asrael an der Oper Bonn scheint Franchetti einen guten Lauf zu haben. Alberto Franchettis Glanzzeit war lange vorbei, als er sich Ende der 1930er Jahre mit der komischen Oper Don Buonaparte beschäftigte. Für die erste Oper seines 1860 in Turin geborenen Sohnes hatte Albertos Vater Baron Franchetti, schwerreicher Großgrundbesitzer und Unternehmer, 1888 noch das Theater in Reggio Emilia gemietet. Dann kam Albertos Karriere von selbst ins Rollen. Verdi empfahl Franchetti für eine Cristofero Colombo-Oper, die 1892 zum 400. Jahrestag der Entdeckung Amerikas in Genua herauskam. Und schließlich dirigierte Toscanini 1902 die Uraufführung von Germania mit Caruso an der Mailänder Scala. Die überall aufgeführte Studentenoper aus dem alten Nürnberg bildet den Höhepunkt von Franchettis Karriere, die nicht nur aufgrund der Rassengesetze in Italien 1938 zum Erliegen kam: Franchetti entstammte einer jüdischen Familie. 1942 starb er in Viareggio.

Zandonais Don „Buonaparte“ in Annaberg/Szene/Foto Ronny Kuettner
Ganz am Ende seines Schaffens wollte es der 80jährige nochmals wissen. 1939 bis Januar 1941 befasste er sich mit der Opera comica Don Buonaparte. Der Text stammte von Giovacchino Forzano (1884-1970), der einige Male für ihn tätig war, sich vom Theater abgekehrt und sich im Freundeskreis um Mussolini mit Propagandafilmen für die Sache des Faschismus stark gemacht hatte. Das gleichnamige Theaterstück hatte er bereits 1931 für den populären Schauspieler Ermete Zacconi, der um die Jahrhundertwende auch Wien in Raserei versetzt hatte, maßgeschneidert, der damit große Erfolge gefeiert hatte. Man weiß nicht, wer den ersten Schritt unternahm, doch wird vermutet, dass sich Franchetti bezüglich des Librettos an den alten Weggefährten wandte, in dessen alter- tümlichen Toskana-Idylle und den prall gezeichneten Figuren er einen Gegenentwurf zu den Brüchen und Wirren der Zeit fand. Die Oper wurde nie aufgeführt. In den von Forzano als norditalienisches Gegenstück zu Cinecittà gegründeten Studios in Tirrenia, denen er 1934 als Abkürzung aus Pisa und Livorno den Namen Pisorno gab, wurde allerdings 1942 das überaus harmlose nostalgische Lustspiel Don Buonaparte als „von Anfang bis Ende“ abgefilmtes Theater produziert (leicht auf youtube zu finden). Der 84jährige Ermete Zacconi, Urvater einer Schauspieler-Dynastie, erhielt für seine Darstellung, die veristische, naturalistische und karikierende Momente verband, bei der Biennale in Venedig den Preis als bester Schauspieler.
Die Musik stammt allerdings von dem Film- und später auch Opernkomponisten Renzo Rossellini. Ausschnitte der Oper gelangten im Dezember 2022 in Reggio Emilia im Rahmen eines Projekts zum 80. Todestag von Franchetti zur Aufführung, wobei auch der alte Film gezeigt wurde.
Es liegt auf der Hand, in Don Buonaparte des 80jährigen Franchetti einen altersweisen Abschied vom Leben und von der Oper zu sehen und ihn mit dem Falstaff des fast 80jährigen Verdi zu vergleichen. Dazwischen liegt ein halbes Jahrhundert, in der die italienische Buffooper durch Puccini und Wolf-Ferrari einen letzten Abgesang erlebt hatte. Ein halbes Jahrhundert liegt auch zwischen Franchettis erstem Erfolg und Don Buonaparte. Franchetti will das vergessen lassen.
Wäre Don Buonaparte vom Gackern der Hühner bis zum Ticken der Kuckucksuhr vielfach nicht so kleinteilig glänzend und sprechend instrumentiert und in der solistischen Bravour der Instrumente nicht jede Note so bedächtig gesetzt und abgestimmt, würde man diese artige Idylle, in die nur selten das Brodeln des 20. Jahrhunderts dringt, tief im 19 Jahrhundert verorten. Das Terzett der Halunken (Richard Glöckner, Jakob Hoffmann, Volker Tancke), das Terzett der Mattea mit ihren beiden Tenor-Verehrern, dem tölpelhaften Kirchendiener Maso und dem runden Korporal, das Quintett im dritten Akt sowie die Ensembles im zweiten und dritten Akt sind in bester italienischer Buffomanier entworfen und patent durchgeformt. Für die toskanische Idylle sorgen Vor- und Nachspiele, Bläserakzente für die Aufmärsche der Franzosen.
GMD Jens Georg Bachmann und die Erzgebirgische Philharmonie Aue nehmen die Herausforderungen mit höchstem Geschick an. Das Glanzstück ist Don Geronimos Monolog im zweiten Akt, das Lászlo
Varga mit schön geführtem Bass und viel Empfindung, baritonal expansiver Höhe und sauberer Kantilene mitreißend gestaltete und die menschlich anrührende Seelengröße des Pfarrers sanft streifte. Zu den guten Momenten zählen auch die schönen Verflechtungen in den Ensembles, dazu ein paar ariose Versatzstücke des mit prachtvollem Bariton auftrumpfenden Jinsei Park als General, der wie eine Schwester von Puccinis Lauretta mit blitzsauberer Höhe silbern zirpenden Sophia Keiler als
Mattea und des mit adrettem Nemorino-Charme etwas tenoral engen Corentin Backès als Maso sowie die routinierte Tenorgrandezza von Kerem Kurk als Korporal. Doch selbst den amorosen Verstrickungen fehlt es an echter Leidenschaft. Dramatische Entwicklungen darf man in dieser pastoralen Landschaft nicht erwarten; Don Geronimo ist eben kein Don Camillo. Er freut sich über volle Weinfässer und sein wiedergefundenes Huhn Bianca. Das führt im knapp 60minütig endlosen ersten Akt zu ellenlangen rezitativischen Wortwechseln zwischen der Haushälterin Agnese und Matteas Mutter Maria und arg betulichen Parlando-Erzählungen der anderen.

Zandonais Don „Buonaparte“ in Annaberg/Szene/Foto Ronny Kuettner
Und immer wieder wirkt der Dreiakter, der das 19. Jahrhundert nicht ironisch aufgreift, seltsam eckig und steif, handwerklich unausgeglichen und, wie auch Asrael, wenig kohärent, und trotz aller serenen Abgeklärtheit auch ziemlich langweilig. Lev Pugliese, Ausstatter und Regisseur aus Italien, ahnt, dass dem Stück nur mit einer unretuschierten Inszenierung beizukommen ist. In diesem Sinn vergegenwärtigt er die sen timentalen Toskana-Bilder mit alten Veduten und Gemälden wie von einem italienischen Ludwig Richter gemalt, die bereits während der Einleitung lebendig werden, mit Federvieh und Pferden und Landvolk, mit einer Pfarrhausküche mit offenem Feuer, Kupfergeschirr, Knoblauchsträngen und einem Huhn am Fenster, einem Campo im zweiten Akt, wie für Elisir d’amore, alles wunderhübsch und aus der Zeit gefallen.
Einen kleinen Annaberg-Tupfer bringt er in der Szene an, in der sich Don Geronimo am Ende des ersten Akts eine Zukunft im Kardinalspurpur erträumt und sich in die St. Annenkirche, Annabergs Wahreichen, versetzt sieht. Pugliese hat zweifellos ein Händchen für possierlich animierte Genrebilder aus dem Opern-Museum, über die man die Nase rümpfen kann. An diesem Abend passen sie. Rolf Fath
.
.
Adams Oper Wenn ich König wär´ in Hildesheim: Das Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim macht mit einer Neuinszenierung der heute nur noch selten auf Spielplänen auftauchenden Märchenoper von Adolphe Adam erneut auf sich aufmerksam. Außer dem Postillon von Lonjumeau oder den Balletten Giselle und Le Corsaire sieht man heutzutage kaum etwas von den übrigen an die vierzig komischen Opern und Balletten von ihm. Regie und Bühnenbild lagen in der Hand von Christian von Götz, der das Ganze unter das Motto „Enrichisséz-vous!“ (Bereichert euch!) stellte, das sich vielseitig auslegen lässt. Man hatte sich für die deutsche Übersetzung mit Übertiteln von Karlheinz Gutheim und Wilhelm Reinking in vereinfachter Sprache entschieden, was moderne Anfeuerung wie Lassen Sie die K… qualmen hervorbrachte. Ein Soziologe wurde in die Geschichte eingeführt, der das Ganze als Experiment zu „Macht macht schlecht“ gestaltete und ständig begleitete; er sprach darüber hinaus in differenzierten Mundarten die Dialogtexte aller Beteiligten, die selbst nur mimisch verdoppelnd agierten. Das hatte den Vorteil, dass ausländische Sänger nicht mit so viel Sprechtext belastet wurden, aber den großen Nachteil, dass das ständige Herumwuseln des Soziologen von einer Figur zur Anderen die Sache verzögerte und schnell langweilig wurde. Zur Vereinfachung der Bühne hatte man gestaffelt mehrere leicht mit großen Ringen verschiebbare Zwischenvorhänge angebracht, die den jeweiligen Handlungsort treffend kennzeichneten. Knallbunte phantasievolle Kostüme für den König und sein Gefolge sowie schlicht weiße Kleidung für die Fischer passten gut dazu (Amelie Müller).

Adams Comique „Wenn ich König wäre“ in Hildesheim/Szene/Foto Jochen Quast
Die musikalische Leitung hatte Hildesheims GMD Florian Ziemen, der mit klarer Zeichengebung sein frisch aufspielendes Orchester wieder zu besten Leistungen zu animieren wusste. Von den Solisten ist zunächst Yohan Kim zu nennen, der den braven Fischer Zephoris lebendig und für einen Tag als König mit solider Bodenhaftung darstellte; mit seinem strahlend auftrumpfenden Tenor fand er aber auch zu gutem lyrischen Legato . Die von ihm angebetete Prinzessin Nemea wurde von Sonja Isabel Reuter als emanzipierte Frau gespielt, die sich schließlich auch gegen die sprachliche Hilfe des Soziologen auflehnt; mit sicherer Höhe und freien Koloraturen ihres schlanken Soprans überzeugte sie rundum. Felix Mischitz bot den biegsamen, eitlen König mit kleinem, feinem Bariton, der sich auch in den Ensembles durchaus behauptete. Den um die Liebe Nemeas mit Intrigen gegen seinen Konkurrenten kämpfenden Prinz Kadoor gab Maciej Gorczyczynski passend mit finsterem Gebaren und markigem Bass. Als zweites Paar bildeten Martha Matcheko als Zelide mit lyrischem Sopran und Julian Rohde mit hellem Tenor als Pifear fast einen Ruhepol in dem ganzen Trubel. Als Kanzler war Eddie Mofokeng mit seinem wunderbar weichen Bariton diesmal schlicht unter Wert eingesetzt. Nicht zuletzt ist natürlich Uwe Tobias Hieronimi als Soziologe und Strandvogt Zizell zu nennen, der zum Amüsement des Publikums schon allein textlich eine ungeheure Gedächtnisleistung bei den zahlreichen Dialogen vollbrachte und dazu noch einen reichen Bewegungskanon zu absolvieren hatte. Daniel Chopov (Alter Fischer), Chun Ding (Höfling) und Jesper Mikkelsen (Sekretär des Königs) rundeten das Ensemble sicher ab. Warum Natascha Flindt als Ballerina die Giselle zwischendurch über die Bühne tanzen musste, hat sich mir nicht erschlossen; offenbar sollte kein Moment der Ruhe einkehren. Es wurde pausenlos mit Armen, Beinen oder Gegenständen in der Gegend herum gezappelt. Nicht unerwähnt bleiben soll der klanglich ausgeglichene, sichere Chor, der auch im Spiel munter agierte (Einstudierung: Achim Falkenhausen).
Das Publikum bedankte sich mit begeistertem Applaus für einen musikalisch äußerst gelungenen, aber szenisch überbordenden Abend. Marion Eckels (4.10.2023)
.
.
Donizettis Oper Les Martyrs vom Theater an der Wien: Eine sehr seltene Gelegenheit, die Neufassung des unglücklichen Poliuto (1838) zu erleben, den Donizetti nie auf der Bühne erleben konnte und der sich als tödlichen Schicksalsschlag für den armen Tenor Nourrit erwies, bot das Theater an der Wien, das wegen Restaurierung geschlossen ist und derzeit im nahe gelegenen Museums Quartier untergebracht ist: Ein kulturelles Ereignis von höchstem Interesse und auch ein solcher Teil-Erfolg, der leider durch eine absurde Inszenierung beschädigt wurde, die teils jubelnd und großen Teils mit orkanartigen Buhs aufgenommen wurde, um sodann, wie es immer öfter in modernen Aufführungen geschieht, vom genervten Publikum mit christlicher Resignation hingenommen wurde (aber der Märtyrer war der arme Donizetti, der dies nicht verdient hatte).

Donizettis Oper „Les Martyrs“ in Wien/Szene/ Foto Werner Kmetitsch
Natürlich ist jede Neuinszenierung ein Risiko und kann gefallen oder nicht, aber sie sollte zumindest Sinn machen und den Inhalt, den die Übertitel des Gesungen wiedergeben, zumindest annähernd vermitteln. Man ist ja inzwischen daran gewöhnt, in den meisten Neuaufführungen eine virtuelle Augenbinde zu tragen, um sich vor den schlimmsten Perversionen der Optik und Verfremdungen des Plots zu schützen. Hier nun lernten wir während der Ouvertüre, dass sich die Römertochter Paulina in Aurora Mardiganian, der Überlebenden des armenischen Völkermords von 1915 und in all die „Anderen“ aller Zeiten verwandelt hatte, und dass es sich um eine Opern-Anklage gegen die Türkei und deren Genozid an den Armenien handelte. Zur Musik von Donizetti. Zum Schluss sieht man Menschen in T-Shirts mit jeweils dem Namen eines Märtyrers darauf! Povero Gaetano.
Regisseur Cezary Tomaszewski, der in den absolut grässlichen Bühnenbildern und den hässlichen Kostümen von Aleksandra Wasilkowska diese in Blut schwimmende Polit-Doku inszeniert hatte, stolperte von einer unfreiwilligen Komik zur nächsten Peinlichkeit, man konnte ihn nicht ernst nehmen. Völkermord zu Belcanto-Musik. Dazu das Ballett von Barbara OIech in mehr als riskanten Posen und Kostümen (Tänzer sind nie sexy!). Perverser ist nicht möglich. Und langweiliger auch nicht. Alles schon gesehen.
Und das ist ebenso leichtfertig und gemein wie den Holocaust mit Walzerklängen auf die Bühne zu bringen und denunziert die fraglosen Opfer einmal mehr, nur weil ein Regisseur sich profilieren will. Niemandem ist damit gedient, Donizetti und den Armeniern am wenigsten. Aber leider wird´s wohl ein Video geben. Am Radio später hörten man sehr dünnen Beifall. Auf Wien ist doch Verlass.
Das Ganze konzertant wäre im Ergebnis respektabel gewesen. Jérémie Rohrer ist in im Heimatland, namentlich Paris, ein hoch angesehener Maestro. Er ist zwar kein Belcanto-Experte, aber in Anbetracht der schrecklichen Akustik im Museums-Saal riss er mit seinen mehr flotten Tempi das Publikum mit und machte vieles wett. Im Gegensatz zur Opera-Rara-Aufnahme war dies eine außerordentlich flotte Angelegenheit, wurden die Tempi am Pult des ORF (Radio-Symphonieorchester Wien) zum Teil abenteuerlich schnell genommen, was aber das Ganze vorantrieb und nicht einen Moment Langeweile aufkommen ließ. War schon die Ouvertüre ein Ereignis so gerieten das Ballett und die Aufmärsche zu fast bedrückenden Machtdemonstrationen der Römer, Ben-Hur-Akklamationen nahe. Da war wenig nur gefällig, vieles rabiat, werkdienlich, kontrastierend. Der wunderbare Bolero Paulines im zweiten Akt gemahnte an Verdis Vêpres und Ebolis Schleierlied und hatte durchaus etwas Politisches an sich. Im Ganzen war dies eine sehr unsentimentale, stringente Sicht auf ein Geschehen, das im kollektiven Märtyrer-Tod endet. Kein Hollywood-Tod a la Jean Simmons und Robert Taylor. Und darin denn doch wieder den Intentionen der Inszenierung dienend. Der versierte und opernerfahrene Arnold Schoenberg Chor (Erwin Ortner), glänzte zudem mit exzellentem Französisch und nachdrücklichem Einsatz.
Callisthène macht in der Oper nur in einer Nebenrolle den fiesen Oberpriester, was schade war, denn Nicolò Donini (auf high heels mit einem wüsten weißen Las-Vegas-Federfächer – dies in 1915 Armenien?) sang seinen Part mit Elan. Patrick Kabongos Néarque blieb mir zu gaumig aber rollendienlich; David Steffens‚ Félix ließ bei beachtenswerter Stimme stimmlichen Nachdruck und vielleicht eine gewisse Sonorität im tieferen Bereich vermissen. Dazu kamen Katrin Cunningham und Carl Kachouh mehr als erfreulich in den kleinen Partien.

Donizettis Oper „Les Martyrs“ in Wien/Szene/ Foto Werner Kmetitsch
Nun ruht ja diese Oper, für Nourrit gedacht und von Duprez gesungen, auf den drei Protagonisten – trois étoiles der Pariser Oper waren gefordert (immerhin waren es 1840 Julie Dorus-Gras, Jean-Etienne-Auguste Massol, zudem auch Prosper Dérivis) – ohne die diese Opern nicht aufzuführen waren. Dass es sie nicht mehr gibt ist klar. Einen Heutigen zumindest hörte man, John Osborn. Mir ist sein Timbre generell zu weiß und die gewisse Tendenz zum Ausfransen der hervorragend geführten Tenorstimme unter Druck hörte ich bereits auf der neuen Aufnahme des Robert le Diable. Aber der Polyeucte liegt im mehr, zumal er – bis auf ein zwei Momente der obersten und etwas grellen Höhe (keine so eindrucksvolle voix mixte, wie ich finde, und eine besser platzierte Kopfnote hier und da hätte nichts geschadet) – auch viele Momente von anrührender Zärtlichkeit zeigte, sanft und liebevoll klingen konnte. Im Vergleich zum Kollegen Spyres bei Opera Rara ist er der weichere, eben lyrischere Held, und das ist ja auch eine Seite dieses Charakters. Nein, er machte einen hervorragenden Job und zeigte bestes Französisch. Dennoch ist mir Michael Spyres lieber in der Rolle (OR-CD).
Roberta Mantegna hat in Italien vor allem als Imogene in Bellinis Pirata eine gewisse Karriere gemacht, wenngleich ihr sehr heller Ton mich da schon gestört hatte, auch – wie beim Kollegen – diese gewisse Schwammigkeit am Rand der Stimme unter Druck. Die Pauline hingegen liegt ihr mehr, ließ sie jung und zerbrechlich erscheinen, profitierte von ihrer besten, beeindruckenden Koloratur und näherte sich im Timbre durchaus dem französischen Idiom an. Wenn man nur etwas hätte verstehen können. Sie sang – so schien es – das Telefonbuch von Neuilly. Mit Anhang. Aber sie ist eine attraktive Person, und das reißt ja auch vieles heraus.
Mattia Olivieri ist sicher kein Bastianini (der hatt´s ja auch nicht in Französisch gesungen), und er machte seine Sache gut, war ebenfalls sehr präsentabel optisch (soweit es die Szene zuließ) und sang den Sévère trotz einer gewissen italienischen Verdunklung der Vokale bei gutem Französisch mit großem Erfolg, bravo.
Das Fazit (1) des turbulenten Abends (am 23. 09. 23) war für mich ein schmissiges Musikerlebnis mit einer gemischt erfolgreichen Vokalbesetzung, einem rasanten Orchester und Chor und einer zum Abwinken langweiligen, opportunistischen, eitlen Inszenierung. Und auf der Opera-Rara-Aufnahme wird zwar besser im ganzen gesungen, aber Jeremny Rhorer ist eine entschiedene Wucht in Wien.
Fazit 2: Die Martyrs sind eben kein Poliuto, den man von Zeit zu Zeit in Italien (Cedolins und Kunde namentlich) und in Wien zuletzt mit Carréras gesehen hatte. Die französische (Quasi-)Erstfassung ist für mich die überzeugendere, Grand-Opéra-nahe, weniger belcantohafte denn in Richtung Meyerbeer und Verdi weisend, zukünftiger wie sein Dom Sébastien. William Ashbrook schreibt: „Les Martyrs sind grandioser als Poliuto (…). Les Martyrs hat zweifellos mehr Substanz, aber gleichzeitig auch weniger menschliches Interesse als der impulsivere Poliuto. Abgesehen von dem kostbaren Trio, das in der französischen Partitur den ersten Akt beschließt, ist die einprägsamere Musik beiden Versionen gemeinsam. Ein Anhänger der Werte des romantischen Melodrams wird Poliuto bevorzugen; ein Mystiker wird Les Martyrs mehr zu schätzen wissen.“ Herbert Schneider
.
.
Die Berliner Komische Oper unterwegs: Mindestens sechs Jahre soll der Umbau der Komischen Oper in der Behrenstraße dauern. Das Ensemble tritt in dieser Zeit an mehreren Spielorten auf – neben dem Schillertheater, das schon der Staatsoper als Ausweichquartier diente, in einem Zelt vor dem Roten Rathaus, im Kindl-Areal Neukölln und im Hangar auf dem Flughafen Tempelhof. Dort begann die Spielzeit mit einer spektakulären Aufführung von Hans Werner Henzes politischem Oratorium Das Floß der Medusa. Die Uraufführung dieses Oratorio volgare e militare 1968 in Hamburg fiel politischen Demonstrationen und Studentenunruhen zum Opfer. Erst 1972 konnte es szenisch (in Nürnberg) gezeigt werden. Noch heute ist das Werk angesichts der gegenwärtigen politischen Situation hochaktuell. Den Untergang der französischen Militärfregatte Méduse auf der Fahrt in den Senegal 1816 hatte Théodore Géricault in einem Monumentalgemälde dargestellt, welches heute im Pariser Louvre zu besichtigen ist. Während den Offizieren und reichen Passagieren Rettungsbote zur Verfügung gestellt wurden, mussten 154 auf ein selbstgebautes Floß ausweichen – nur 15 überlebten… Zwei davon berichteten über die Katastrophe, was die Vorlage für das Oratorium mit dem Libretto von Ernst Schnabel bildete.
In der Inszenierung von Tobias Kratzer sitzen die 1400 Zuschauer auf zwei gegenüber positionierten Tribünen, dazwischen befindet sich unter einem Glühlampenhimmel ein Wasserbecken, in welchem drei Solisten, Chorsänger und Statisten auf einem schwimmenden Brett agieren. Ausstatter Rainer Sellmaier hat Géricaults Bild als tableau vivant nachgestellt – von starker Wirkung, während schrillbunte Bademoden, Gummitiere und Luftmatratzen eher für Spaß im Pool stehen und entbehrlich scheinen. Denn sonst mied der Regisseur in seiner zwischen abstraktem und surrealem Stil stehenden Inszenierung glücklicherweise die profane Aktualisierung. Kannibalistische Ausschreitungen, wie sie auf dem Floß tatsächlich passiert sind, und Blutorgien werden nur angedeutet. Packende Momente gelingen in der Führung der Massen, so wenn die Menschen in Panik und Überlebensangst auf das kleine Floß zustürzen. Berührend ist eine Szene mit zwei kleinen Schiffsjungen, die in einem ergreifenden, sich harmonisch verblendenden Gesang als erste aus der Welt scheiden. Das Floß wird mehrfach auch in Planken zerlegt, die als Stege einer Jesus-Gestalt ermöglichen, über das Wasser zu schreiten – eine starke Vision der auf Hilfe Hoffenden.
Das Werk verlangt einen riesigen Chor, der in die Lebenden und die Toten aufgeteilt ist. Erstere singen in deutscher Sprache, die anderen in Italienisch Passagen aus Dantes Divina commedia. Die Chorsolisten und der Bewegungschor der Komischen Oper Berlin (Einstudierung: David Cavelius) sowie der Staats- und Domchor Berlin (Kai-Uwe Jirka) singen mit phänomenaler Präzision und enormer Klangfülle. Darüber hinaus imponieren sie mit ihrem überwältigenden körperlichen Einsatz auf dem Floß und im Wasserbecken.
Im Gegensatz zum großen Choraufwand sind nur drei Solisten vorgeschrieben. Angeführt werden sie von Günter Papendell als Matrose Jean-Charles, der auf dem Floß die Rationierung von Wasser und Lebensmitteln übernimmt und mit einem roten Fahnenfetzen Rettung herbeizuwinken versucht. Unter den 15 vom Segelschiff Argus Geborgenen ist er nicht, muss wie viele andere La Mort ins Reich der Toten folgen. Der Bariton, eben erst von einer Erkrankung genesen, begann etwas verhalten, steigerte sich aber deutlich und meisterte die anspruchsvolle Partie mit ihrem weiten stimmlichen Radius bewundernswert.

Henzes „Floss der Medusa“ von der Komischen Oper Berlin/Szene/Foto Jaro Sufner
Am Beckenrand schreitet Gloria Rehm wie eine Diseuse im schwarzen Glitzerkleid als La Mort, watet auch durch das Wasser und hat darin mit Jean-Charles sogar einen verführerischen Tanz zu absolvieren. Bravourös bewältigt sie die Kantilenen in stratosphärischen Regionen. Die Erzählerfigur Charon pendelt zwischen Schauspiel und Gesang. In den gesprochenen Passagen scheint die Interpretation von Idunnu Münch recht laienhaft, erst wenn der Vortrag in den Sprechgesang mit Zwölftontechnik übergeht, gewinnt die Sängerin an Wirkung.
Das Orchester der Komischen Oper Berlin musiziert an einer Schmalseite des Beckens. Dirigent Titus Engel ist bedacht auf Präzision, Spannung und rhythmischen Drive. Aber er arbeitet auch die melodischen Inseln und sphärischen Effekte der Komposition einfühlsam heraus. Ergreifend ist der Schluss mit einer Musik von Requiem-nahen Klängen. Am Ende öffnet sich das Tor des Hangars zum Flugfeld und die Überlebenden gehen hinaus in eine ungewisse Welt.
Die Aufführung in Tempelhof macht betroffen, aber auch respektvoll staunen wegen des enormen Aufwandes, mit welchem sie realisiert wurde (30. 9. 2023). Bernd Hoppe
.
.
Tout Paris wollte das sehen, was im Februar 1835 über die Bühne der Pariser Opéra ging: Eine von Trompetern angeführte Prozession mit schreitenden Kirchenfürsten, dem Kardinal unter seinem Baldachin, dem Kaiser und seinen Beamten zu Pferde, wozu die Glocken des Doms und der anderen Kirchen läuten und Kanonenschüsse erklingen. Und das war nur eine von mehreren Szenen, die Jacques Fromental Halévys fünfaktige Grand opéra La juive bereithielt, die das Konstanz des Jahres 1414 derart verblüffend vergegenwärtigte, dass die Besucher des Opernhauses glauben mussten, sie seien durch einen Trick um vierhundert Jahre zurückversetzt worden und wohnen augenblicklich einem historischen Moment bei, zu dessen Illusion auch der Chorgesang der Gemeinde auf der Bühne „Te Deum laudamus“ zu Beginn und Ende des ersten Aktes beitrug, eine Klangsituation, die Wagner in seinen Meistersingern wiederholte. Alles war bis in die kleinesten Details täuschend echt nachgebildet, bei den Kostümen und Rüstungen wurde an nichts gespart und im dritten Akt feierte sich angesichts des Naturschauspiels mit Bodensee und Berglandschaft die mittelalterliche Ständegesellschaft von den Bauern bis zu den feudalen Herrschern. Bis sich das Jahrhundert seinem Ende zu neigte, wiederholte sich dieses Spektakel und die von Eugene Scribe erdachten Geschehen um das Konstanzer Konzil an der Pariser Opera rund 550-mal.
Als es viele Jahrzehnte später, ausgehend von John Dews Bielefelder Inszenierung 1988 zu der nicht mehr für möglich gehaltenen Wiederentdeckung der Grand opéra und ihres zentralen La juive war ein solcher Ausstattungsballast längst passe. Mit den kostbaren Applikationen und mit bunten Steinen besetzten Mitren, Helmen und Gewändern verschwanden auch die musikalischen Ausmaße. Am Teatro Regio in Turin, das vor 50 Jahren mit den von Maria Callas inszenierten Les vepres siciliennes wiedereröffnet wurde, nahm man sich zur Eröffnung der Jubiläumsspielzeit zumindest Zeit, um mit etwas mehr als dreieinhalb Stunden reiner Musik so viel Halévy als nur möglich zu bieten.

Halévys Oper „La Juive“ in Turin/Szene/Foto © Andrea Macchia / Teatro Regio Torino
Daniel Oren, der 2007 bereits die Rückkehr der Jüdin an der Pariser Opéra dirigiert hatte, zelebrierte die Musik, der anfangs noch etwas Opéra comique-Hurtigkeit eigen ist, denn breit und genüsslich, aber auch mit vielen feinen Zwischentönen, dass man bei so viel sublimer Finesse fast in Trance verfiel, was nicht verhindert, dass der Abend lang und länglich wird. Doch man ist dankbar, das Werk in dieser Fülle zu hören. Vor allem, da sich das Orchester, der sehr große Chor des Teatro Regio und die vielen Bewegungsstatisten auf der riesigen Bühne in diesem großen, üppigen und reichen und über die Jahrzehnte gegenüber anderen Bühnen auch so perfekt funktionierenden Haus so vehement für das Werk einsetzen. Alles ist groß. Auch die Inszenierung von Stefano Poda, der kürzlich das 100jährige Aida-Jubiläum in der Arena von Verona inszenierte und als Ausstatter und Regisseur mit seinen architektonisch streng empfundenen und suggestiven Bildern international Akzente setzt. Poda nutzt die Versenkungen und die Hebebühnen des Teatro Regio für ein abstraktes Welttheater mit einem strahlenden Kreuz im Hintergrund vor einer mittelalterlichen Darstellung der Höllenqualen, einer riesigen Metallkonstruktion mit ineinander sich drehenden Kreisen und der Warnung des Lukrez vor religiösem Wahn in einer Leuchtschrift über der gesamten Breite des Hintergrunds „Tantum religio potuit suadere malorum“, mit denen er von der Unterdrückung von Minderheiten erzählt. Der immer wieder angerufene Seigneur und Dieu ist als hilfloser Leidensmann bis zur Kreuzigung gegenwärtig, die gequälten Menschen, die Sünder und die Verfluchten winden sich wie in mittelalterlichen Höllenszenarien, die Toten hängen im vierten Akt von der Decke herab – alles dargestellt in klar choreographierten Aktionen der fast nackten Akteure und Begegnungen der Christen und Juden in schwarzen und weißen Wogegewändern.
Die Geschichte der Tochter des jüdischen Goldschmieds Eléazar, die gar keine Jüdin ist, sondern die von Eléazar aus den Flammen gerettete und an Kindestatt angenommene Tochter seines zum Kardinal aufgestiegenen Rivalen Brogni, erzählt Proda in klaren und übersichtlichen Aktionen. Auch Rachels heimlicher Geliebter Samuel ist nicht der, für den er sich ausgibt. Er ist kein Jude, sondern Reichsfürst Léopold, der zu allem Überfluss bereits verheiratet ist, und zwar mit Eudoxie, der Nichte des Kaisers. Eudoxie sucht sogar die mit vielen Vitrinen wie eine frisch designte Location in den Arkadenboutiquen Turins ausgestatte Werkstatt Eléazars auf, um ein Geschenk für Léopold zu wählen. Sparsam werden die Geheimnisse enthüllt, doch es gibt genügend Überraschungen, um jeden Szenenkomplex und jeden Akt mit einem Cliffhanger zu beenden. Am Ende wählt Rachel, deren Liebe zu einem Christen bestraft werden muss, statt der Rettung durch den Übertritt zum Christentum den Tod.

Halévys Oper „La Juive“ in Turin/Szene/Foto © Andrea Macchia / Teatro Regio Torino
Bevor ihr Eléazar folgt, schleudert er fies und heimtückisch Brogni entgegen, dass Rachel dessen Tochter ist. Mariangela Sicilia singt die Titelfigur mit ausgeglichenem soprano lirico und guter Höhe, sicher nicht rund und voluminös genug, um der Romanze „Il va venir“ Gewicht zu geben und sich gut gegenüber der Koloraturrolle der Eudoxie zu behaupten. Daniela Cappiello nutzte als Eudoxie die Gunst der Stunde als zweite Besetzung und bot exquisite Zierkunst, die bei Mozart und Puccini vielleicht besser aufgehoben ist, aber in der Arie zu Beginn des dritten Aktes “Tandis qu’il sommeille” und im folgenden Bolero ein wenig zu spitz blieb. Mit sehr schlankem, feinem Tenor ist Ioan Hotea der musikalisch passende Spielball der beiden Damen. Der rumänische Tenor, der den Léopold bereits im Vorjahr in Genf gegeben hatte, singt mit leichter guter und beweglicher Stimme, die man sich gut bei Rossini und Mozart vorstellen könnte. Die Hauptfigur ist aber zweifellos der in seiner Zerrissenheit tragische Eléazar, der bei seiner zentralen Arie am Ende des vierten Aktes „Rachel, quand du Seigneuer la grace tutélaire“, in der er damit ringt, ob er die Identität Rachels preisgeben soll, bereits einen sehr langen Abend hinter sich hat. Gregory Kunde bewahrt bei seinem Rollendebüt – 30 Jahre nachdem er erstmals in Turin aufgetreten war – aber auch dann noch die noble, sanfte Linie seines Gesangs, erlaubt sich keine irgendwie äußerlichen Gefühlsergüsse, sondern singt ruhig, expressiv, jede Phrase ausziseliert, jeder Ton in sich gerundet, auch im emotional gesteigerten Schlussteil ohne Schluchzer und Verfärbung. Direkt davor hatte er im Duett mit Brogni dem rauen und grobschlächtigen Riccardo Zanellato, dem es für „Si la rigueur“ an gravitätischer Bassfülle fehlt, eine Lektion in guter Prosodie erteilt. Wie kostbare Preziosen breitet Kunde seine Töne beim Passahfest zu Beginn des zweiten Aktes aus „O Dieu, Dieu de nos pères“ mit kostbarem, schier endlosem mezza voce-Gesang, sanft anhebenden und abschwellenden Tönen voll bedeutungsvoller Intensität. Durchaus auch dramatisch, wenn er die Tochter mit dem Verführer überrascht, so in dem Terzett „Je vois son front coupable“. Manche Details haben in den Momenten beschwörerischer Piano-Schwelgereien und elegischer Färbungen zweifellos etwas von der reifen Kunst erfahrener Diven im Spätherbst der Karriere. Das stört nicht. Dazu der ausgezeichnete, aus Frankfurt bekannte Bassbariton Gordon Bintner als Ruggiero sowie Daniele Terenzi (Albert) und Rocco Lia (Herold). Rolf Fath
.
.
.
.Francesca da Rimini an der Deutschen Oper Berlin: Faszination der Gewalt. Die Neuinszenierung von Zandonais Tragedia Francesca da Rimini an der Deutschen Oper hatte während der Pandemie im März 2021 ihre Premiere im Stream – nun konnte sie in einer Aufführungsserie auch dem Publikum im Opernhaus gezeigt werden. Sie zählt ohne Zweifel zu den Sternstunden des Hauses. Christof Loy, der auf Frauen mit dem Ruf einer femme fatale spezialisierte Regisseur, hat die auf Gabriele d’Annunzios Versen basierende Handlung mit psychologischem Einfühlungsvermögen, berstender Spannung und in einem Ambiente von bestechender Ästhetik inszeniert. Er verlegte das 1914 in Turin uraufgeführte Stück um Betrug, Ehebruch und Doppelmord aus der Epoche Renaissance in die Entstehungszeit, wofür Johannes Leiacker ein ungemein raffiniertes Bühnenbild in Jugendstil-Nähe erdachte. Eine hohe Wand mit Blumendekor lässt in der Mitte einen portalartigen Ausschnitt frei, hinter dem sich ein Wintergarten mit Palmen und Korbmöbeln befindet. Dessen hintere Fenster gewähren den Ausblick auf eine Landschaft in der Manier von Claude Lorrain – eine bezaubernde arkadische Idylle, welche zum brutalen Bürgerkrieg zwischen Guelfen und Ghibellinen einen krassen Kontrast bildet. Loy hat die Kämpfe und den permanenten Aufruhr in der Stadt in schonungsloser realistischer Härte dargestellt. Schauspieler jagen über die Bühne, stürzen zu Boden, überschlagen sich oder geben in korrekten schwarzen Anzügen Sicherheitsbeamte, die an Mafia-Vertreter erinnern. Meisterhaft ist die Personenführung mit Francesca im Zentrum, in die sich drei Brüder der Familie Malatesta verliebt haben. Mit dem älteren und lahmen Gianciotto soll sie verheiratet werden, der jüngere und schöne Paolo soll als Brautwerber fungieren. Francescas erste Begegnung mit ihm entscheidet über beider Schicksal.

Zandonais „Francesca da Rimini“ an der Deutschen Oper Berlin/ Szene/ Foto Monika Rittershaus
Es war eine Glücksfall der Produktion, für diese beiden Rollen ideale Vertreter gefunden zu haben. Sara Jakubiak wurde am Haus schon als Korngolds Heliane gefeiert. Nun glänzte sie auch in dieser Titelrolle mit durchschlagendem, flutendem Sopran von sinnlichem Reiz, aber auch bedrohlicher Power. Klaus Bruns hat ihr mehrere Kostüme entworfen – vom kleinen Schwarzen über einen Hosenanzug bis zum eleganten Abendkleid und seidener Unterwäsche in Abricot. Jonathan Tetelman war als Paolo der attraktive Latino-Beau, wie es die Rolle verlangt, begnadet mit einem baritonal getönten, heroischen Tenor von schier unerschöpflichen Kraftreserven und phänomenaler Wucht. Beider schwelgerisches Duett im 2. Akt voller bitterer Süße und melancholischer Wehmut steigerte sich zum Rausch und auch die letzte Szene war in ihrer Ekstase von unerhörter Spannung und mitreißender Wirkung.
Die Ausnahmeleistung der beiden Sänger in ihren gesanglich extrem fordernden Partien war umso höher einzustufen, da Ivan Repusic am Pult des Orchesters der Deutschen Oper Berlin Zandonais Komposition in ihrer Mischung aus italienischem Verismo, französischem Impressionismus und Wagner-Einflüssen nicht eben Sänger-freundlich ausbreitete. Auf den Hörer ergoss sich ein Schwall von Musik, ein Klangrausch der unerhörten Art, welcher zum Psycho-Thriller der Handlung perfekt korrespondierte. Aber man vernahm auch das nervöse Geflecht des Werkes und dessen zarte Gespinste wie die Cello-Kantilene beim ersten Auftritt von Paolo.

Zandonais „Francesca da Rimini“ an der Deutschen Oper Berlin/ Szene/ Foto Monika Rittershaus
Neben den beiden herausragenden Protagonisten gab es in der weiteren Besetzung keinen einzigen Schwachpunkt. Ivan Inverardi war in Stimme und Erscheinung ein gebührend robuster, brutaler Gianciotto, Charles Workman mit gereiftem Tenor der einäugige Malatestino dall’Occhio, der aus Eifersucht Francescas Ehebruch an ihren Gatten verrät, was einen Doppelmord zur Folge hat. Anrührend zeichnete Lexi Hutton Francescas kränkelnde Schwester Samaritana, resolut Irene Roberts ihre Vertraute Smaragdi. Volltönend und resonant sang Dean Murphy Il Giuiare, den Spielmann – in Jeans und Lederjacke eine ganz heutige Figur. Lebhaft und aufgeregt agierten Francescas Gesellschafterinnen (Meechot Marrero, Elisa Verzier, Arianna Manganello, Karis Tucker), die in ihrer Tracht wie Internatsinsassen wirkten und mit ihren Stimmen zu homogenem Gesang fanden. Die 5. Vorstellung am 29. 5. 2023 fand das enthusiastische Publikumsecho, wie es der Abend verdient hatte. Bernd Hoppe
.
.
Grosstat der Wiederbelebung in Erfurt: 112 Jahre, 11 Monate und 26 Tage sind seit der mutmasslich letzten Aufführung von Felix Weingartners Orestes im Neuen Deutschen Theater Prag (heute Staatsoper Prag) am 24. Mai 1910 vergangen. Vom Vergessen befreit hat das Stück nun das Theater Erfurt. am 27.05.2023.
Felix Weingartner, ein Jahr älter als Richard Strauss, ist hauptsächlich als Konzertdirigent bekannt. Weingartner studierte Klavier und Komposition in Graz und kam dann durch eine Empfehlung von Johannes Brahms an die Universität Leipzig und zu Franz Liszt in Weimar. Nach Engagements in Königsberg, Danzig, Hamburg, Frankfurt und Mannheim war Weingartner von 1891 bis 1898 Hofkapellmeister der königlichen Oper in Berlin und Leiter der Sinfoniekonzerte der königlichen Kapelle. Nach der Leitung des Kaim-Orchesters in München (heute Münchner Philharmoniker) übernahm Weingartner 1908 als Nachfolger Gustav Mahlers die Direktion der Wiener Hofoper (bis 1911) und die Leitung der Konzerte der Wiener Philharmoniker (1908-1927). Zum Ende seiner Wiener Zeit war er auch noch Direktor der Wiener Volksoper. Von 1927 bis 1934 war Weingartner Chefdirigent des damaligen Basler Orchesters und Direktor des Konservatoriums, bevor er 1937 endgültig in die Schweiz emigrierte. Am 7. Mai 1942 starb Weingartner in Winterthur.

Weingartners Oper „Orestes“ in Erfurt/ Szene/ Foto © Lutz Edelhoff
Den Grund für Weingartners relativ häufigen Wechsel der Positionen sieht die Überlieferung vor allem darin begründet, dass er ein «Querkopf» war, dem man es nur sehr schlecht recht machen konnte. So verschärften sich Ende 1897 die Spannungen mit der Direktion der Hofoper Berlin: Die Uraufführung seine Oper «Genesius» hatte nicht den erhofften Erfolg gehabt und in Besetzungs- und Dispositionsfragen fühlte er sich übergangen. Der Arzt, den Weingartner wegen «heftiger Nervenanfälle» aufsuchte, empfahl ihm eine Reise in den Süden. Weingartner wählte Taormina auf Sizilien: «Im griechischen Theater Taorminas, von sonniger, regenloser Zeit begünstigt, schrieb ich an den Vormittagen die Neudichtung, vom Original dort abweichend, wo der von mir bereits klar erkannte metaphysische Charakter der Musik dies nicht nur erlaubte, sondern gebot». Das Original ist die Orestie des Aischylos und Weingartners «Orestes» die Mutter aller Antikenopern. Als Vorbild des Projekts könnte die Tetralogie «Homerische Welt» (auch: «Die Odyssee», 1896-1903, op. 30) von August Bungert (1845-1915) gedient haben. Richard Strauss hatte zur Zeit der Uraufführung des «Orestes» erst einen Mittelalterstoff vertont («Guntram», 1894) und einen altdeutschen Märchenstoff in Arbeit («Die Feuersnot»). «Salome» (1905) und «Elektra» (1909), die «Orestes» zum Verhängnis werden sollten, sollten erst noch kommen.
Der I. Teil von Weingartners Trilogie (Agamemnon) beginnt mit dem Fall Trojas. Der Wächter auf der Königsburg (Máté Sólyom-Nagy mit kräftigem Bariton) verkündet das Ende des trojanischen Kriegs und die Heimkehr von König Agamemnon (Kakhaber Shavidze mit königlich imposantem Bass und grandioser Textverständlichkeit). Agamemnons Gattin Klytaimnestra (mit voluminösem, dramatischem SopranIlia Papandreou) ist davon wenig begeistert: um ihre Tochter Iphigenie, die Agamemnon geopfert hatte, um am trojanischen Krieg teilnehmen zu können, zu rächen und ihren Geliebten Aigisthos (Siyabulela Ntlale mit hellem, ausgesprochen agilem Bariton mit fast tenoraler Attitüde) heiraten zu können, hatte Klytaimnestra Agamemnons Tod beschlossen. Ein Bote (Tristan Blanchet mit kräftigem, bestens geführtem Tenor) kündet den Einzug Agamemnons an. Kassandra (Laura Nielsen mit superben Piani, inniger Leidenschaft, intensiver Spannung und alles überragender Bühnenpräsenz), Tochter des Priamos und Seherin, die Agamemnon als Siegpreis von seine Heer geschenkt wurde, begleitet ihn. Kassandras Prophezeiung vom nahen Tod Agamemnons und ihrer selbst wird erst geglaubt, als die beiden von Klytaimnestra umgebracht wurden. Klytaimnestra erklärt ihre Morde öffentlich mit der Rache Iphigenies: Aigisthos und dessen Söldner unterbinden einen aufkeimenden Aufstand.
Mit Beginn des II. Teils (Das Totenopfer) sind einige Jahre vergangen. Noch als Kind schickte Klytaimnestra ihren Sohn Orestes (Brett Sprague mit kraftvollem Heldentenor und einem überschaubaren Repertoire an Farben) zur Erziehung (und zu seinem Schutz) ins Königreich Phokis. Nun ist er erwachsen geworden und kehrt mit seinem Freund Pylades (Cristiano Fioravanti, stumm) in die Heimat Argos zurück, um den Mord am Vater zu rächen. Am Grab des Vaters erneuert Orestes seinen Racheschwur. An der Spitze eines Trauerzuges erkennt er seine Schwester Elektra (Daniela Gerstenmeyer mit hellem, agilem Sopran) und beobachtet sie. Die von schweren Albträumen gezeichnete Klytaimnestra hat sie und die Mägde geschickt, um die Schatten der Gemordeten zu versöhnen. Elektra erfleht aber am Grab des Vaters die Heimkehr ihres Bruders, woraufhin Orestes hervortritt und sich zu erkennen gibt. Elektra enthüllt er seinen Plan, gebietet ihr Verschwiegenheit und schickt sie mit Pylades zurück nach Phokis. Klytaimnestra schildert ihren Albtraum, einen Drachen, den sie mit ihrem eigenen Blut nährte, geboren zu haben, Kilissa, der Amme des Orest (Elsa Roux Chamoux mit verführerischem Mezzo). Orestes, immer noch als Wanderer verkleidet, kann ihr Vertrauen gewinnen, so dass sie Aigisthos herbeilockt, dem er dann mitteilt, Orestes sei in Phokis gestorben. Als Aigisthos Klytaimnestra davon unterrichten will, tötet ihn Orest. Klytaimnestra und ihren Knechten gibt er sich zu erkennen. Es gelingt seiner Mutter nicht, ihren Sohn umzustimmen: sie muss ihren Frevel mit ihrem Tod büssen, kann vorher aber noch die Rachegeister auf ihn hetzen. Als Orestes dann von den Furien bedroht wird, erfasst ihn das Entsetzen über seine Tat und er macht sich auf den Weg nach Delphi, um sich dort im Tempel des Apoll zu entsühnen.

Weingartners Oper „Orestes“ in Erfurt/ Szene/ Foto © Lutz Edelhoff
Der III. Teil (Die Erinyen) beginnt mit der Ankunft des Orestes im Tempel des Apollon zu Delphi. Die Seherin des Tempels (Katja Bildt mit gepflegtem Mezzo) weist ihn an, in den Hades hinabzusteigen. Klytaimnestras Geist fordert die Erinyen auf, ihm zu folgen. Auf der Asphodeloswiese angekommen, ruft Orestes Agamemnons Schatten an, der erscheint und gleich wieder verschwindet. Als Orest zur Sühne sich selbst das Leben nehmen will, gebietet ihm der Geist Kassandras Einhalt. Sie hat im Elysium einen Olivenzweig gebrochen, der ihn vor den Erinyen schützt, und will ihn nun nach Athen führen, wo Pallas Athene den Fall beurteilen soll. Athene (Candela Gotelli mit aufgedrehtem Spiel) will aber den Fall nicht selbst beurteilen und beruft einen Rat der zwölf würdigsten Bürger ein. Das Resultat ist ein Patt, Athene spricht Orestes dann mit ihrer Stimme frei. Erzürnt verfluchen die Erinyen Stadt und Land. Orest versöhnt die Erinyen mit dem Vorschlag eines Bündnisses zwischen ihm als neuem König von Argos und Athene, dessen Einhaltung sie überwachen sollen. Der Olivenzweig wird eingepflanzt und wird als Zeichen des neuen Bundes zu einem mächtigen Ölbaum. Die Erinyen wandeln ihren Fluch in einen Segen. Athene verkündet die Heirat von Pylades und Elektra und schickt Orestes zum Strand der Skythen, wo er seine von Artemis befreite Schwester Iphigeneia finden werde.
Weingartners Partitur ist gross besetzt und so spielen unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Alexander Prior das Philharmonische Orchester Erfurt und die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Mit grosser Leidenschaft und Präzision bringen die Musiker die ungemein farbenreichen, vielschichtigen Klänge zu Gehör. Und Prior setzt Spannungsbögen, die die drei Stunden wie im Fluge vergehen lassen. Der von Markus Baisch vorbereitete Opernchor des Theater Erfurt trägt mit mustergültiger Textverständlichkeit seinen Teil zum Gelingen des phänomenalen Abends bei.
Weingartner hat sein Libretto zu einer Zeit (1898), als Aufführungen antiker Tragödien noch keineswegs üblich waren, selbst in freier Anlehnung an die Orestie des Aischylos gedichtet. Als Vorbild des Projekts könnte die Tetralogie Homerische Welt (auch: Die Odyssee, 1896-1903, op. 30) von August Bungert (1845-1915) gedient haben.
Von besonderem Interesse ist hier, wie der bekennende Pazifist Weingartner den III. Teil, Die Erinyen, gestaltet hat. Pallas Athene, zu der die Seherin des Tempels zu Delphi Orestes geschickt hat, entscheidet nicht allein über Schuld oder Unschuld Orestes, sondern delegiert diese Entscheidung an einen Rat der zwölf der würdigsten Bürger Athens, die das Urteil «sine ira et studio» («ohne Zorn und Eifer») fällen sollen. Der Entscheid führt zu einem Patt, das Pallas Athene mit ihrer Stimme zugunsten Orestes Unschuld entscheidet. Orestes rettet nun die Situation, in dem er den vor Enttäuschung rasenden Erinyen die Aufgabe gibt, das Bündnis zwischen den Königreichen von Argos und Athen zu schützen.
Hier setzt auch die Inszenierung von Intendant Guy Montavon an. Montavon lässt die Geschichte in der Zeit zwischen dem Ende des ersten Weltkriegs und dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielen. Der I. Teil «Agamemnon» spielt in einer Art Bunker, wo die Kriegsheimkehrer erwartet werden und der Mord Klytaimnestras an Agamemnon geschieht. Der II. Teil «Das Todtenopfer» spielt an dem an Lenins Mausoleum gemahnenden Sarkophag Agamemnons. Der III. Teil «Die Erinyen» spielt zuerst in dem an eine Müllhalde erinnernden Hades und dann, die Szenen, die in Athen spielen, in einem Sitzungsaal mit UNO-Emblem. So, wie Orestes versuchte die Spirale der Gewalt, symbolisiert durch den Atridenfluch, zu durchbrechen, versuchte man nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Gründung der UNO zukünftige Gewalt zu verhindern. Was daraus geworden ist, ist ja bekannt. Ausgestattet wird die tief beeindruckende Inszenierung von Hank Irwin Kittel. Mit dieser genialen Inszenierung haben das Theater Erfurt und Guy Montavon der Opernwelt ein Werk zurückgegeben, das alle Kraft hat, zu bestehen. Jan Krobot/Zürich 22.05.2023 (mit großem Dank an den Autor und an das Wiener Opern-online-Magazine Online-Merker, uns mit dieser Rezension zu einer der wichtigen Produktionen der letzten Jahre ausgeholfen zu haben!)
.
.
Polnisches Indiendrama in der Berliner Philharmonie: Sie sollte der entscheidende große Wurf sein die letzte und damit sechste Oper Paria von Stanislaw Moniuszko, die den polnischen Komponisten mit Unterbrechungen sein ganzes Leben lang beschäftigt hatte, denn bereits der Achtzehnjährige soll das Trauerspiel von Casimir Delavigen übersetzt haben , der Text ging aber wohl verloren, ehe er sich ans Komponieren machen konnte. Da hatte die gleichnamige Oper von Gaetano Donizetti Il Paria bereits das Alter von vierzig erreicht, nachdem sie mit Rubini, dem Schöpfer des Do di Petto uraufgeführt und die Musik danach bald in Anna Bolena, Torquato Tasso und Il Duca d’Alba wieder verwendet worden war.
Zwar erfüllte der Stoff das Bedürfnis des u.a. durch Weltausstellungen nach dem Orient, nach Exotischem süchtig gewordenen Publikums mit der Geschichte vom unterschiedlichen Kasten zugehörigen Liebespaar, aber außer der Handlung war ganz und gar nichts orientalisch an Paria, weit weniger noch als an auf der gleichen Orient-Schiene sich bewegenden Opern wie Lakmè, Thais oder Die Afrikanerin und Die Perlenfischer. Es kam zwar im Jahre 1868 zur Uraufführung in Warschau, wo man das Werk auch 1917 wieder erleben konnte, dann aber klafft eine große Lücke in der Aufführungstradition, ehe man Paria 1951 in Breslau, 1958 in Posen aufführte, 1991 in Havanna und 2008 entstand eine CD bei Dux Records mit den Kräften aus Stettin. Hin und wieder nahmen sich auch auf westlichen Bühnen erfolgreiche Künstler des Werks oder vielmehr von Teilen desselben an, so findet man bei You Tube eine Aufnahme der Arie der Neala mit Teresa Zylis-Gara unter Kazimir Kord.

2020 inszenierte Graham Vick die Oper „Paria“ in Posen/ Szene/ Opera Vision
2020 inszenierte kein Geringerer als Graham Vick Paria an der Moniuszko Oper in Posen , die Inszenierung erhielt den International Opera Award für ein wiederentdecktes Werk , und nun ist das Spätwerk im Rahmen eine Moniuszko-Dreierpacks (Halka 2019 und Das Gespensterschloss im September 2024 ebenfalls in Berlin) konzertant mit dem Ensemble aus Posen am 23. Mai 2023 in der Berliner Philharmonie zu hören gewesen. Dafür ist man erst einmal dankbar, denn eine Presse-DVD mit Ausschnitten aus der Inszenierung beweist, dass diese einmal mehr die übliche Abrechnung mit dem Klerus, aber da mit Heiligenschein versehen, dem christlichen, und mit dem Militär zeigt, denn auch Idamor, der Tenor, ist recht unsympathisch, mit Maschinengewehr und ordenbehängt zur Hochzeit erscheinend.
Ein ganz anderes Schicksal als Paria hatte übrigens Moniuszkos Oper Halka, in Polen als Nationaloper geliebt und nach 1945 zumindest in den „sozialistischen Bruderländern“ häufig aufgeführt. Während in diesem Werk Handlung und Musik zueinander passen und es sich so den Ehrentitel polnische Nationaloper redlich verdient, ist Paria ein seltsames, wenn auch sehr reizvolles Gemisch aus französischer Opera Comique, deutscher Spätromantik und polnischer Folklore mit umfangreichen, gewaltigen Chorszenen, einem Ballett und teilweise ausgesprochen apart-interessanten instrumentiert. Wenn Moniuszko bekannte: “Ich bin Paria“, dann lässt das Raum für vielerlei Spekulationen.
Viele polnische Familien hatten sich neben dem üblichen Konzertpublikum in der Philharmonie eingefunden, und es musste auch mal ein schreiendes Kleinkind, das dem Ereignis wenig abgewinnen konnte, aus dem Saal getragen werden, ansonsten herrschte eine feierliche Stimmung, wenn der polnische Botschafter viele Ehrengäste (darunter der polnische Botschafter und Honoratioren aus Politik und Kunst) feierlich begrüßte, anschließend Kulturjournalist Frederik Hanssen das Publikum in das Operngeschehen einführte, nicht ohne zu erwähnen, dass Moniuszko immer auf der Seite der Armen und Entrechteten gestanden habe.

Moniuzskos Oper „Paria“ in der Berliner Philharmonie/ Iwona Sobotka sang die Neala und erinnerte im Timbre an andere berühmte polnische Sopranistinnen wie Teresa Kubiak oder Teresa Zylis-Gara/ Foto: K. Bieliński / Polish National Opera
Die Posener stellten sich mit einem der anspruchsvolle Partitur gleichermaßen mit Hingabe wie technischem Können gerecht werdendem Einsatz dem Berliner Publikum vor, das enorme Pathos, das über weite Strecken in der Musik Moniuszkos herrscht, stilvoll bändigend. Dirigent Jacek Kaspszyk wusste immer wieder Inseln der Ruhe und der akustischen Beschaulichkeit zu schaffen, wenn die Musik sich in unermüdlicher Daueraufgeregtheit zu verausgaben drohte (Wagneranklänge!). Vorzüglich war der Chor der Posener Oper, seien es Damen und Herren getrennt voneinander, so ein wunderschöner Mädchenchor im ersten Akt, oder sei es als teilnehmendes Volk.
Iwona Sobotka im rot-schillernden Glitzerfummel war eine auch akustisch attraktive Neala mit weichem, geschmeidigem, in der Höhe schön aufblühendem Sopran ohne jede Schärfe. Besonders gut gelang ihr das Wechselspiel mit dem Chor im ersten Akt. Mit dunkel getöntem, heldisch auftrumpfendem Tenor vieler Schattierungen sang Dominik Sutowicz ihren Geliebten Idamor, den Paria, der auch mit Schwelltönen prunken konnte. Einen Bass wie aus einem Guss und von schöner Farbe hatte Volodymyr Tyshkov für den Brahmanen Akebar. So beredt wie sonor versuchte Stanislav Kuflyuk mit hochpräsentem Bariton als Djares seinem Anliegen Gehör zu verschaffen. In kleineren Partien schlugen sich Piotr Friebe als Ratef und Lucyna Bialas als Priesterin wacker.
Der Abend war eine interessante Erfahrung, konnte jedoch nicht davon überzeugen, dass dem Paria auf Dauer ein Platz im Repertoire gebührt. Exotische Themen wie dieses haben es sowieso schon schwer in unserer Zeit, umso mehr, wenn die Musik dazu absolut nicht passen will und eher epigonalen Charakters ist. Ingrid Wanja
.
 PS.: Wenngleich es die Oper schon vor der Produktion in Posen reichlich zu hören gab: So bereits im polnischen und dann DDR-Rundfunk in den achtziger Jahren aus Krakau (wie ich im Archiv des DDR-Rundfunks in Potsdam entdeckte und mir besorgte), eine polnische TV-Produktion von 1993 unter Antonin Wicherek mit der wunderbaren Hanna Lisowska (davon existiert eine Kopie noch auf VHS), eine weitere TV-Produktion des Wielki Warschau 1989 erneut unter Wicherek und natürlich die schmissige und maßstäbliche Aufnahme aus Breslau bei DUX unter dem jungen Lukasz Borowicz 2019 – ein langer Artikel bei operalounge.de beschäftigt sich zudem mit dem Werk und der zuletzt genannten Aufnahme. Dem Vernehmen nach will Naxos die obige Aufführung herausbringen. G. H.
PS.: Wenngleich es die Oper schon vor der Produktion in Posen reichlich zu hören gab: So bereits im polnischen und dann DDR-Rundfunk in den achtziger Jahren aus Krakau (wie ich im Archiv des DDR-Rundfunks in Potsdam entdeckte und mir besorgte), eine polnische TV-Produktion von 1993 unter Antonin Wicherek mit der wunderbaren Hanna Lisowska (davon existiert eine Kopie noch auf VHS), eine weitere TV-Produktion des Wielki Warschau 1989 erneut unter Wicherek und natürlich die schmissige und maßstäbliche Aufnahme aus Breslau bei DUX unter dem jungen Lukasz Borowicz 2019 – ein langer Artikel bei operalounge.de beschäftigt sich zudem mit dem Werk und der zuletzt genannten Aufnahme. Dem Vernehmen nach will Naxos die obige Aufführung herausbringen. G. H.
.
.
Hamlet an der Komischen Oper Berlin – ein Schloss wird zum Friedhof. Nicht gering war die Skepsis nach Bekanntgabe des Spielplanes der Komischen Oper Berlin für die Saison 2022/23, der eine Neuproduktion von Ambroise Thomas’ Hamlet vorsah. Eines der anspruchsvollsten französischen Werke zwischen Grand opéra und Drame lyrique in der Behrenstraße? Die konzertante Aufführung an der Deutschen Oper im Juni 2019 mit Florian Sempey und der rasanten Ève-Maud Hubeaux unter Yves Abels dto. begeisternder Leitung war noch in bester Erinnerung. Man war gespannt.
Die Inszenierung und musikalische Interpretation straften alle Zweifel Lügen und dürften sogar als Berliner Opernaufführung des Jahres gewertet werden. Nadja Loschky hat das Stück spannungsreich und mit stimmiger Personenführung inszeniert, den Narren Yorick, der bei Shakespeare, aber nicht im Opernlibretto Erwähnung findet, als Figur eingeführt und damit die komisch-groteske Ebene bedient. Kjell Brutscheidt gibt ihn stark effeminiert und mit tänzerisch-exaltierter Allüre, darf zu Beginn sogar das Lied des Narren aus Shakespeares Was ihr wollt singen. Irina Spreckelmeyer hat ihn als einzige Figur der Inszenierung in einem glitzernden schwarz/silbernen Renaissance-Kostüm historisch gewandet. Für alle anderen – bis auf den Titelhelden, der einen schmucklosen, legeren grauen Anzug trägt – ist warmes Burgunderrot vorgesehen, ob in langen Schleppen für das Königspaar oder den Hotelpagenkostümen für einzelne Chorsolisten. Etienne Pluss entwarf eine atmosphärische Bühne – das Treppenhaus eines alten Schlosses mit gemusterter Tapete, das an einen britischen oder amerikanischen Film à la Hitchcock erinnert. Wenn die Lampen flackern, fühlt man sich gar in den Psychothriller Das Haus der Lady Alquist versetzt. Mit seltsamen Gestalten, die anfangs aus einer Bodenvertiefung steigen und sich im Laufe der Aufführung vermehren, führt die Regisseurin gar ein surreales Element ein. Mit Stockschirm, Aktenkoffer und Melone lassen sie an die Bildwelt von René Magritte denken. Ihre Anführer stellen sich schließlich als die beiden Totengräber heraus. Auch mehrere Doubles – für Hamlet, Ophélie, Claudius, Gertrude und den Geist des ermordeten Königs – bringen eine unwirkliche Atmosphäre ein.
Das Geschehen eskaliert am Ende des 2. Aktes, nachdem Hamlet den Tod seines Vaters als Pantomime vorführen ließ und Claudius, der Mörder und neue König, in Panik den Hof verlässt. In rasender Wut zertrümmert Hamlet mit der Spitzhacke die hintere Wand, aus der schwarze Erde herausquillt. Die Chorsolisten der Komischen Oper Berlin (Einstudierung: Jean-Christophe Charron) erweisen sich in diesem dramatischen Finale mit klanggewaltigem Gesang als grandiose Architekten bei der Errichtung einer Kathedrale in Musik. Nach der Pause zeigt sich der Raum in dichten Nebelschwaden und wüster Zerstörung. Die Natur hat als hügeliges Erdreich von ihm Besitz ergriffen, der Schauplatz hat sich zu einem Friedhof gewandelt. Hier singt Hamlet mit einem Totenschädel in den Händen seinen berühmten Monolog. Der britische Bariton Huw Montague Rendall ist ein Ereignis der Aufführung. Mit seiner weichen, sensiblen Stimme, die vom gehauchten pianissimo bis zum ausladenden forte über schier unbegrenzte vokale Möglichkeiten verfügt, und einem reichen Ausdrucksspektrum der grüblerischen, jähzornigen, halluzinativen, hintergründigen, aufbrausenden Töne darf er als Idealbesetzung der Rolle gelten, zumal er als blonder, träumerischer Jüngling auch optisch die Figur perfekt zu verkörpern vermag. Die Spanne seines gesanglichen Könnens zeigt sich eindrücklich in der Verve des Trinkliedes „Ô vin, dissipe la tristesse“ und dem introvertierten Selbstgespräch „Etre ou ne pas être“. Sein Duett mit Ophélie, in welchem beide von ihrer Liebe singen, steigert sich von schwärmerischem Ausdruck zu ekstatischem Taumel. Mit äußerster Spannung vollzieht sich die erregte Auseinandersetzung mit seiner Mutter Gertrude, die Karolina Gumos mit herbem, dramatisch betontem Mezzo singt. Das Verhältnis zu ihrem Sohn pendelt zwischen inzestuöser Zuneigung und abgründigem Hass. Hamlets Beziehung zu Claudius, den Tijl Faveyts mit körnigem, reifem Bass gibt, wird bestimmt vom Geist seines getöteten Vaters (Jens Larsen mit gespenstisch-fahl tönender Stimme), der aus dem Grab steigt und ihm den Auftrag erteilt, den Mord zu rächen. Am Ende reichte er Hamlet ein Messer, mit dem dieser die Tat vollführt. Eine Glocke senkt sich herab, die Hamlet als neuer König besteigt, freilich eher eine gekreuzigte Leidensfigur abgibt denn einen triumphierenden Regenten. Das Regie-Team bedient damit das Finale der Urfassung von 1868, in welcher der dänische Prinz überlebt.

„Hamlet“ von Ambroise Tomas an der Komischen Oper Berlin/ Szene/ Foto Rittershaus
Das zweite Ereignis der Aufführung am 28. 4. 2023 war die blond gelockte Ophélie der Amerikanerin Liv Redpath, deren Sopran die horrend schwierige Partie mit geradezu mirakulöser Mühelosigkeit bewältigt. Die reiche Farbpalette mit melancholischen, verschatteten, wehmütigen, flirrenden Nuancen bot im Verein mit sensationeller technischer Bravour für die Wahnsinnsszene das perfekte Fundament. Glitzernde Koloraturen, funkelnde Spitzentöne, blitzende staccati, delikate Triller und trancehafte Vokalisen bescheren eine vokale Sternstunde. Himmlisch verklärt dann ihre letzte Szene, in der sie Hamlet erinnert, nicht an ihrer Liebe zu zweifeln.
Es ist ein Verdienst der Inszenierung, dass sie auch das Ballett – neben den großen Chortableaus unverzichtbarer Bestandteil der Grand opéra – in den Handlungsablauf integriert hat. Hier wird es in der Choreografie von Thomas Wilhelm als Ophélies Traum von der Hochzeit mit Hamlet gezeigt. Es ist ein Pas de deux, in welchem der Tänzer im Überschwang des Gefühls seine Partnerin dreht, hebt und durch die Luft wirbelt. Kompetent besetzt sind die Nebenrollen: José Simerilla Romero als Laërte mit tenoralem Strahlen und vehementer Allüre sowie Stephen Bronk als Polonius, Frederic Jost als Horatio und Johannes Dunz als Marcellus mit soliden Auftritten. Zum Abend in seiner Vollendung führt schließlich die musikalische Leitung der Dirigentin Marie Jacquot am Pult des Orchesters der Komischen Oper Berlin. Sie vereint in ihrer Interpretation pathetische grandeur, romantisches Melos, pompöse Festlichkeit, französischen Esprit und sublime Delikatesse. Zu Recht bejubelt das Publikum am Ende eine Aufführung von Ausnahmerang. Bernd Hoppe
.
.
.Szenische Erstaufführung in Braunschweig: Gäbe es nicht eine recht neue Aufnahme der Oper Dante (2017; ein Mitschnit des Münchner Konzertes beim Palazzetto Bru Zane) wäre der der Komponist Benjamin Godard (1849-1895) fast vergessen, der früh das Violinspiel erlernte und bereits seit seinem 10. Lebensjahr am Pariser Konservatorium Komposition und bei Henri Vieuxtemps Violine studierte. Schließlich war er dort ab 1887 Lehrer einer Kammermusikklasse. Als Verfasser von Salonmusik und mehr als einhundert Liedern war er seinerzeit durchaus populär; außerdem komponierte er fünf Sinfonien, je zwei Klavier- und zwei Violinkonzerte, Streichquartette sowie Sonaten und Etüden für Violine und Klavier. In seinen Kompositionen orientierte er sich durchgehend an der Klangsprache Gounods oder Massenets, so auch in seinen sechs Opern, denen er sich erst in den 1880er-Jahren zuwendete.

Godards „Dante“ in Braunschweig/ Szene/ Foto © Björn Hickmann
So komponierte er nach dem Libretto von Édouard Blau die ernste Oper Dante, die 1890 in der Pariser Opéra Comique uraufgeführt wurde. Sie enthält ziemlich zusammenhanglos einzelne Szenen aus der Biographie des mittelalterlichen Dichters und Philosophen sowie als Dantes Traum Szenen aus der berühmten „Göttlichen Komödie“. In der Oper gibt es mächtige Chor-Tableaus, aber auch ausdrucksstarke Arien und Ensembles, wobei die Musik fast durchgehend schwelgt oder sich dramatischen Ausbrüchen hingibt, was auf Dauer in gewisser Eintönigkeit reichlich anstrengend wirkt. Das liegt auch daran, dass es zu wenige Piano-Passagen zur Besinnung oder Kontemplation gibt.
Zuerst sieht man in der Braunschweiger Inszenierung von Philipp Himmelmann das Sterbebett der von Dante geliebten Béatrice. Von hieraus blickt der Dichter in einer Art träumerischer Rückblende in ungemein wirkungsvollen Bühnenbildern ( Paul Zoller, Mitarbeit: Loriana Casagrande) auf einzelne Szenen seines Lebens: So geht es in einen imposanten Versammlungsraum, in dem verbitterte politische Fehden zwischen kaisertreuen Ghibellinen und den Anhängern des Papstes, den Guelfen, stattfinden und Dantes Heimatstadt Florenz zu zerreißen drohen. Diese Streitenden tragen einheitliche, maskuline Kleidung des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts, der Entstehungszeit der Oper (Meentje Nielsen), während die Protagonisten der Sterbeszene am Ende der Oper mit Schlafanzug, Jeans und Polohemd moderne Kleidung tragen (Der Tod ist zeitlos!).

Godards „Dante“ in Braunschweig/ Szene/ Foto © Björn Hickmann
Dante blickt anschließend zurück auf die heftig ausgetragenen Auseinandersetzungen mit seinem Freund Simeone Bardi um die von beiden geliebte Béatrice, die sich zeitweise in einer großen, düsteren Bibliothek mit bis zur Decke reichenden Bücherregalen zuträgt. Bevor es zu den traurigen Schlussszenen kommt, erlebt man nach der Preisung des antiken Dichters Vergil durch eine Gruppe junger Menschen in Matrosenkleidung einen Traum Dantes, in dem – eine sehr eindrucksvolle Szene – Vergil in der Bibliothek aus dem Bilderrahmen tritt. Er führt Dante in die Hölle mit allerlei grässlichen Visionen – jetzt ist der gesamte Chor mit femininer Unterwäsche bekleidet – und anschließend in himmlische Gefilde, wo ihm die geliebte Béatrice erscheint. Vor dem absehbaren Ende im mit blutverschmiertem Kopfkissen und anderen Utensilien reichlich realistischen Krankenzimmer versöhnen sich die Freunde Dante und Bardi; wie von Anfang an wird Béatrice von ihrer treuen Freundin Gemma umsorgt, die deren Ende nicht verhindern kann. Ganz am Schluss nach Béatrices Tod verspricht Dante, sie in seinen Werken unsterblich zu machen, wobei offen bleibt, ob es diese Geliebte tatsächlich gegeben hat oder ob sie nicht von vornherein dichterische Fiktion war.
Trotz der konzertanten Aufführung in München 2016 darf bezweifelt werden, ob diese Oper mit ihrem doch reichlich wirren Plot und der wenig differenzierenden Musik den Weg ins Repertoire schafft. Und auch die genannte Ersteinspielung aus München hilft da trotz illustrer Besetzung sicher

Godards Oper „Dante“ bei den Ediciones Singulares/ ISBN: 978-84-697-4879-4
nicht.
Die musikalischen Leistungen waren in der Premiere herausragend, was auch an der wie immer präzisen und inspirierenden Leitung von Braunschweigs 1. Kapellmeister Mino Marani lag, der trotz aller Lautstärke und bedrängender Dramatik durchgehend sängerfreundlich dirigierte; dabei überzeugte erneut das ausgezeichnete Staatsorchester mit hohem Niveau in allen Gruppen. Ebenso imponierte das dank kluger Personenregie an diesem Abend engagiert und glaubwürdig agierende Opernensemble, das auch stimmlich durchgängig positiven Eindruck machte. Hier ist zunächst Kwonsoo Jeon in der kräfteraubenden Titelpartie zu nennen: Er führte seinen strahlkräftigen Tenor differenzierend durch alle Lagen und sang auch die wenigen Lyrismen in seiner ersten Arie wunderbar aus. Béatrice war Béatrice Kudryavtseva, die mit abgerundeten Melodiebögen und sauberen Piano-Passagen gefiel, sich aber auch in den hochdramatischen Phasen als höhensicher erwies.
Zachariah N. Kariithi als Simeone Bardi setzte seinen charaktervollen, sicher geführten Bariton dramatisch auftrumpfend ein. Nach wie vor höchst kultivierte Stimmführung zeichnet Milda Tubelythè aus, die als Gemma zeigte, dass sie mit ihrem deutlich voller gewordenen Mezzosopran nun auch dramatischeren Anforderungen mehr als nur genügt.
Die kleinere Partie des Schattens Vergils füllte Jisang Ryu mit sonorem Bass aus, während die junge Schottin Rowan Hellier – neu im Ensemble – die Huldigung an Vergil mit in der Höhe leicht flackerndem Mezzo sang; Rainer Mesecke (ein Alter) und Matthew Pena (Herold aus dem Off) ergänzten. Chor und Extrachor, einstudiert von Georg Menskes und Johanna Motter, glänzten durch Klangfülle und stimmliche Ausgewogenheit.
Das Premierenpublikum war von den tollen Leistungen begeistert und bedankte sich bei allen Mitwirkenden und dem Regieteam mit starkem, lang anhaltendem Applaus. Gerhard Eckels
.
.
Dmitri Tcherniakov inszeniert Krieg und Frieden von Sergej Prokofjew komplex und monumental an der Bayerischen Staatsoper München: Eine monumentale Inszenierung für die Bayerische Staatsoper, die Sergej Prokofjews ‚Krieg und Frieden‘ dem erfahrenen Dirigenten Vladimir Jurowski anvertraut. Regie und Bühnenbild stammen von Dmitri Tcherniakov, die Kostüme von Elena Zaytseva.
Tcherniakov wählt einen Blickwinkel, der irgendwo zwischen dem Zeitgenössischen und dem Historisierenden liegt. Er vermischt geschickt das aktuelle Geschehen mit der nahen und fernen Vergangenheit einer Nation, Russland, die heute mehr denn je im Zentrum der sozialen, politischen und kulturellen Debatte in Europa steht. Die Fragen sind zahlreich und offen, die Themen so einfach einerseits wie komplex und vielschichtig andererseits.
Der Regisseur entscheidet sich konsequent dafür, die gesamte komplexe Geschichte, die sich mit vielen Zeit- und Ortssprüngen entfaltet, an einem einzigen ikonischen Ort in Moskau anzusiedeln: dem Gewerkschaftshaus.
Ein historisches Gebäude, das das politische Leben der russischen Hauptstadt in den letzten zweihundert Jahren geprägt hat und in seiner großen Halle mit den neoklassizistischen Säulen verschiedene Momente der Geschichte beherbergt hat: von den Festlichkeiten zur Zeit der Zaren über die sowjetischen Aufmärsche bis hin zu wichtigen Ereignissen der jüngeren Zeit. In diesem Palast wurde zum Beispiel 2022 der Leichnam von Michail Gorbatschow beigesetzt.
Das Bühnenbild stellt mit einer statischen Szene diesen großen neoklassizistischen Saal dar, in dem der Regisseur sich eine flüchtende Menschheit vorstellt, die vor einem nicht näher bezeichneten Krieg oder einer Tragödie geflohen ist und sich in einem ständigen Zustand der Unsicherheit und Bedrängnis befindet.

Prokoffieffs „Krieg und Frieden“ an der Bayerischen Staatsoper München/ Foto Hösl
Die Kostüme sind zeit-genössisch und erinnern an die Bilder, die wir oft in den Massen-Medien sehen, die Ausstattung ist realistisch, manchmal brutal. Es mangelt nicht an Hinweisen auf das Theater und die Kunst der Aufführung, mit Reihen von Theatersitzen, die hier und da verstreut sind.
Die Bühne leert sich nie, alles spielt sich in schneller Folge inmitten von Menschenmassen ab, es mangelt nie an Menschen, die auf dem Boden oder auf improvisierten Feldbetten schlafen, es ist immer eine gewisse Bewegung vorhanden, das Gedränge ist spürbar. Im ersten Akt, dem intimsten und der Friedenszeit gewidmeten Teil, wechseln sich die Szenen im Proszenium in einer im Wesentlichen traditionellen Weise ab. Im zweiten Akt, der vom Krieg beherrscht wird, nimmt der Chor die Bühne verstärkt in Anspruch und die Wirkung, sowohl stimmlich als auch szenisch, einer wütenden und müden Masse ist beeindruckend.
Es mangelt auch nicht an Andeutungen auf das Theater im Theater, fast so, als ob die ganze Geschichte von den Lagerflüchtlingen als Zeitvertreib inszeniert würde. So wirkt die Tanzparty im ersten Akt wie ein improvisiertes Theaterstück dieser vertriebenen Menschheit, die sich die Zeit vertreiben muss, während die Napoleon-Szene im zweiten Akt wie eine Farce zur Belustigung von Kindern wirkt, bei der der französische Kaiser nichts weiter als eine Karikatur der Macht ist.
Das Gleiche gilt für General Kutusow, der resigniert in einem Unterhemd erscheint und apathisch am Tee nippt. Fast das Bild einer Macht, der die leidende Menschheit gleichgültig ist.
Wenn im ersten Akt der Schwerpunkt im Wesentlichen auf der persönlichen Geschichte der Figuren liegt, gibt es im zweiten Akt eine Fülle von politischen Verweisen aus verschiedenen Epochen. Im Finale erscheint auch eine Lenin-Büste im Hintergrund und General Kutusow wird verherrlicht, indem er auf einem Katafalk voller roter Fahnen liegt, ganz im Stil des sowjetischen Zeremoniells.
Die Hinweise sind also zahlreich und komplex, oft eher politisch und symbolisch als auf die Geschichte der Charaktere bezogen. Die sorgfältig orchestrierte und präzise Regie sorgt für eine gute Organisation der Massen, während die Solopartien etwas generisch bleiben. Im Großen und Ganzen gibt es einige sehr gute Momente, aber auf Dauer ist die Menschenmasse vielleicht zu viel, was zu einem ‚Zeffirelli‘-ähnlichen Effekt führt, bei dem man Mühe hat, den Sängern zu folgen, die sich in einer übermäßigen Masse von Menschen verlieren. Auch wenn die Chöre sehr wirkungsvoll sind, die Kulisse, eine einzige für fast vier Stunden Aufführung, zeigt trotz ihrer Beeindruckung einige Grenzen auf.
Ohne Zweifel jedoch sind nur wenige andere Theater in Europa in der Lage, eine Produktion von solcher Komplexität mit vierzig Solisten auf der Bühne anzubieten, zusätzlich zu den Statisten und dem Chor.
Vladimir Jurowski dirigiert die exzellenten bayerischen Ensembles und gibt uns eine moderne und einnehmende Interpretation der Partitur, ohne jemals die Kontrolle über das Ensemble zwischen Orchestergraben und Bühne zu verlieren.
Andrei Zhilikhovskys Bolkonski sticht aus der grenzenlosen Schar von Sängern hervor, seine Stimme ist warm und weich, fähig zu überzeugenden Akzenten und schönen Nuancen. Ihm zur Seite steht die Natascha Rostowa von Olga Kulchynska, die eine selbstbewusste, aufsteigende Stimme hat und uns einen trockenen, überzeugenden Charakter präsentiert. Violeta Urmana in der kleinen, aber intensiven Rolle der Achrossimowa ist großartig, ebenso wie Sergei Leiferkus in der Rolle des Vaters Bolkonski, immer passend und stilistisch einwandfrei. Der unübertroffene Arsen Soghomonyan als Pierre Besuchow, ein sorgfältiger und engagierter Phrasierer in allen Szenen, meistert die Rolle dank einer Stimme mit einem funkelnden Tenortimbre. Erwähnenswert ist auch Tómas Tómasson, der überzeugend einen zur Karikatur gewordenen Napoleon spielte.
Alle anderen Stimmen waren hervorragend, kompakt und professionell in einer meisterhaften Ensemblearbeit, in der alle zu Protagonisten und Schöpfern des Erfolgs der Aufführung wurden: Alexandra Yangel, Kevin Conners, Alexander Fedin, Olga Guryakova, Mischa Schelomianski, Victoria Karkacheva, Bekhzod Davronov, Alexei Botnarciuc, Christian Rieger, Emily Sierra, Martin Snell, Christina Bock, Alexander Roslavets, Oksana Volkova, Elmira Karakhanova, Roman Chabaranok, Stanislav Kuflyuk, Maxim Paster, Dmitry Cheblykov, Nikita Volkov, Alexander Fedorov, Xenia Vyaznikova, Dmitry Ulyanov, Alexander Fedin, Liam Bonthrone, Csaba Sándor, Alexander Fedorov, Stanislav Kuflyuk, Bálint Szabó, Granit Musliu, Aleksey Kursanov, Thomas Mole, Alexander Vassiliev, Mawra Kusminitschina, Xenia Vyaznikova, Andrew Hamilton, Platon Karatajew, Mikhail Gubsky, Christian Rieger, Jasmin Delfs, Jessica Niles.Viel Beifall für alle im Finale. Raffaello Malesci (18 März 2023)
.
.
Oper Frankfurt: Deutsche Erstaufführung. Fast alles ist vor Beginn der Oper schon geschehen. Francesca, die Tochter des Herrn von Ravenna, wurde aus politischen Gründen mit Lanciotto, dem Sohn des Herrschers von Rimini, verheiratet. Da Lanciotto missgebildet ist, gibt man dessen Bruder Paolo als Bräutigam aus. Francesca verliebt sich auf den ersten Blick in den schönen Paolo. In der Hochzeitsnacht muss sie feststellen, dass man sie getäuscht hat. Bei der Rückkehr aus einer Schlacht, und da setzt Saverio Saverio Mercadantes Oper Francesca da Rimini ein, spürt Lanciotto Francesca Abweisung und wird misstrauisch. Bis zum Tod der beiden Liebenden benötigt Mercadante gut drei Stunden Musik. Es braucht geduldige und ausdauernde Hörer, doch die bestrickt Mercadante mit allen Finessen eines italienischen Melodramma romantico. Vor allem den ersten, fast eindreiviertel Stunden langen Akt überzieht er mit einer rossinischen Ornamentik, die die Seelenlage der drei Protagonisten auf subtile Weise auszisiliert und in der Schwebe lässt, bevor er im zweiten Akt zupackt.

Ein beliebter Topos, nicht nur für die Oper: „Paolo und Francesca“, hier nun von Anselm Feuerbach 1865/ Wikipedia
Doch Francesca entstand vor der Reformoper Il Giuramento. Nicht nur die Hosenrolle des Paolo rückt Francesca in die Nähe von Bellinis I Capuleti e i Montecchi über das andere berühmte Liebespaar Italiens. Die Oper Frankfurt brachte Mercadantes Francesca und deren hochromantischen an Rossini und Bellini geschulten Sinnestaumel jetzt in einer im Vorjahr bei den Tiroler Festspielen Erl gezeigten Produktion zur Deutschen Erstaufführung. Hans Walter Richters Inszenierung macht auf fast unmerkliche Weise alles richtig. In dem angeschnittenen Bühnenraum von Johannes Leiacker verweisen die ausgesprochenen geschmackvollen Kostüme der Raphaela Rose und die wenigen Möbelstücke auf die Entstehungszeit. Gelegentlich öffnet sich, wenn Francesca und Paolo sich wegträumen, die Rückwand und zeigt Caspar David Friedrichs Ruine einer gotischen Kirche, deren filigranes Maßwerk wie Stein gewordene Musik wirkt. Die gar nicht kunstgewerblich hingetupften Tanzdoubles von Francesca, Paolo und Lanciotto greifen das Doppelgängermotiv der Romantik geschickt auf. Auch wenn Lanciotto mal wütend Stühle schmeißt, sein Vertrauter Guelfo das böse Buch anzündet, durch dessen Lektüre der Geschichte vom ehebrecherischen Verhältnis des Lancelot und der Guinevere sich Francesca und Paolo näherkommen, und überhaupt im zweiten Teil die Landschaft wie verkohlt wirkt, dominieren die Bilder keinesfalls die von Ramón Tebar mit Geschmack ausgefalteten Formen und Formeln der italienischen Oper der 1830er Jahre und deren virtuose Ausbreitung in den nahtlos ineinanderfließenden vokalen Linien. Von diesem Sog lässt sich auch Frankfurter Opern- und Museumsorchester zunächst sperrig, doch dann durchwegs inspiriert mitreißen.

Saverio Mercandate / Wikipedia/ Gemälde von Cefaly/ Wiki
Er scheint einer anderen Epoche anzugehören, obgleich Saverio Mercadantes Lebensdaten (1795-1870) nahezu identisch mit jenen Rossinis (1792-1867) sind. Wie der fast gleichaltrige Giovanni Pacini (1796-1867) profitierte er von Rossinis Rückzug von der Bühne. In den Schatten gedrängt wurde beider Schaffen zeitweise durch die Werke von Donizetti (1797-1848) und Bellini (1801-35). Doch über seine lange Schaffenszeit gelang es Mercadante eine bedeutende Schanierfunktion zwischen Rossini und Verdi einzunehmen. Mercadantes erste Oper kam 1819 in Neapel heraus, wo er mehr als 45 Jahre und rund 60 Opern später sein Schaffen 1866 mit der letzten vollendeten Oper Virginia beendete. Der ebenso fleißige Pacini brachte es zwischen 1813 und 1858 auf 70 bis 80 Opern. Geboren wurde Mercadante im schönen auf einer Anhöhe etwa 45 südwestlich von Bari und nicht weit vom Weltkulturerbe Matera liegenden Städtchen Altamura. Weniger als 100 Kilometer sind es bis Martina Franca, wo das Festival della Valle d’Itria viel für die Wiederentdeckung von Mercadantes Werken tat. Dazu gehörte 2016 auch die späte Uraufführung der Francesca da Rimini.
Nachdem er in Neapel als Hauskomponist am San Carlo Rossini nachgefolgt war, hielt sich Mercadante 1827-30 in Spanien auf, wo bei seinem zweiten Besuch in Madrid 1831 die geplante Uraufführung der Francesca da Rimini, ebenso wie später in Mailand, nicht zustande kam. Francesca wirkt wie aus einer anderen Zeit. Das liegt auch an einer gewissen metastasianischen Steifheit, mit der Felice Romani die Geschichte erzählt. Mercadantes große Werke der Reifezeit folgten erst wenige Jahre später mit I Briganti für Paris, Il Giuramento und Il Bravo für die Mailänder Scala; später konzentrierten sich die Uraufführungen auf das San Carlo. Mit seinem ursprünglich 1823 für Giuseppina Strepponis Vater Feliciano entstandenen Libretto folgte Felice Romani der von Mazzini ausgerufenen Rückbesinnung auf Dante, in dessen Werk sich „passione, amor patrio, orgoglio e forza nazionale“ vereinen und der in seiner Göttlichen Komödie im 5. Gesang des Inferno die Geschichte Francescas erzählt. Insgesamt schrieb Romani elf Libretti für Mercadante, der darüber hinaus weitere sechs Textbücher verwendete, die Romani bereits für andere Komponisten verfasst hatte.

Mercadantes „Francesca da Rimini“ an der Oper Frankfurt/ Szene/ © Barbara Aumüller
Getreu alter Muster hat Mercadante den drei Protagonisten jeweils ihre Arie im ersten Akt und ihre Szene im zweiten Akt zugeteilt. Er weitet die Seelenräume durch wenige Terzette und Quartette, wo Francescas Vater Guido hinzutritt, und umklammert und durchgliedert sie mit Chören, die mehr als nur Kommentar bieten. Die schicksalhaft von der Liebe zu Lanciottos jüngerem Bruder Paolo erfasste Francesca ist bei Jessica Pratt gut aufgehoben, die lange kristalline Kantilenen über die Ensembles spannt und deren etwas weißer Sopran vor allem in der Höhe Zauber und Reiz besitzt. In ihrer von der Harfe begleiteten Cavatina singt Pratt noch etwas schwerfällig lasch und mit körperloser Tiefe, doch ihre Gefängnisszene mit Englischhorn steigert sie mit stupendem Ziergesang zu einer bravourösen Primadonnennummer. Als Lanciotto besticht Theo Lebow nicht durch das verführerischste Timbre, aber sein charaktertenoral weinerlicher Ton greift das „Herzklopfen“ des betrogenen Ehemanns passgenau auf. Trotz der gekrähten Höhe realisiert Lebow die schwere Partie mit seinen Möglichkeiten sehr gut, da er ist ein sensibler Deuter ist, der in seiner großartigen mit süßen Zwischentönen ausgeleuchteten Szene zu Beginn des zweiten Akts zeigt, welche Wucht in Mercadantes Musik liegt. Mit ihrem hellen, technisch fundierten, nicht allzu großen, aber vielfarbigen Mezzosopran zeigt Kelsey Lauritano nicht nur in ihrer Rossini-Nummer im ersten Akt lieblich unaufdringliche Koloraturkunst und in ihrer Szene im zweiten Akt gestalterische Intensität, sondern ist Francesca und Lanciotto eine stilsichere Duett-Partnerin. Ausgezeichnet der farbenreich frische Bariton von Erik van Heyningen als Francescas liebevoller Vater Guido (26.2.23). Rolf Fath
.
.
Les Russes: Staatstheater Meiningen: Deutsche szenische Erstaufführung von Georges Bizets fünfaktiger Grand opéra Ivan IV. Eine Blume spielt auch hier schon eine Rolle. Sie wird nicht dem arglosen Sergeanten Don José von der Fabrikarbeiterin Carmen zugeworfen, sondern Marie von einem Fremden überreicht, der sich mit einem Begleiter in den Bergen des Kaukasus verirrt hat. Sorgfältig schält er „la fleur“ aus dem Schnee und überreicht sie dem Mädchen, das sich auf Anhieb in ihn verliebt. Bald darauf sind die von Maries Vater Temrouk angeführten Tscherkessen in heller Aufruhr: „Les Russes“. Zar Ivan IV. lässt nämlich seine Soldaten aufmarschieren und Marie entführen. Dass es im Kaukasus und im Kreml, wo Marie schließlich im Zaren ihren geheimnisvollen Fremden erkennt, sich von ihm umwerben lässt und ihn heiratet, manchmal ein bisschen wie bei den Schmugglern in der wilden spanischen Bergen klingt, Rhythmik und Modulationen mehr von Spanien als dem Kaukasus künden und die Serenade von Iwans Begleiter, dem jungen Bulgaren, einen ebenfalls spanischen Tonfall hat, kommt nicht von ungefähr. 1863, fast zehn Jahre bevor er von der Opéra Comique den Auftrag zur Carmen bekam, hatte Georges Bizet das Libretto zu Ivan IV erhalten. Charles Gounod, der den Text von François-Hippolyte Leroy und Henry Trianon bereits vertont hatte, gab seine Rechte zurück, nachdem sich die Aussicht auf eine Aufführung an der Opéra zerschlagen hatte und rettete einige Passagen; der Soldatenchor in Faust stammt aus dem Ivan IV.-Projekt. Das gleiche widerfuhr Bizet, der auf eine Aufführung seines Ivan le Terrible am Théâtre Lyrique gehofft und anschließend mit der Grand Opéra verhandelt hatte. Die Grand opéra über Iwan IV., besser bekannt unter seinem Beinamen „der Schreckliche“, dem er durch ausgesucht sadistische Folterungen und Hinrichtungen seiner Widersacher gerecht wurde, blieb unaufgeführt. Spuren der Musik finden sich in anderen Werken Bizets. Erst Ende der 1920er Jahre tauchte das Autograph wieder auf. Und gar erst 1951 erfolgte in Bordeaux die Uraufführung, allerdings in einer Bearbeitung durch Paul Henri Büsser, der sich Aufführungen in Köln, Linz und Basel anschlossen. Die konzertante Aufführung der BBC in Manchester unter Brydon Thomas mit John Noble und Jeannette Scovotti ging anlässlich Bizets 100. Todestag 1975 unter Benutzung der von Howard Williams erstellten fünfaktigen Neufassung der Oper erstmals auf das Manuskript zurück. Williams hatte zu diesem Zweck den von Bizet nicht fertig orchestrierten letzten Akt ergänzt und orchestriert. Williams stellte diese Fassung 1987 in London und 1991 in Montpellier vor, Michael Schønwandt benutzte sie 2002 für seine Pariser Konzertaufführung mit Ludovic Tézier und Inva Mula. Nachdem ihm die Kammeroper St. Petersburg im Dezember 2022 mit der szenischen Uraufführung der fünfaktigen Fassung zuvorgekommen war, präsentierte das Staatstheater Meiningen (2023) jetzt die deutsche szenische Erstaufführung der fünfaktigen Fassung von Bizets Grand opéra mit dem Zusatz „5. Akt ergänzt und orchestriert von Howard Williams“.

Bizets „Ivan IV“ in Meiningen/ Szene/Foto Iberl
Den historischen Hintergrund zu Bizets Ivan IV., der auch in Tschaikowskys Opritschnik sowie in Rimsky-Korsakows Das Mädchen von Pskow und (indirekt) in Die Zarenbraut auftaucht, bildet Ivans Ehe mit Marija Temrjukowna (1511-69), der Tochter des tscherkessischen Fürsten Temrouk, welche Ivan nach dem Tod seiner ersten Gattin 1561 heiratete. Intrigen von Marias Vater Temrouk und ihrem Bruder Igor, die gemeinsame Sache mit Ivans falschem Vertrauten Yorloff machen, Attentate und Verschwörungen sowie Konflikte der Russen mit den muslimischen Bergvölkern bilden den zusammenfabulierten Hintergrund zu einer veritablen Grand operá. Das Problem bestand darin, dass die Gattung zur Zeit der Entstehung eigentlich bereits aus der Mode war, wenngleich in jenen Jahren (1865) noch Meyerbeers Africaine posthum aufgeführt wurde. Natürlich gibt es in Ivan IV. viele Schönheiten, geschmeidige Arien, wie Maries “Il me semble” oder die erwähnte Serenade des jungen Bulgaren „Ouvre ton coeur a l’amour“ – eine Hosenrolle, die in frühen Aufnahmen jedoch einem Tenor übertragen wurde – und Duette, darunter gleich anfangs das hübsch verspielte Duett der Marie mit dem jungen Bulgaren sowie das in ein Terzett der Verschwörer Yorloff/ Temrouk/ Igor mündende Duett von Vater Temrouk und Sohn Igor zu Beginn des dritten Akts und elegante Ensembles. Insgesamt bleibt der Fünfakter doch recht steif und bemüht. Die ersten beiden Finali sind große Würfe, vor allem das Ende des zweiten Aktes steigert sich zu einem dramatischen Szenenkomplex, wie er jeder italienischen Oper der Epoche gut angestanden hätte. Doch die musikalischen Entwicklungen sind vorhersehbar und in der zweiten Hälfte scheint Bizet irgendwie die Lust verloren zu haben. Aber das kann man dem Mittzwanziger Bizet, der keinen rechten Zugang zum Meyerbeer-Genre fand, kaum vorwerfen. Auch mit Les pêcheurs de perles, La jolie fille de Perth und Djamileh begab er sich nach Ivan IV. in exotische Regionen, bevor er mit dem ihm genauso fremden Spanien der Carmen bleibenden Erfolg hatte. Alle eventuellen Vorbehalte gegenüber dem Werk fegen Philippe Bach und die Meininger Hofkapelle am Premierenabend hinweg. Zusammen mit den nicht nur bei den Hochzeitsgesängen zu Beginn des dritten Aktes exzellenten Chören des Staatstheaters Meiningen kosten sie sowohl die feinen instrumentalen Delikatessen wie die pauschale Wucht dieser Grand opéra aus.

Bizets „Ivan IV“ in Meiningen/ Szene/Foto Iberl
Die Aufführung scheint mir besser gelungen als Bizets Kokettieren mit der Grand opéra. Intensive Episodenrollen liefern dazu Tamta Tarielashvili als aus dem Nonnenkloster erdig raunende Zarenschwester Olga, Andreas Kalmbach als russischer Offizier sowie Sara-Maria Saalmann als soubrettenmunterer Bulgare. Packend entworfen ist die Figur des Temrouk, dessen Hilferuf „Laissze-moi ma fille“ sich als eindringliche Melodie über dem ersten großen Ensemble wölbt. Paul Gay, der die Partie bereits 2002 in Paris unter Schønwandt gesungen hatte, bringt die Wucht seines erzenen Bassbaritons auch in Meinigen großartig zur Geltung, überragt im wahrsten Sinn des Wortes die Ensembles, singt mit eindringlicher Prägnanz und macht den mit alttestamentarischer Würde ausgestatteten Temrouk fast zur Hauptfigur; auf jeden Fall ist er der gewaltige Gegenspieler des Zaren. Vom jungen Liebhaber bis zum resignierenden, langsam im Wahn endenden Herrscher kann Tomasz Wija über die fünf Akte ein darstellerisch packendes Porträt vom körperlichen und psychischen Verfall des Zaren entwerfen und die erlittenen Blessuren mit seinem kantigen Bass nachzeichnen. Mercedes Arcuri sang die Marie mit zartem Vibrato, nicht unangenehm süß-säuerlichem Timbre und schöner Virtuosität in ihrer großen Arie im vierten Akt. Die darauf folgende Arie ihres als Selbstmordattentäter in den Palast eindringenden Bruders Igor, der von den heimatlichen Bergen, von Mutter und Schwester schwärmt, klingt wie Micaelas Gruß von der Mutter. Alex Kim singt das mit jungheldischem Willen, zu viel Überdruck und unebener Linie. Im anschließenden, zwar subtilen, aber auch länglichen Duett sind beider Stimmen nur noch erschöpft. Doch dann geht es gegen Ende des 4. Aktes auch Schlag auf Schlag. Der Kreml brennt, Ivan verfällt dem Wahnsinn, der von Shin Tamiguchi mit vornehmer Durchtriebenheit gesungene Bojar Yorloff verkündet den angeblichen Tod des Zaren. Doch Ivan kann sich aus dem Kerker befreien, schwingt sich zu alter Kraft auf, bestraft den Verräter und rettet Marie und ihren Bruder vor der drohenden Hinrichtung. Fortsetzung folgt in Boris Godunow. In schlicht einprägsamen Bildern, die manchmal suggestive Kraft entwickeln, hatte Hinrich Horstkotte diesen Ivan IV. wie als Vorgriff auf Mussorgskys Drama in einer Mischung aus Kultur- und Religionskrieg und persönlichen Schicksalen entworfen, von der Schüssel, in der Ivan seine Blut getränkten Hände reinigt, der langen Tafel, auf der der junge Bulgare den Übergriffen der Soldaten ausgesetzt ist, der Krönung, bei der der Zar mit Gold überschüttet wird, bis zu den stillen Bildern in der Kammer der Marie mit dem Baldachin-Bett und den Schlussbildern mit der Niederschlagung der Palastrevolution und dem riesigen weißen Tuch, das sich, gelb und blau angestrahlt, über die Massen senkt. Großer Jubel deshalb für den Regisseur, der selbst die Ausstattung besorgt hatte, noch größerer Jubel für alle Mitwirkenden (.24.2.23) Rolf Fath
.
.
Vaincre mourir: Theater Erfurt: Rossinis französische Tragédie lyrique Le Siège de Corinth – Mehr als ein One-Night-Stand. Pamyra hat sich in den Mann, der sich Almanzor nennt, verliebt. Leidenschaftlich vergnügt sie sich mit ihm im Bett. Lustvoll und elegant tastet die Kamera die Dessous und Körper ab. Es bleibt während der Ouverture noch genügend Zeit, um vom Videodesign von Mayke Hegger und Lukas Eicher zu den Schrecken einer kriegerischen Belagerung zu schwenken. Ein Mann wiegt den blutenden Körper eines Kindes auf seinen Knien, Menschen, teilweise mit Gasmasken, irren verwirrt durch die bedrohte Stadt und die Scharen der Flüchtenden – die in großer Zahl herbeigeströmte Bürgerstatisterie – kauern sich verängstigt um ihren Anführer Cléomène. Korinth wird vom türkischen Sultan Mahomet II. und seinen Truppen belagert. „Vaincre ou mourir“, „Siegen oder sterben“. Die Devise wird auf der Rückwand ausgegeben und in den Momenten der Erhebung gegen die Feinde neu entrollt, bevor sie von den Belagerern durchbrochen und ein Schmerzensmann aufgehängt wird. Mohamet selbst erscheint. Ein Schock. Pamyra, die sich in Erinnerung an die Liebesnacht gerade noch weigerte, den jungen griechischen Krieger Néoclès zu heiraten und auf Wunsch ihres Vaters Cléomène sich lieber das Leben nehmen soll als zur Sklavin zu werden, erkennt im feindlichen Anführer ihren Geliebten Almanzor.

Rossinis „Siège de Corinth“ in Erfurt/ Foto Edelhoff
In Paris, wo Gioachino Rossinis Oper über die Belagerung von Korinth im Oktober 1826 uraufgeführt wurde, war klar, für wen die Herzen der Bevölkerung schlugen. Pamyra entscheidet sich für ihr Volk, entsagt ihrer Liebe zu Mahomet und lässt sich vom Vater mit Néoclès verheiraten. Ein letztes Gebet, „Juste ciel“, dann ersticht sie sich vor den Augen Mahomets, dessen Hand sie immer noch zärtlich umfasst. Das große patriotische Gemälde, mit dem Rossini und seine Autoren quasi Tagespolitik kommentierten und Partei für die Griechen ergriffen, entfaltet auch bei seiner Aufführung am Theater Erfurt seine Wirkung. Mit Pathos und flammender Inbrunst beschwört der Priester Hiéros die Vision eines freien Griechenlands. Die Chöre strömen in den Zuschauerraum und rücken den Besuchern mit ihren patriotischen Kriegsparolen „Nous verrons dans les champs de la gloire“ dicht auf die Pelle. Dem Eindruck kann man sich nicht entziehen. Der Inszenierung von Markus Dietz fehlt es nicht an beklemmenden Kriegsszenarien, aber sie lässt im dezent und elegant ausgeleuchteten zweiten Akt während den Vorbereitungen zu Hochzeit Pamyras mit Mahomet mit den ebenso dezent und eleganten schwarz-goldenen Kostümen Raum für Sinnlichkeit und die immer noch knisternde erotische Anziehung zwischen Mahomet und Pamyra. Sachter Goldregen. Dann wieder Krieg. Mahomets Auto ist ausgebrannt, Feuer überall, auf der Drehbühne (Ines Nadler) dreht sich Pamyra bei ihrem Gebet wie im Taumel.
Mit dem Siège de Corinth hatte Rossini geschickt die Gefühle seines Publikums erkannt. „Paris“, so die Dramaturgie, „war ein aktives Zentrum der Unterstützung des griechischen Aufstands und die politische Bedeutung des Werkes war offensichtlich. Es handelte sich wahrscheinlich um eine der ersten Opern, die sich direkt mit der aktuellen Geschichte auseinandersetzte“. Zunächst ging es wahrscheinlich darum, die Tore der Académie Royal zu stürmen, wo er eine seiner bereits in Italien aufgeführten Opern zu einer französischen Tragédie-lyrique um- und neuschrieb. Als sich Rossini 1824 in Paris niederließ, um mit Ferdinando Paër das Théatre Italien zu leiten, an dem er im folgenden Jahr Charles X. und zu dessen Krönung in Reims mit Il viaggio a Reims seine Referenz erwies, streckte er rasch seine Fühler nach der Académie Royal de Musique aus. Nicht ungeschickt folgte er dem Beispiel Sacchinis, der für seinen Einstand in Paris einst zwei seiner italienischen Opern umgearbeitet hatte. Rossini wählte Maometto II. und Mosè in Egitto aus. Auf diese Weise wurde aus dem in Neapel wenig erfolgreich uraufgeführten Dramma per musica in zwei Akten Maometto II. die dreiaktige Tragédie lyrique Le siege de Corinthe. Die Handlung wurde von der unter venezianischer Herrschaft stehenden Insel Negroponte des Jahres 1470 in das Korinth des Jahres 1458 verlegt. Der Eroberer ist der gleiche: Sultan Mehmed II. bzw. Maometto II. oder Mahomet II., der nach dem Fall von Konstantinopel und dem Ende des Byzantinischen Reiches seinen Machtbereich sukzessive erweiterte. Luigi Balocchi und Alexandre Soumet übersetzten und passten das ursprüngliche Maometto-Libretto an und schufen neue Teile. Die Verlegung nach Korinth sicherte der 1826 uraufgeführten Oper zudem plötzlich politische Relevanz, war doch Lord Byron zwei Jahre zuvor im Freiheitskampf für die Griechen in der Stadt Messolongi gefallen, die sich heftig dem Osmanischen Reich entgegenstemmte. Begeisterung für das Griechentum, doch vor allem Rossinis Einbettung des Belcantos in die rezitativisch durchgliederten Großformen der Tragédie lyrique garantierten der ersten französischen Oper Rossinis, die sich nach der glänzenden Uraufführung rund zwanzig Jahre auf dem Spielplan des Hauses hielt, ihren Erfolg. Die unmittelbar anschließend auch in Deutschland aufgeführte Oper scheint jedoch hierzulande in den letzten Jahrzehnten nicht gespielt worden zu sein.
Am Theater Erfurt kam jetzt die neue wissenschaftlich-kritische Neuausgabe von Damien Colas zur Aufführung (Besuchte Aufführung am 25.2.23), deren Entstehung durch die schlechte Quellenlage erschwert wurde, da kein Autograph existiert und ab der ersten Aufführung Striche, Veränderungen und Ergänzungen vorgenommen wurden. Philip Gosset nannte Siege denn auch „the impossible opera“.

Rossinis „Siège de Corinth“ in Erfurt/ Foto Edelhoff
Erstmals erklungen war Colas‘ Edition 2017 beim Rossini-Festival in Pesaro unter Roberto Abbado (mit Luca Pisaroni als Mahomet II. und Nino Machaidze als Pamyra). Der Eindruck war in Erfurt am Ende ein starker, was sich zu Beginn der Aufführung so nicht abzeichnete. Der Klang der weit um den Orchestergraben formierten Chöre wirkte doch etwas getrübt und gestreut, bevor sich der Chor des Theaters Erfurt zu einer mächtigen Leistung sammelte. Stärker als in anderen Aufführungen merkte man dann, dass die Belagerung vor allem eine Choroper ist. Anfangs ließ Yannis Pouspourikas den Puls der Musik zu sachte schlagen, das Philharmonischen Orchesters Erfurt spielte eckig, eher aggressiv und hart als leidenschaftlich, bevor sich spätestens im dritten Akt nach der Pause ein gerundeter, feierlich breiter Klang einstellte und die zunächst anämische Aufführung an Feuer gewann, was nicht an den Flammen in den Metallkesseln lag. Wohl eher an Rossinis Schreibweise und seiner Kunst, Szenenblöcke zu hinreißender Wirkung zu bringen und in der Szene des Priesters noch eine Melodie von ausgesuchter Schönheit zu erfinden. Mit seinem wohlig runden Bassbariton war Arturo Espinosa als Mahomet ein softer Macho, mehr Liebhaber als Kriegs-Manager, mit schöner Beweglichkeit, reicher Farbgebung und eindringlicher Phrasierung. Keine typischen Rossini-Tenöre sind Luc Robert und Brett Sprague. Der Kanadier Luc Robert sang den Cléomène mit einem Spintotenor von erstaunlicher Wandlungsfähigkeit, nicht ganz ungefährdet, aber markant. Als Feinripp-Krieger Néoclès gefiel der Amerikaner Brett Sprague mit einem schön durchgebildeten lyrischen Tenor und fein angebundenen Höhen. Beide steigerten das große Terzett mit Pamyra im 3. Akt, die Hochzeitszene, zu einem musikalischen Höhepunkt der Aufführung. Der leichte lyrische Sopran von Candela Gotelli, etwas farblos und flach, kann die Partie der Pamyra noch nicht ausschöpfen, aber die Argentinierin agierte mit Feuer und Leidenschaft. Edel und elegant der helle Bass von Emanuel Jessel als Hiéros. Die Vertrauten der Pamyra, des Cléomène und Mahomet gaben Valeria Mudra, Jörg Rathmann und Tobias Schäfer (25.2.23). Rolf Fath
..
.Uraufführung in Ulm: „Iseut“. Dreimal flüstert Tristan den Namen der Geliebten „mit den letzten Atemzügen“. Dann stirbt er und „die in der Ferne läutenden Glocken mischen sich unter die Stimmen“, die vom Ort ewiger Liebe künden, „wo alle Schönheit aufblüht“, während sich Iseut stumm zu Tristan legt und stirbt. Kein Liebestod. Natürlich nicht. „Nach den drei ›Iseut!‹ löst sich die Seele von der Hülle und befindet sich sofort inmitten der heiteren Regionen, und dann beginnt das Konzert der Oboen…. Es ist alles in allem ein herrliches, endloses, spirituelles Fest, das ich dem Orchester mit einer Glocken-Sinfonie überantworten möchte,“ beschreibt Charles Tournemire das Ende seiner Légende de Tristan. Charles Tournemires 1925/26 komponierte und ursprünglich zur Aufführung an der Pariser Opéra bestimmte La Légende de Tristan ist ein Gegenentwurf zu Wagners Tristan und Isolde. Sublim in Ausdruck, Musik und Gestik. Keine überbordende Liebesnacht-Leidenschaft, sondern als Eingeständnis, dass die Trennung die letzte Prüfung ihrer Liebe sei, Iseuts Rückzug in die Ehe und Tristans Flucht in Einsamkeit und schließlich sein Tod. Das Theater Ulm holte mit der Uraufführung von Tournemires La Légende de Tristan jetzt ein Versäumnis nach, das auch eine französische Bühne inspirieren sollte. Der 1870 in Bordeaux geborene und im Alter von 69 Jahren in Arcachon gestorbene Charles Tournemire griff dazu auf den im Jahr 1900 erschienen Roman de Tristan et Iseut zurück, in dem der Romanist und Mittelalter-Spezialist Joseph Bédier die alten französischen und englischen Quellen neu ordnete: Irland wird von einem Drachen beherrscht. Ein Fremder taucht auf, bezwingt den Drachen und darf als Belohnung Iseut, die zu spät in ihm den Mörder ihres Onkels Morholt erkennt, zur Braut nehmen. Tristan tut das nicht für sich selbst, sondern will Iseut seinem König Marc von Cornwall als Braut zuführen. Um für eine glückliche Ehe zu sorgen, hat die Gesellschafterin Brangien einen Liebestrank vorbereitet, den Iseut und Tristan ahnungslos trinken und in Leidenschaft zu einander entbrennen. Der König bemerkt die Vertrautheit der beiden und wird durch den Zwerg Frocin in seinem Misstrauen bestärkt. Bei ihrem Stelldichein merken Iseut und Tristan, dass sie vom König und dem Zwerg belauscht werden und verhalten sich zurückhaltend, worauf Marc von der Treue Tristans überzeugt ist. Die Liebenden entfliehen. Schlafend werden sie von dem König entdeckt, der weiterhin von Tristans Treue überzeugt ist, als er Tristans trennendes Schwert zwischen den beiden erblickt. Heimlich vertauscht er Tristans Schwert mit seinem eigenen. Tristan erkennt die Botschaft und drängt Iseut, zu ihrem Gemahl zurückzukehren. Tristan zieht in die Welt, wird aber von Sehnsucht nach Iseut verzehrt und kehrt in der Verkleidung eines Narren an den Hofs Marcs zurück, wo die Liebenden endgültig Abschied von einander nehmen. Im achten und letzten Bild findet Tristans Seele, wie es in der Inhaltsangabe heißt, im Jenseits ihren Frieden.

Charles Tournemires „Légende de Tristan“ in Ulm/ Szene/ Foto Jochen Klenk
Basierend auf Tournemires Szenarium verfasste ein anderer Mediävist, der Sorbonne-Professor Albert Pauphilet, Anfang der 1920er Jahre das Libretto, das in acht Bildern Tristans Leidensweg entwirft. An dieser Zeitenwende nach dem Ersten Weltkrieg setzt auch die handfeste, manchmal überdeutliche Inszenierung des Ulmer Intendanten Kay Metzger an, der die Wiederentdeckung nachdrücklich und verdienstvollerweise betrieben hatte. In einem Salon mit üppig bestückten Bücherregalen kümmern sich Krankenschwestern um die Kriegsverletzten, schart sich die adelige Familie um einen der ihren, den toten Onkel Morholt, und versucht die Dienerschar das kriegerische Geschehen auszublenden. Ein gegnerischer Offizier stürmt herein, gewinnt sich Ansehen durch seinen tapferen Kriegseinsatz, was durch Videoeinblendungen dramatischer Kriegsbilder unterfüttert wird, und erhält die Tochter des Hauses (Ausstattung: Michael Heinrich). Im unveränderten Ambiente trifft Iseut ihre Hochzeitsvorbereitungen, während Tristan sich mit Rasiermesser und -Schaum Kriegserlebnisse aus dem Gesicht schabt. Bald ist sie eine anständige Hausfrau mit züchtiger Hochsteckfrisur, die sich im vorgeblichen Stelldichein, das von dem hinter dem Weihnachtsbaum versteckten Marc beäugt wird, zurückhaltend gibt. Erst, als Iseut und Tristan in den Wald fliehen, geben sie den Salon für ein enges „Bohème“-Dachzimmerchen auf, in dem sie an der Nähmaschine werkelt und ihm nichts anderes übrigbleibt, als auf dem Bett zu lagern. Nach ihrer Trennung kehrt Tristan als Narr verkleidet während eines Maskenfestes nochmals in den Salon zurück, um für immer Abschied von Iseut zu nehmen. Als er zuletzt sterbend auf einer Bahre hereingetragen wird, ist er für Krankenschwester Iseut nur noch eine Schimäre ihrer einstigen Liebe. Das vollzieht sich musikalisch und szenisch sehr flüssig, ruhig und in einer nachtwandlerischen Folgerichtigkeit, als seien Iseut und Tristan Kinder von Pelléas et Melisande, die Pauphilets altertümlich steifen Text Silbe für Silbe singdeklamieren, ohne Verzierung und Ausschmückung, ohne Wiederholung, fast spröde und skelettiert, wodurch der viele Text in weniger als 2 ½ Stunden untergebracht werden kann.
Die spätimpressionistischen Tonvaleurs erhitzen sich nur ganz kurz im „Liebesduett“ am Ende des zweiten Aktes, wo sich Iseut zum vollen Bekenntnis „Je t’aime“ aufschwingt und An de Ridders schöner Sopran seine üppige Mittellage entfalten kann, während Markus Franckes charaktervoll schlanker Spezialtenor vor allem den entrückten Tristan des dritten Akts, der auf dem „Schmerzenfelsen“ von den „Tränen der Wellen und des Nebels“ phantasiert oder im „Der wahnsinnige Tristan“ überschriebenen vorletzten Bild mit sarkastischen Untertönen die Geschichte rekapituliert, an starkem Ausdruck gewinnt. Noble Haltung in den langen Gesangsphrasen und der klaren Textbehandlung zeichnen Dae-Hee Shins Roi Marc aus, während der Spieltenor Joshua Spink als Zwerg Frocin zu ätzendem Sprechen und grellen Sprechgesang angehalten ist, I Chiao Shin als Brangien erdig verglühende Mezzotöne beisteuert und Chor und Extrachor eine mythisch, neoklassizistisch eindringlichen Haltung einnehmen. Für Tournemires Musik finden sich schwer Vergleiche. Oder ganz viele, nicht nur von Debussy bis Strawinsky, von Gregorianik bis Impressionismus. Das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm und GMD Felix Bender reizen sowohl die kammermusikalische Intimität der Partitur aus wie die atmosphärisch bezwingende, gegen Ende rauschhaft steigernde Intensität der Zwischenspiele, das Spiel mit altertümlichen Formen und neuer Anverwandlung, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg „Les Six“ proklamierten, und den Wechsel aus herben Signalen und spielerischer Jagd-Szenerie, entrückter Klangmalerei und spröder Wort-Ton-Behandlung. Warum die Oper nicht aufgeführt wurde, ist nicht bekannt. Klingen in ihr doch nochmals der Französische Wagnérisme und die Beschäftigung mit mittelalterlichen Stoffen und Legenden nach, wie man sie in Reyers Sigurd von 1884, Lalos Roi d’Ys von 1888, Magnards Guercoeur von 1901 (erst 1931 uraufgeführt), Chaussons Roi Arthus von 1903 und auch in Hulda und Fervaal von Tournemires Lehrern César Franck und Vincent d’Indy sowie in den symbolistischen Maeterlinck-Märchen von Debussy (Pelléas et Mélisande) und Dukas (Ariane et Barbe-bleue) findet. Tournemire soll kein liebeswürdiger Zeitgenosse gewesen sein. Das allein kann kein Grund gewesen sein.

Charles Tournemires „Légende de Tristan“ in Ulm/ Szene/ Foto Jochen Klenk
Tournemire hatte bei Franck und D’Indy sowie Charles Widor studiert, wirkte ab 1898 bis zu seinem Tod als direkter Nachfolger von Gabriel Pierné als Organist an der Pariser Kirche Sainte Clotilde Kirche, deren Organistin auch Franck gewesen war, und lehrte ab 1919 als Professor am Conservatoire. Als Organist und Orgelimprovisator wurde er bewundert: Eingeweihten ist er heute als Komponist gewaltiger Orgelwerke, darunter sein Hauptwerk L’Orgue Mystique, zu denen er sich in der Abgeschiedenheit auf der Insel Ouessant vor der bretonischen Küste inspirieren ließ, und acht Orchestersinfonien bekannt – zur Vorbereitung auf die bereits für Mai 2020 zum 150. Geburtstag des Komponisten geplante Uraufführung hatte des Ulmer Philharmonische Orchester 2019 seine dritte Sinfonie „Moscou 1913“ gespielt. Für die posthume Uraufführung ließ das Theater eigens von Michael Weiger eine Edition erstellen, der die Musik so zu beschreiben versucht, „Vielleicht könnte man seine Musik als frühen ›französischen Expressionismus‹ bezeichnen. Ähnlich wie z.B. Max Reger und Richard Strauss in Deutschland bildet Tournemire farbige Akkorde, die sich nicht mehr unbedingt auflösen, er verwendet mutig Dissonanzen, die uns einmal dramatisch schroff und ein andermal ›modern‹ erscheinen. Ähnlich wie diese geht er harmonische ›Wagnisse‹ ein, er experimentiert in seiner Klangsprache, ohne wirklich atonal zu komponieren. Im Gegensatz zu den weicheren idyllischen Akkordfärbungen des Impressionismus erscheinen seine Klänge eher nüchterner und trockener, er sucht nach Mitteln, um noch zu übertreffen, was romantische ›Ideale‹ erlauben, und wählt dem Zeitgeist entsprechend als sein Instrument ein hochdimensioniertes expressives Sinfonieorchester. Im Graben der Weltpremiere in Ulm findet sich ein umfangreiches Instrumentarium wie z.B. 3 Fagotte, Sarrusophon, 4 Posaunen, Tuba, 2 Harfen, Celesta, Baritonoboe, Basstrompete, Tamtam und Glocken, um nur einige hervorzuheben.“ Rolf Fath
.
.
Massenet in Lyon: Eigentlich müsste die Oper natürlich Salomé nach ihrer Hauptrolle heißen, denn Mutter Herodiade hat nicht viel Solistisches zu tun und wirkt eher in den Ensembles und Duetten. So erscheint es merkwürdig und nur aus der Genesis des Werkes erklärbar, dass Massenet sein Jerusalem-Drama nach der Mutter und nicht nach der Tochter benannte.
Die konzertante Aufführung dieser Hérodiade nun an der Opéra National de Lyon im November 2022 genussvoll erleben zu können, ohne die Augen schließen zu müssen und Angst vor den Grauenhaftigkeiten der Regie haben zu müssen, wie es kürzlich in der Bastille der Fall war, ließ den Fan nach Lyon reisen Es überrascht und Heutige einmal mehr, dass das Libretto von Paul Milliet und Henri Grémont nach der Novelle Hérodias (1877) von Gustave Flaubert genug von dem Riskanten aufweist, was bei den Aufführungen in Lyon 1885-1886 einen Skandal auslöste und dass die Oper bis 1926 von den katholischen Behörden Frankreichs auf den Index gesetzt wurde. Naja, was könnte schließlich für damalige Zuschauer unanständiger sein, als sich einen Wüstenrufer Johannes vorzustellen, der kurz vor seinem Märtyrer-Tod plötzlich von der Flamme des sinnlichen Verlangens durchdrungen wird („wet dreams“ nannten das meine amerikanischen Kollegen respektlos), wenn er sich an seine junge, exaltierte Verehrerin erinnert. Und wie ist es mit den erotischen Träumereien des Herodes, die mit einem üppig satinierten Saxophon verziert sind, und dessen „Vision fugitive“ ein einsames Solo auf der Couch suggeriert? Im römisch besetzten Jerusalem sucht Rabenmutter Herodias Rache an ihrer Rivalin Salome, die niemand anderes ist als die Tochter, die sie nach ihrer Geburt weggegeben hat und die Herodes mit seiner Leidenschaft verfolgt. Während Salome, unter dem Zauber der Stimme des Propheten Johannes, diesem ihre reine und aufrichtige Liebe anbietet. Die er angesichts seiner göttlichen Mission ablehnen muss (und die ihm dennoch, wie Herodes, heiße Visionen bereiten). Dies ist die klassische Dynamik von Racines Andromaque, gewürzt mit einem Quentchen Inzests und mit einer verwirrten Salome, die sich selbst opfert, um Johannes in die Unsterblichkeit zu folgen.
 Zurück zum Konzert: Die Diktion der Solisten in Lyon war durch die weitgehend franco-kanadische Allianz der Mitwirkenden gesichert, denn Nicole Car als Salomé (Vehikel solcher Primadonnen wie Sanderson und Sutherland) – unbestritten als Star der Aufführung – ist Kanadierin und trug den Abend mit ihrer kompetenten, höhensicheren Deutung der Partie. Die Stimme ist merkwürdig kehlig im mittleren und tiefen Bereich bei einer stupenden Höhe, die jedoch eine ganz andere Farbe zeigt als der Rest der Stimme. Sie scheute sich nicht vor ein paar überraschenden Brusttönen und blieb für mich merkwürdig distanziert, kühl in ihrer Verehrung des Propheten. Dieser war bei Jean-François Borras in unruhiger Kehle, jung, zerquält, gut angelegt und erfreulich, mir zu wenig viril und heroisch, kein Rufer in der Wüste, sondern ein eleganter White-Colar-Vertreter seiner Kirche im schwarzen Sekten-Anzug. Als Hérode enttäuschte mich Etienne Dupuy mit recht locker werdendem und recht hellem Bariton eher nur mittlerer Größe, der Vorgänger wie Robert Massard nicht vergessen machte. Wie sein Tenorkollege war er mir zu glatt in der Aussage, zu „normal“ und zu wenig royal, wenngleich natürlich sein „Vision fugitive“ als Showpiece berechtigten und langanhaltenden Beifall nach sich zog. Als Phanuel zeigte sich der in operalounge.de kürzlich wegen seines herausragenden Robert le Diable so gelobte Nicholas Courjol bei schütterem Bass-Stimme-Zustand, namentlich in der Höhe – war´s eine Abendverfassung? Die beim Palazzetto geplante Aufnahme eben diesen events wird´s zeigen. Aber durchgehend stellte ich beim Hören im Saal eine doch störende, unangenehme Unruhe in den Stimmen fest, ein über ein gesundes Vibrato hinausgehendes, zu weites vokales Schwingen, sowohl bei der Sopranistin unter Druck wie vor allem beim Bariton und dem wirklich nicht sehr prophetisch klingen Tenor.
Zurück zum Konzert: Die Diktion der Solisten in Lyon war durch die weitgehend franco-kanadische Allianz der Mitwirkenden gesichert, denn Nicole Car als Salomé (Vehikel solcher Primadonnen wie Sanderson und Sutherland) – unbestritten als Star der Aufführung – ist Kanadierin und trug den Abend mit ihrer kompetenten, höhensicheren Deutung der Partie. Die Stimme ist merkwürdig kehlig im mittleren und tiefen Bereich bei einer stupenden Höhe, die jedoch eine ganz andere Farbe zeigt als der Rest der Stimme. Sie scheute sich nicht vor ein paar überraschenden Brusttönen und blieb für mich merkwürdig distanziert, kühl in ihrer Verehrung des Propheten. Dieser war bei Jean-François Borras in unruhiger Kehle, jung, zerquält, gut angelegt und erfreulich, mir zu wenig viril und heroisch, kein Rufer in der Wüste, sondern ein eleganter White-Colar-Vertreter seiner Kirche im schwarzen Sekten-Anzug. Als Hérode enttäuschte mich Etienne Dupuy mit recht locker werdendem und recht hellem Bariton eher nur mittlerer Größe, der Vorgänger wie Robert Massard nicht vergessen machte. Wie sein Tenorkollege war er mir zu glatt in der Aussage, zu „normal“ und zu wenig royal, wenngleich natürlich sein „Vision fugitive“ als Showpiece berechtigten und langanhaltenden Beifall nach sich zog. Als Phanuel zeigte sich der in operalounge.de kürzlich wegen seines herausragenden Robert le Diable so gelobte Nicholas Courjol bei schütterem Bass-Stimme-Zustand, namentlich in der Höhe – war´s eine Abendverfassung? Die beim Palazzetto geplante Aufnahme eben diesen events wird´s zeigen. Aber durchgehend stellte ich beim Hören im Saal eine doch störende, unangenehme Unruhe in den Stimmen fest, ein über ein gesundes Vibrato hinausgehendes, zu weites vokales Schwingen, sowohl bei der Sopranistin unter Druck wie vor allem beim Bariton und dem wirklich nicht sehr prophetisch klingen Tenor.
Die kleineren Rollen wurden von Mitgliedern des Lyoner Opernstudios gegeben (Pawel Trojak, Pete Thanapat, Robert Lewis, Giulia Scopelliti) und hinterließen beste Eindrücke.
Der dicke Schmutzfleck auf dem im ganzen ordentlichen Gemälde war die Leistung bzw. Wirkung der Titelvertreterin, Yekaterina Semyonchuk, die ihre Hérodiade mit der Schankwirtin im Boris Godunow verwechselte. Bereits als Didon in der Troyens an der Bastille fiel sie durch ihren qualligen, amorphen, brustigen und zutiefst unfranzösischen Ton auf, und ihre Aussprache kann nicht einmal beim Goetheinstitut in Perm gelernt worden sein. Ein Totalausfall, der an Vorgängerinnen wie Elena Obraztsova (als Massenets Charlotte zum Beisipiel) erinnert, brrrrr. Was für eine Wahl für dieses Konzert und die nachfolgende Aufnahme.
Dirigent und Chef des fabelhaften Klangkörper der Opéra National de Lyon ist Daniele Rustioni, ein junger Mann aus Italien. Mir war er zu flott, zu unsinnlich, zu fetzig, vielleicht zu „modern“ – und ein Vergleich mit seinem älteren Kollegen Michel Plasson (EMI) ließ dessen Klangbehandlung, dessen Üppigkeit der Streicher und der Holzbläser überzeugender scheinen (und wo Denyce Graces als Hérodiade ihre russische Kollegin mit Verachtung hätte strafen können, auch sprachlich). Auch die ältere Aufnahme des Pariser Radios von 1974 unter David Lloyd-Jones mit der wunderbaren Nadine Denize in der Titelpartie zeigt größeren Raum für bauchtanzschwingende Sinnlichkeit. Die neue Aufnahme beim Palazzetto wird es da schwerer haben, zumal als Triblette des Bekannten. Man fragt sich eh, warum nun eine neue, wenn die EMI-Einspielung unter Michel Plasson doch eine so solide ist. Die Götter in Venedig werden´s wissen. Herbert Schneider
.
In Gießen: Asolo, unweit des Grappa-Zentrums Bassano nel Grappa mit seiner eindrucksvollen Holzbrücke nach einem Entwurf Palladios, gehört zweifellos zu den schönsten Orten Italiens. Hier residierte die ehemalige Königin von Zypern zwanzig Jahre bis zu ihrem Tod 1510 mit ihrem Hofstaat. Rang und Tittel einer Königin durfte Caterina Cornaro behalten, umgeben von Dichtern, Gelehrten und Künstlern, wurde sie damit für den Verlust ihrer Macht entschädigt: ein kostbares Exil und Leben in goldenen Käfig unter Aufsicht der Republik Venedig, die sie als Spielball in ihrem Machtspiel um Zypern eingesetzt hatte.
Wer war diese aus dem alten venezianischen Patriziat der Corner, die sich mit Palästen am Canal Grande verewigten und als Dogen in die Geschichte Venedigs einschrieben, stammende Caterina, die Gentile Bellini und Tizian malten und die zum Gegenstand von fünf Opern wurde? Am Stadttheater Gießen, das Gaetano Donizettis letzte zu seinen Lebzeiten uraufgeführte Oper Caterina Cornaro erstmals auf eine deutsche Bühne brachte, betreibt Regisseurin Anna Drescher ein bisschen Volkshochschule und lässt vor der Introduzione eine Stimme aus dem Off locker über Caterina plaudern: Sie war eine gute Partie, da ihre Familie u.a. mit dem Handel von Zucker reich geworden war. Im Alter von 14 Jahren wurde sie in Venedig in dessen Abwesenheit mit Jakob II. von Lusignan, dem König von Zypern, verheiratet. Handelsinteressen und Sicherung des Thronanspruchs gingen eine vorteilhafte Verbindung ein. Erst 1472 segelte Caterina nach Zypern, wo sie abermals mit Jakob II. verheiratet wurde. Bald starb ihr Gatte, ebenso der Thronfolger. Caterina wurde Königin von Zypern, doch bald von der Republik zur Abdankung gezwungen. Das dann eingeblendete Porträt Bellinis zeigt keine schöne Frau.
Und damit springt die Aufführung endlich in die Oper, die dort beginnt, wo andere enden, nämlich mit den Hochzeitsvorbereitungen und Freudenchören. Doch noch bevor Caterina ihre Hand dem jungen Franzosen Gerardo reichen kann, wird Vater Andrea Cornaro vom Vorhaben der Republik unterrichtet: Gerardo werde ermordet, wenn Caterina nicht Lusignano ehelicht. Die bunte Feier mit Luftballons und ausgelassenen Partygästen hatte begonnen, eine junge Frau vollführte auf der Trampolin-Tafel unentwegt Luftsprünge, was ein bisschen vom Caterina-Gerardo-Duett „Tu l’amor mio, tu l’iride“ ablenkt, das überdeutlich an Norinas und Ernestos „Tornami a dir“-Duett angelehnt ist und daran erinnert, dass Donizetti seine im Herbst 1842 begonnene Arbeit an Caterina Cornaro unterbrach, um Don Pasquale zu schreiben; zudem arbeitete er noch für Wien an Maria de Rohan und Paris an Dom Sébastien.

Donizettis „Caterina Cornaro“ in Gießen/ Szene/ © Rolf K. Wegst
Die Stimmung kippt, als der wackere Tomi Wendt, der in der Basspartie des Cornaro nicht gut aufgehoben ist und schütter klingt, die Hochzeit abbläst, worauf eine heftige Tortenschlacht entsteht und er mit Küchenstücken beworfen wird. Als Sprachrohr der Republik, das durchaus eigene Interessen vertritt, ist der als schwarzer Drahtzieher mit Gothic Sidecut mephistophelisch böse durch die Szenen staksende und mit charaktervollem Bass jonglierende Kanadier Clarke Ruth als Mocenigo eine Wucht. Caterina willigt in die Ehe mit Lusignano ein und erklärt Gerardo, ihn nicht mehr zu lieben. Ende des in Venedig spielenden Prologs. Die folgenden beiden Akte spielen auf Zypern.
Nicht mal zwei Stunden braucht Donizetti für die im Januar 1844 in seiner Abwesenheit in Neapel uraufgeführte Oper, wo sie rund 130 Jahre später von Leyla Gencer wieder dem Vergessen entrissen wurde. Den Text schrieb ihm Giacomo Sacchèro, der, wie auch Lachner, Balfe und Pacini, dazu auf das Libretto von Jules-Henri Vernay de Saint-Georges für Halévys La reine de Chypre von 1841 zurückgriff. Alles geschieht bei Donizetti in größter Gedrängtheit, knapp und feurig, ohne größere Verzierungen im Gesang und in der Handlung; im Prolog lässt sich Caterina zwar noch von der Barkarole der Gondoliere verzaubern, aber ansonsten sind die Chöre von martialischer Wucht, sowohl die gedrungenen, blutbeschmierten Mörder der Serenissima („Core, e pugnale!“) wie die erschreckten Frauen im zweiten Akt („Oh ciel! Che tumulto! Che fieri lamenti!“), die damit auf das zur Verteidigung Lusignanos angestimmte und von „Guerra, guerra!“ und „Morte, Morte!“ durchsetzte Kriegsgeheul von Gerardo und seinen Soldaten reagieren. Die Arien sind relativ schmucklos, nicht ganz ohne Reiz – etwa Caterinas Cavatina und ihre Preghiera, Lusignanos Klage über die Kälte seiner Frau, in der Grga Peroš mit körnig ausladendem Edelmaß wie der ebenso frustrierte Luna klingt, oder Gerardos Cabaletta-Ruf zu den Waffen, der den Manrico vorwegzunehmen scheint, aber oft auch etwas blutleer und leidenschaftslos und wie aus der dramatischen Situation entrückt. Lusignano wehrt einen Angriff auf Gerardo ab. Beide erkennen sich als Landsleute und kommen sich, nachdem Gerardo gestanden hat, dass er sich am König für den Verlust Caterinas rächen will und Lusignano sich als ebenjener König zu erkennen gibt und über seine Ehe klagt, derart nahe, dass Drescher die Szene mit innigen Berührungen und einem Kuss enden lässt. Selbstlos und ungeachtet der Etikette lässt der König Gerardo mit Caterina allein. Keine alte Liebe brandet auf, stattdessen Entsagung, wie bei Elisabetta und Carlos.

Donizettis „Caterina Cornaro“ in Gießen/ Szene/ © Rolf K. Wegst
Nach dem Prolog baut Drescher auf starke Bilder (Tatjana Ivschina), die in ihrer Düsterheit durchaus suggestive Kraft besitzen, verbannt Caterina in eine Vitrine, von wo aus sie im historischen Gewand den Ereignissen zuschaut und selten zu Beteiligten wird. Erst am Ende, nachdem Lusignano tödlich getroffen ist und von Gerardo und Caterina Abschied genommen hat, reißt sie in ihrer Schlußcabaletta „Non più affanni“ („Schluss mit den Ängsten“) die Macht an sich. Hier entlockt die uruguayische Sopranistin Julia Araújo ihrem lyrisch verschatteten Sopran Farben und dramatische Akzente, die der von Donizetti nicht überstark gezeichneten Titelgestalt Profil verleihen. Offenbar immer noch von einer Erkältung gezeichnet, die ihn spätestens in der Begegnung mit seiner einstigen Geliebten einholt, zeigte Youngggi Moses Do als Gerardo dennoch mit flüssigem Ton und elegant verblendeter Höhe einen bemerkenswert schön timbrierten Tenor von bester Donizetti-Qualität. Gießens neuer Kapellmeister Vladimir Yaskorski machte die szenische deutsche Erstaufführung der Caterina Cornaro durch seine straffe und befeuernde Leitung der orchestralen Attacken zu einem musikalischen Genuss, mit dem Gießens neue Intendantin Simone Sterr zugleich Hoffnungen auf ähnliche (Belcanto)-Entdeckungen weckt, wie sie ihrer Vorgängerin Cathérine Miville u.a. mit Werken von Pacini, Arrieta, aber auch Gomes, Giordano und anderen so überzeugend gelungen waren. Rolf Fath
.







 Auch Verdi- und Puccinirollen haben Sie im Repertoire. Ist in dieser Richtung weiteres geplant?
Auch Verdi- und Puccinirollen haben Sie im Repertoire. Ist in dieser Richtung weiteres geplant?




 Rolf Fath:
Rolf Fath:






















 Dokumente/Verbreitung:
Dokumente/Verbreitung: Aber es gibt sie auch vollständig in der allerersten (mehr oder weniger) modernen Gesamtaufnahme bei der italienischen
Aber es gibt sie auch vollständig in der allerersten (mehr oder weniger) modernen Gesamtaufnahme bei der italienischen 

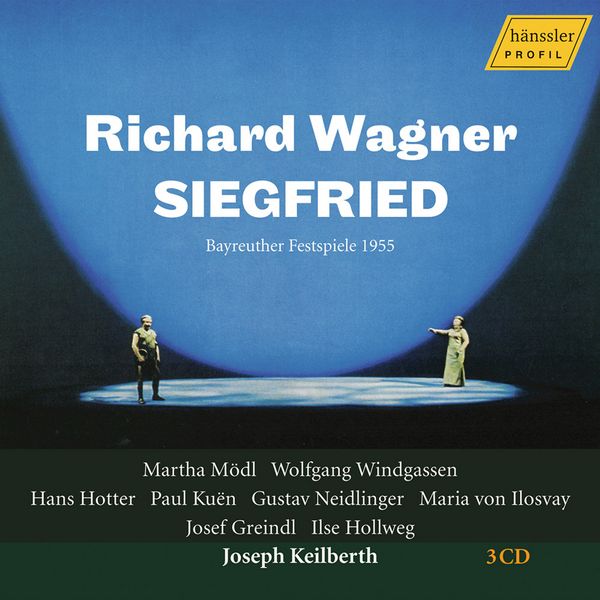



 Es sind die Solisten und die ungekürzte neue Fassung, die für mich das Gewicht dieser sensationellen neuen Aufnahme ausmachen.
Es sind die Solisten und die ungekürzte neue Fassung, die für mich das Gewicht dieser sensationellen neuen Aufnahme ausmachen. 




 Dennoch – ohne den alten und immer noch fabelhaften
Dennoch – ohne den alten und immer noch fabelhaften Erstaunlicher Weise hatte es vierzig Jahre gedauert, bis nach Rom und der CBS eine zweite (Fast)-Studio-Aufnahme von Meyerbeers Oper
Erstaunlicher Weise hatte es vierzig Jahre gedauert, bis nach Rom und der CBS eine zweite (Fast)-Studio-Aufnahme von Meyerbeers Oper 



 Ihr Engagement an der Deutschen Oper Berlin bestand bis 1995. 1965-88 trat sie regelmäßig an der Wiener Staatsoper (seit 1982 österreichische Kammersängerin) auf, wo sie 19 große Rollen zum Vortrag brachte, darunter die Ortrud im »Lohengrin«, die Herodias in »Salome« und die Amme in der »Frau ohne Schatten« von R. Strauss, die Fricka wie die Waltraute im Ring-Zyklus, die Kundry im »Parsifal«, die Preziosilla in Verdis »Macht des Schicksals«, die Azucena in »Trovatore«, die Amneris »Aida«, Carmen, Giulietta in »Hoffmanns Erzählungen« von Jacques Offenbach und die Küsterin in »Jenufa«. Sie gastierte an der Covent Garden Oper London (1969 als Amme in der »Frau ohne Schatten«, 1971 als Fricka, 1975-76 wieder als Amme), an der Oper von Lyon (1966 als Brangäne im »Tristan«, 1967 als Ortrud im »Lohengrin« und als Fricka), beim Holland Festival (1968 als Herodias in »Salome«, 1972 als Quickly im »Falstaff« von Verdi), am Teatro Colón Buenos Aires (1979 als Amme und Ortrud) und sang die Herodias 1975 in einer konzertanten »Salome«-Aufführung in der New Yorker Carnegie Hall. Weitere Gastspiele an der Königlichen Oper Stockholm, an den Opernhäusern von Marseille, Toulouse und Rio de Janeiro, am Théâtre de la Monnaie Brüssel, in Amsterdam, an der Oper von Rom (1971 als Fricka), in Turin, am Teatro Fenice Venedig (1971 als Jocasta in »Oedipus Rex« von Strawinsky), am Teatro alla Scala (9. Beethoven), in Mexico City (1970 als Fricka), Barcelona ( u.a. Klytaemnestra, Kundry, 1977 als Herodias), am Grand Théâtre Genf, am Bolshoi Theater (als Brangäne), in Washington (Herodias) und an der Chicago Opera. Beim Festival von Orange hörte man sie 1973 als Brangäne, 1974 als Herodias. In der Deutschen Oper Berlin hatte sie 1988 einen besonderen Erfolg als Klytämnestra in »Elektra« von R. Strauss. Die Berliner Kammersängerin war nicht zuletzt eine der bedeutendsten Konzert- und Oratorienaltistinnen innerhalb ihrer Generation in Deutschland, war aber auch im pädagogischen Bereich tätig. Prof. Ruth Hesse lebt mit ihrem Gatten, dem Regisseur und Ausstatter Prof. Siegwulf Turek seit Beendigung ihrer Karriere in Hallstatt (Österreich).
Ihr Engagement an der Deutschen Oper Berlin bestand bis 1995. 1965-88 trat sie regelmäßig an der Wiener Staatsoper (seit 1982 österreichische Kammersängerin) auf, wo sie 19 große Rollen zum Vortrag brachte, darunter die Ortrud im »Lohengrin«, die Herodias in »Salome« und die Amme in der »Frau ohne Schatten« von R. Strauss, die Fricka wie die Waltraute im Ring-Zyklus, die Kundry im »Parsifal«, die Preziosilla in Verdis »Macht des Schicksals«, die Azucena in »Trovatore«, die Amneris »Aida«, Carmen, Giulietta in »Hoffmanns Erzählungen« von Jacques Offenbach und die Küsterin in »Jenufa«. Sie gastierte an der Covent Garden Oper London (1969 als Amme in der »Frau ohne Schatten«, 1971 als Fricka, 1975-76 wieder als Amme), an der Oper von Lyon (1966 als Brangäne im »Tristan«, 1967 als Ortrud im »Lohengrin« und als Fricka), beim Holland Festival (1968 als Herodias in »Salome«, 1972 als Quickly im »Falstaff« von Verdi), am Teatro Colón Buenos Aires (1979 als Amme und Ortrud) und sang die Herodias 1975 in einer konzertanten »Salome«-Aufführung in der New Yorker Carnegie Hall. Weitere Gastspiele an der Königlichen Oper Stockholm, an den Opernhäusern von Marseille, Toulouse und Rio de Janeiro, am Théâtre de la Monnaie Brüssel, in Amsterdam, an der Oper von Rom (1971 als Fricka), in Turin, am Teatro Fenice Venedig (1971 als Jocasta in »Oedipus Rex« von Strawinsky), am Teatro alla Scala (9. Beethoven), in Mexico City (1970 als Fricka), Barcelona ( u.a. Klytaemnestra, Kundry, 1977 als Herodias), am Grand Théâtre Genf, am Bolshoi Theater (als Brangäne), in Washington (Herodias) und an der Chicago Opera. Beim Festival von Orange hörte man sie 1973 als Brangäne, 1974 als Herodias. In der Deutschen Oper Berlin hatte sie 1988 einen besonderen Erfolg als Klytämnestra in »Elektra« von R. Strauss. Die Berliner Kammersängerin war nicht zuletzt eine der bedeutendsten Konzert- und Oratorienaltistinnen innerhalb ihrer Generation in Deutschland, war aber auch im pädagogischen Bereich tätig. Prof. Ruth Hesse lebt mit ihrem Gatten, dem Regisseur und Ausstatter Prof. Siegwulf Turek seit Beendigung ihrer Karriere in Hallstatt (Österreich).