Bei der Verbreitung der Werke Gustav Mahlers haben die Berliner Philharmoniker von Anfang an eine entscheidende Rolle gespielt. Es begann mit der Aufführung von Liedern aus der Sammlung Des Knaben Wunderhorn mit Amalie Joachim unter Leitung von Raphael Maszkowski am 12. Dezember 1892. Am 4. März 1895 stellte Mahler in einem ansonsten von Richard Strauss dirigierten Konzert der Philharmoniker die drei Instrumentalsätze (1, 2, 3) seiner zweiten Symphonie vor. Am 13. Dezember 1895 leitete er die Uraufführung der vollständigen Zweiten. Seine Musik fand allerdings beim Publikum und bei großen Teilen der Kritik eine gemischte, eher negative Aufnahme. So sehr man Mahler als Dirigent bewunderte, so wenig hielt man von seinem Komponieren.
Arthur Nikisch, der zweite philharmonische Chefdirigent, setzte sich stark für Mahler ein. Wichtige Mahler-Interpreten von 1911 bis 1932 waren Oskar Fried, Bruno Walter, Klaus Pringsheim, Otto Klemperer und Jascha Horenstein. Einer wichtigsten Mahler-Dirigenten seiner Zeit, Willem Mengelberg, leitete am 17. Mai 1912 im Zirkus Schumann die Berliner Erstaufführung der Achten Symphonie. – Wilhelm Furtwängler, dritter künstlerischer Leiter der Berliner Philharmoniker, hatte kein genuines Interesse am Oeuvre Gustav Mahlers. Seine Dirigate der Ersten, Dritten und Vierten Symphonie hinterliessen keine große Wirkung. Allerdings gewann er große Anerkennung mit Dirigaten und Aufnahmen der „Lieder eines fahrenden Gesellen“ und der „Kindertotenlieder“.
 In den Jahren der NS-Diktatur war Mahlers Musik wie die aller jüdischen Komponisten verboten. Am 13. Oktober 1932 war zum letzten Mal eine seiner Kompositionen in einem philharmonischen Konzert zu hören. Erst 16 Jahre, am 2. Mai 1948, stand mit der Vierten Symphonie, dirigiert von Otto Klemperer, zum ersten Mal wieder ein Werk von Mahler auf dem Programm.
In den Jahren der NS-Diktatur war Mahlers Musik wie die aller jüdischen Komponisten verboten. Am 13. Oktober 1932 war zum letzten Mal eine seiner Kompositionen in einem philharmonischen Konzert zu hören. Erst 16 Jahre, am 2. Mai 1948, stand mit der Vierten Symphonie, dirigiert von Otto Klemperer, zum ersten Mal wieder ein Werk von Mahler auf dem Programm.
Die beiden ersten Chefdirigenten nach dem Krieg, Leo Borchardt und Sergiu Celibidache, spielten keine Rolle als Mahler Dirigenten. Überhaupt waren es nach 1945 eher Gastdirigenten, die sich Mahlers Musik annahmen – genannt seien Hans Rosbaud, Hermann Scherchen, Joseph Keilberth und die folgenden wichtigsten Mahler-Interpreten wie Rafael Kubelik, Georg Solti, Bernard Haitink und vor allem Sir John Barbirolli, der Brite italienischer Herkunft. Barbirolli, der selbst erst relativ spät zu Mahler fand, hat die Mahler-Tradition der Philharmoniker entscheidend geprägt. Er war es, der den Philharmonikern, unter denen es viele Mahler-Skeptiker gab, diese Musik nahebrachte. Er dirigierte in der Philharmonie fast alle Symphonien mit Ausnahme der Siebten und Achten. Seine Interpretation der Neunten Symphonie, veröffentlicht von EMI, gilt immer noch als exemplarisch. Fast alle Aufführungen wurden seinerzeit vom SFB mitgeschnitten und erschienen über die Jahre bei Testament Records. Mahlers Neunte dirigierte auch Leonard Bernstein bei seiner einzigen Begegnung 1979 mit den Berliner Philharmonikern.
Herbert von Karajan fand erst spät und nur begrenzt zu Mahler. Ihm lagen vor allem die Fünfte, Sechste und Neunte Symphonie sowie das „Lied von der Erde“. Karajan feilte, wie so oft, wieder und wieder an den Interpretationen. So entstanden exemplarischen Einspielungen der Fünften, Sechsten und vor allem der Neunten Symphonie. Mit seinem Nachfolger Claudio Abbado, kam ein Dirigent zu den Philharmonikern, dessen Karriere und Erfolg mit Mahlers Musik verbunden war. Abbado dirigierte in seinem Berliner Antrittskonzert kurz nach der Wahl zum Chefdirigenten eine aufregende und mittreissende Erste Symphonie. Mahler-Symphonien zählten zum festen Repertoire seiner Konzerte in Berlin und auf zahlreichen Reisen. Seine Aufnahme der Neunten Symphonie ist ein kongeniales Vermächtnis Abbados.

Kyril Petrenko dirigiert die Berliner Philharmoniker/ Buchbeilage zur Mahler-Edition
Simon Rattle, der im November 1987 mit Mahlers Sechster sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern hatte, brachte in seiner Amtszeit als Chefdirigent sämtliche Symphonien Mahlers zur Aufführung, dabei hat er immer wieder neu über die Interpretationen nachgedacht. – Kirill Petrenko, Rattles Nachfolger, ging schon vor seinem Amtsantritt der Ruf eines interessanten Mahler-Dirigenten voraus. Mit einer Aufführung der Dritten Symphonie hatte er bereits Aufsehen in München erregt. In Berlin dirigierte er (einstweilen) die Sechste Symphonie und (in Zeiten der Corona-Pandemie passend) die Vierte in einer Kammermusikfassung in der Philharmonie – mit großem Erfolg.
Die Mahler-Tradition der Berliner Philharmoniker ist lebendig und kann jeden Vergleich mit derjenigen der Wiener Philharmoniker oder des Concertgebouw Orchesters bestehen. Die Mahler-Edition legt Zeugnis von der Vertrautheit des Orchesters mit Mahlers Oeuvre ab. Gleichwohl ist sie eher eine Momentaufnahme denn ein großer, gar ultimativer Wurf. Wenn man nun nur die neueren, zwischen 2011 und 2020 entstandenen Interpretationen präsentiert, so ist zu fragen: Repräsentieren diese Aufnahmen den Stand der Mahler-Interpretationen der Berliner Philharmoniker? Da drängen sich immer wieder auch Vergleiche mit früheren Aufnahmen auf.

Claudio Abbado dirigiert die Berliner Philharmoniker/ Buchbeilage zur Mahler-Edition
Deutlich wird zunächst, dass es einige ernstzunehmende noch jüngere Mahler-Dirigenten gibt. Kirill Petrenko, Yannick Nézet-Seguin, Daniel Harding, Andris Nelsons und Gustavo Dudamel, zwischen 1972 und 1981 geboren, sind mit sechs Symphonien vertreten. Ihnen stehen der Mittsechziger Simon Rattle mit zwei Symphonien und die „Altmeister“ Bernard Haitink (Jahrgang 1929) und Claudio Abbado (1933-2014) mit jeweils einer Symphonie gegenüber.
Daniel Harding liefert eine insgesamt nur ordentliche Erste Symphonie ab. Im ersten Satz fehlt es an der geheimnisvollen Stimmung, an Naturlaut-Idylle, an Charme und überhaupt an Überraschungen. Seine Interpretation bleibt insgesamt nüchtern und unter- statt überzeichnend. Im Finale lässt Harding das Orchester nicht mit der von Mahler geforderten „großen Wildheit“ auftrumpfen, dem Scherzo fehlt das Wienerische, die „Lindenbaum“-Episode geht nicht ans Herz.
Andris Nelsons überrascht angenehm mit einer fast restlos überzeugenden, klar disponierten, immer spannenden Inszenierung der Zweiten Symphonie. Er lässt nicht seiner manchmal zu beobachtenden Neigung zum Überhitzen von großorchestralen Partituren freien Lauf, lässt viele Nuancen und Stimmungen herausarbeiten. Gemessen der Kopfsatz, mit sehr langsamen Schlußtakten; das Andante moderato fließend, das Scherzo nicht knallig, aber sehr markant; zart das „Urlicht“, der Schlußsatz mit seinen gewaltigen Steigerungen voller Spannung, Kontraste, ohne pathetisch zu enden. Und wie deutlich sind die Haupt- und Nebenstimmen zu hören, wie stark wirken Nelsons rubati!

Gustavo Dudamel dirigiert die Berliner Philharmoniker/ Buchbeilage zur Mahler-Edition
Gustavo Dudamel hat längst das Image des „Hitzkopfs“ überwunden. Seine Interpretation der Dritten Symphonie liess schon im Konzert aufhorchen; sie hat nichts an Wirkung verloren. Schon im gewaltigen Kopfsatz mit dem Nebeneinander von lyrischen und Marschcharakteren wird das ganze Panorama, ein eigener musikalischer Kosmos entfaltet. Das geschieht in einem einzigen großen Bogen, ohne nachlassende Spannung Die Philharmoniker musizieren vom „entschieden“ des Hauptthemas am Beginn bis zum ausschwingenden Schluss perfekt, brillant, klangsatt, subtil, kein Detail wird ausgelassen.
Mit der Fünften Symphonie hat Dudamel eine weniger glückliche Hand, hier erreicht er nicht die Tiefe, Intensität, klangliche Auslotung und Empfindung wie bei der Dritten. Die Inszenierung istvirtuos, spannend, führt die hervorragenden Musiker:innen des Orchesters im Ensemble und in Soli vor. Es gibt viele eindrucksvolle Stellen, die sich indes nicht zu einem kohärenten Ganzen fügen. Beispielhaft zu beobachten am zweiten Satz: Hier ist wenig vom Grimm, von der Zerrissenheit, von der Wehmut, die in dem Satz stecken, zu vernehmen (man höre nur einmal zum Vergleich John Barbirollis Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra oder die Berliner Philharmoniker mit den Dirigenten Jascha Horenstein, Herbert von Karajan, Claudio Abbado und Simon Rattle).
Yannick Nézet-Seguin rückt die Vierte Symphonie ins rechte Licht, gibt ihr den klassischen Charakter, den sie am stärksten unter den Mahlerschen Symphonien hat. Das Orchester spielt subtil, abwechslungsreich in Tempi und Dynamik, die Partitur wird sehr gründlich strukturell durchleuchtet; manche Passage hört man neu. Manchmal wirkt die Detailarbeit aber auch leicht maniriert. Im Finale allerdings ist man, auch mit dem nicht optimal besetzten Vokalsolo von Christiane Karg weit vom „behaglich“ der „himmlischen Freuden“ entfernt.

Gustav Mahler Foto: Sammlung Manskopf
Die neueste Aufnahme der Edition ist der Mahler-Einstand des neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko. Er tritt gegen markante Vorgänger – Barbirolli, Karajan, Abbado und Rattle an – auf seine Weise. Zunächst setzt Petrenko in der Sechsten Symphonie auf zügige Tempi, im Kopfsatz, im Scherzo, im Finale, sogar auch im Andante. Das wirkt drängend, manchmal aber auch hastig. Die große Spannung, der große Kontrast zwischen dem typischen Drängen und Innehalten, zwischen Überwältigung und Nachdenken und auch pianissimo und fortissimo fehlen dabei zum Teil noch. Manchmal scheint die Dynamik weniger subtil als in der Partitur notiert. Wie schon Abbado, Rattle und Barbirolli entschied sich Petrenko für die Satzfolge, bei der das Andante an zweiter und das Scherzo an dritter Stelle steht. Dafür gibt es gute Gründe, die teils von Mahler selbst, teils von den Mahler-Forschern und –Herausgebern angeführt werden. Dennoch kann (sollte?!) man dieser Reihung die „alte“ entgegensetzen. Bernard Haitink hat in einem Interview seinerzeit starke Argumente dafür ins Feld geführt: Das Scherzo solle unmittelbar auf den ersten Satz folgen: „Kurz vor dem Finale braucht man eine Pause. Wenn Sie das Scherzo dorthin setzen, werden sich diese beiden Sätze gegenseitig umbringen. Aber wenn Sie das Scherzo direkt nach dem Eröffnungssatz setzen, schaffen Sie einen Atem für das Finale.“ Zum Glück kann man sich zuhause die passende Reihenfolge mit wenigen Handgriffen einstellen.
S

Simon Rattle dirigiert die Berliner Philharmoniker/ Buchbeilage zur Mahler-Edition
imon Rattle hat über die Jahre an seiner Lesart der Siebten Symphonie gefeilt und im Konzert seinen (vorläufigen, endgültigen?) Stand dokumentiert. Die Interpretation überzeugt jedoch nur zum Teil. Sie hat eine gewisse Glätte, es wird zu wenig hinterfragt, es fehlt an Leidenschaft. Das Scherzo könnte abgründiger sein. Andererseits kommt die Zweite Nachtmusik dem Charakter des „amoroso“ sehr nahe. Das Finale ist teils furios, drängend, aber nie wie zu oft brutal oder vulgär.
Die Achte Symphonie führten die Berliner Philharmoniker in 45 Jahren immerhin fünf Mal auf: 1975 mit Seiji Ozawa, 1982 mit Moshe Atzmon, 1994 mit Claudio Abbado, 1999 mit Bernard Haitink und 2011 mit Simon Rattle. Der Mitschnitt des Konzertes 2011 zeigt eine große Annäherung an das Werk, das in seiner teils irrwitzigen Komplexität vermutlich gar nicht optimal aufführbar ist. Schwierig ist es dazu aufgrund seines Charakters als Zwitter zwischen Chorsymphonie und Oratorium und das Gegenüber von zwei nicht recht zusammen passenden Teilen – dem christlichen Pfingsthymnus „Veni creator spiritus“ und dem Schlußteil von Goethes „Faust“. Die enorme Leistung aller Beteiligten ist von einer exzellenten Aufnahmetechnik eingefangen worden. Rattle zügelt sein Temperament, er balanciert geschickt zwischen den schier überwältigenden klangrauschenden und den subtileren Passagen. Die vielen Feinheiten der Partitur werden nicht unterschlagen. Neben den glänzend disponierten Philharmonikern geben die solistischen und chorischen vokalen Kräfte ihr Bestes. Bei aller Anerkennung für diese Leistung bleibt freilich Skepsis. Mahlers Achte ist, wenn überhaupt, nur im Konzertsaal einigermaßen adäquat zu hören (und zu genießen). Sie überfordert jede häusliche Musikanlage.
Bernard Haitink zieht mit seiner Lesart der Neunten Symphonie die Summe seiner langjährigen Erfahrungen mit Mahlers Symphonik, eines langen Dirigentenlebens und natürlich der Zusammenarbeit und Vertrautheit mit dem Orchester. Man spürt, wie die Berliner Philharmoniker ihn auf sehr suggestive Weise unterstützen ihm viel zurückgeben. Es ist, aufs Ganze gesehen, ein „Abgesang“ der starken Art – ohne Ermatten oder Schwäche, hoch konzentriert, mit elegischen, vielleicht melancholischen, aber nie sentimentalen Zügen. Beim Hören dieser Aufnahme meint man noch die Ergriffenheit des Publikums im und nach dem Konzert zu spüren. Es war eine Sternstunde.

Bernard Haitink dirigiert die Berliner Philharmoniker/ Buchbeilage zur Mahler-Edition
Dass der große Mahler-Interpret Claudio Abbado hier ausgerechnet (nur) mit Mahlers Zehnter Symphonie d. h. mit deren Kopfsatz, Adagio, Berücksichtigung findet, mutet merkwürdig, ja befremdend an. Das Ergebnis ist allerdings eine Glanzleistung an Spannung, Versenkung, Intensität. – Die Präsentation der Symphonie Nr. 10 bleibt aus anderen Gründen halbherzig. Natürlich gibt es eine nicht enden wollende Diskussion darüber, wie fragmentarisch oder fertig diese Symphonie ist. Puristen wie Claudio Abbado, Pierre Boulez, Bernard Haitink stehen „Entdecker“ wie Simon Rattle, Riccardo Chailly, Berthold Goldschmidt und Kurt Sanderling stehen sich gegenüber. Revolutionär, und für manche direkt frevlerisch, war das Unternehmen des englischen Musikforschers Deryck Cooke, aus der von Mahler hinterlassenen Partitur, dem Particell oder den Skizzen einzelner Sätze eine „Aufführungsfassung“ zu erstellen. Wer sich über die Seriosität und Ernsthaftigkeit dieser Arbeit informieren will, der höre nur einmal Cookes „illustrated BBC talk“ aus dem Jahr 1960 sowie zwei von Berthold Goldschmidt dirigierte Aufführungen der Zehnten aus den Jahren 1960 und 1964 an (Testament, 3 CD, SBT3 1457)! Auch nach Cooke gab es weitere Versuche, diese fragmentarische Symphonie in eine Aufführungsform zu bringen: genannt seien nur die Fassungen von Clinton Carpenter, Remo Mazzetti oder Rudolf Barschai – allesamt diskussionswürdige und gewichtige Versionen. Wenn die Berliner Philharmoniker sämtliche Symphonien Mahlers im Jahre 2020 herausgeben, dann hätten sie neben dem Adagio doch die komplette Symphonie wenigstens „zur Diskussion stellen“ sollen. Immerhin plädierte ihr Ex-Chef Rattle immer wieder für die Zehnte, wobei er nicht bei einem einmal gefundenen Resultat stehen blieb. Selbst wenn Zweifel bleiben, ist die Cooke-Fassung allemal hörenswert.

Die Mahler-Edition der Berliner Philharmonikka/Buchbeilage
Zu fragen ist am Ende, warum in dieser glänzend aufgemachten Edition – Fertigung, Begleitbuch, Illustration sind wie immer von höchster Qualität, die Aufnahmtechnik ist größtenteils sehr gut – „Das Lied von Erde“ fehlt, immerhin doch ein symphonischer Liederzyklus, ein Werk zwischen Liedzyklus und Symphonie (Mahler-Edition der Berliner Philharmoniker, 10 CDs, 8 Dirigenten, 10 Jahre, hier klicken). Peter Heissler
P.S. Meine persönliche Bestenliste der Aufnahmen Mahlerscher Symphonien mit den Berliner Philharmonikern (Mitschnitte, die zum Teil später veröffentlicht wurden, und Studioproduktionen): Symphonie Nr. 1 – Claudio Abbado (1989, DG) Mariss Jansons (2007, RBB-Mitschnitt); Symphonie Nr. 2 – John Barbirolli (1965, Testament), Simon Rattle (2010, EMI);; Symphonie Nr. 3 – John Barbirolli (1969, Testament), Bernard Haitink (1990, Philips), Claudio Abbado (1999, DG);; Symphonie Nr. 4 – Simon Rattle (Sopransolo Christine Schäfer, 1998, RBB – Mitschnitt);; Symphonie Nr. 5 – Claudio Abbado (1993, DG);; Symphonie Nr. 6 – John Barbirolli (1966, Testament), Claudio Abbado (2004, DG), Simon Rattle (1987 und 2018, Berliner Philharmoniker Recordings);; Symphonie Nr. 7 – Claudio Abbado (2002, DG), Michael Gielen (1994, Testament);; Symphonie Nr. 8 – Claudio Abbado (1994, DG), Simon Rattle (2011, BPHR);; Symphonie Nr. 9 – John Barbirolli (1964, EMI), Claudio Abbado (1999, DG);; Symphonie Nr. 10 : Adagio – Claudio Abbado (2011), fünfsätzige Aufführungsfassung – Simon Rattle (1999, EMI). P. H.


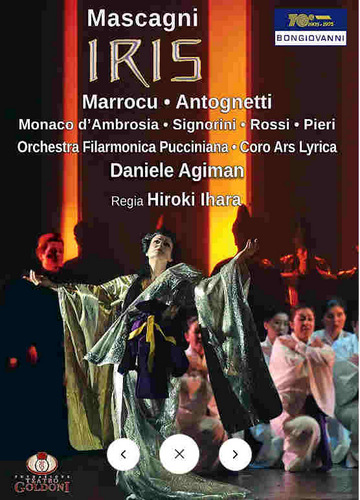

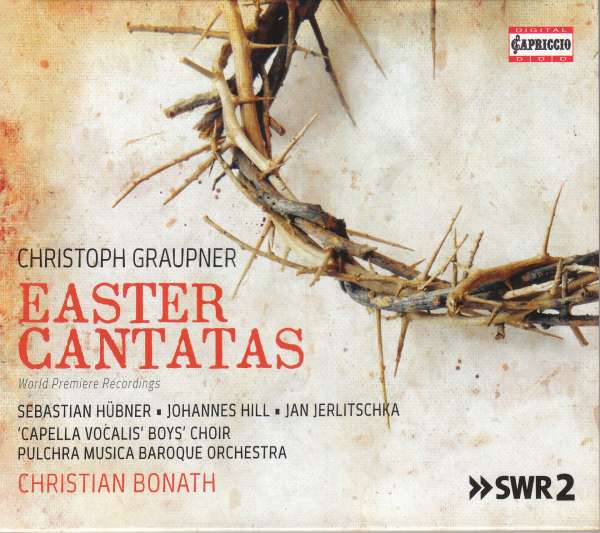

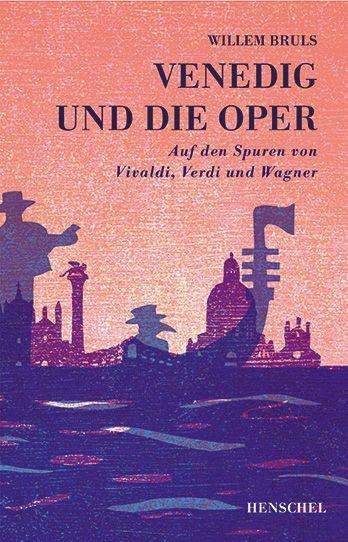
















 Das Erscheinen der CD Iris ein Jahr nach ihrer Aufführung im ausverkauften Konzerthaus Berlin könnte ein vorläufiger Höhepunkt in der zehnjährigen Geschichte der Berliner Operngruppe sein, ist es aber dennoch nicht, denn eigentlich wäre inzwischen bereits eine neue Ausgabe der alljährlich stattfindenden Aufführungen unbekannter italienischer Opern unter Ihrer Leitung fällig gewesen. Warum sie noch nicht zu erleben war, wissen wir nur allzu gut. Wie geht es der Berliner Operngruppe und ihrem Schöpfer und Dirigenten heute?
Das Erscheinen der CD Iris ein Jahr nach ihrer Aufführung im ausverkauften Konzerthaus Berlin könnte ein vorläufiger Höhepunkt in der zehnjährigen Geschichte der Berliner Operngruppe sein, ist es aber dennoch nicht, denn eigentlich wäre inzwischen bereits eine neue Ausgabe der alljährlich stattfindenden Aufführungen unbekannter italienischer Opern unter Ihrer Leitung fällig gewesen. Warum sie noch nicht zu erleben war, wissen wir nur allzu gut. Wie geht es der Berliner Operngruppe und ihrem Schöpfer und Dirigenten heute?








 In deutscher Übersetzung ist die Oper genau ein Jahr zuvor, beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg als
In deutscher Übersetzung ist die Oper genau ein Jahr zuvor, beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg als 







 In Bayreuth dirigierte Levine unter ganz überwiegenden Lobeshymnen zunächst den Parsifal (1982-1985, 1988-1993) und anschließend den Ring des Nibelungen (1994-1998). Nachdem er sich aus München zurückgezogen hatte, machte er sich rar in Europa. Seine nachlassende Gesundheit zwang ihn bereits von 2011 bis 2013 zu einer Zwangspause. Bald nach seiner kaum mehr für möglich gehaltenen und umso mehr gefeierten Rückkehr auf das Podium beendeten Ende 2017 öffentlich gemachte, freilich schon lange zuvor gerüchteweise kolportierte Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs männlicher Jugendlicher seine aktive Karriere; der ihm 2016 verliehene Ehrentitel des emeritierten Musikdirektors der Metropolitan Opera wurde ihm wieder entzogen. Eine außergerichtliche Einigung zwischen Levine und der Met, deren Details nicht bekannt wurden, kam 2019 zustande (die Rede war von einer Abfindung in Millionenhöhe). Tatsächlich scharte er schon zu seiner Zeit in Cleveland einen fast kultischen Kreis ihm höriger „Leviniten“ um sich. Bis zuletzt wollte der stark angeschlagene Levine weiter dirigieren und hatte auch tatsächlich einen Auftritt beim italienischen Maggio Musicale Fiorentino 2021 in Aussicht. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Wie die New York Times berichtet, ist James Levine bereits am
In Bayreuth dirigierte Levine unter ganz überwiegenden Lobeshymnen zunächst den Parsifal (1982-1985, 1988-1993) und anschließend den Ring des Nibelungen (1994-1998). Nachdem er sich aus München zurückgezogen hatte, machte er sich rar in Europa. Seine nachlassende Gesundheit zwang ihn bereits von 2011 bis 2013 zu einer Zwangspause. Bald nach seiner kaum mehr für möglich gehaltenen und umso mehr gefeierten Rückkehr auf das Podium beendeten Ende 2017 öffentlich gemachte, freilich schon lange zuvor gerüchteweise kolportierte Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs männlicher Jugendlicher seine aktive Karriere; der ihm 2016 verliehene Ehrentitel des emeritierten Musikdirektors der Metropolitan Opera wurde ihm wieder entzogen. Eine außergerichtliche Einigung zwischen Levine und der Met, deren Details nicht bekannt wurden, kam 2019 zustande (die Rede war von einer Abfindung in Millionenhöhe). Tatsächlich scharte er schon zu seiner Zeit in Cleveland einen fast kultischen Kreis ihm höriger „Leviniten“ um sich. Bis zuletzt wollte der stark angeschlagene Levine weiter dirigieren und hatte auch tatsächlich einen Auftritt beim italienischen Maggio Musicale Fiorentino 2021 in Aussicht. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Wie die New York Times berichtet, ist James Levine bereits am