.
Mehr als der Titel seiner Oper Der Trompeter von Säckingen und vielleicht noch daraus der früher im Radio-Wunschkonzert gespielte Dauerbrenner „Behüt´ dich Gott, es wär so schön gewesen“ ist vom Werk des Komponisten Victor Nessler nichts übrig geblieben. Dabei war gerade diese Oper bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts ungemein erfolgreich. Im letzten sorgten noch Sänger wie Hermann Prey oder Wolfgang Anheisser für den Fortbestand zumindest dieses Stückes. Aber wie Opern des jüngere Kollegen Lortzing oder Brüll, Flotow und andere mehr werden diese deutschen Stoffe nicht mehr als zeitgemäß erachtet (oder werden in Ignoranz dafür gehalten). Und vielleicht ist das angesichts der Bedenkenlosigkeit heutiger Regisseure auch gut so, dass sie diese außerordentlich an ihre Zeit und deren Geschmack, Bildung (!) und Tradition gebundenen Stoffe nicht in die Finger bekommen. Man mag sich nicht ausmalen, wie heutige Aufführungen davon aussehen würden.

Der Komponist Victor E. Nessler/ Wikipedia
Aber schade ist´s, die schöne Musik, diese eben typisch deutschen Melodien nicht mehr hören zu können. Nur wir Älteren können das ermessen. Und so ist es uns ein Anliegen, diese Lücke zumindest in unserem online-Rahmen mit einem Opernführer zum Rattenfänger von Hameln von Victor Nessler etwas zu scließen.
Dem Regisseur Ingolf Huhn habe ich ja schon dicke Kränze geflochten. Als Fan des heutigen Operndirektors in Annaberg reiste ich nach der Wende zu dessen damaligen Produktionen an den kleineren Bühnen Ost-Deutschlands, denn Huhn war und ist für mich der Champion für die Deutsche romantische Oper. Lortzings Weihnachtsabend, Der Pole und sein Kind, Rolands Knappen und Andreas Hofer, Dorns Nibelungen, Goldmarks Götz von Berlichingen, Gasts Löwe von Vendig und viele andere vergessene Werke des vorletzten Jahrhunderts erblickten durch ihn erneutes Leben, immer im Rahmen und der Möglichkeiten der kleinen Theater wie Döbeln, Freiberg, Plauen oder zuletzt eben Annaberg. Und so beruht der nachstehende Artikel über Nesslers noch viel unbekannterer Oper Der Rattenfänger von Hameln auf den Vorstellungen an den Theatern Freiberg und Döbeln 2004 und auf dem Programmheft vom Dramaturgen Christoph Nieder.
.
.

Oskar Herfurth/ Der Rattenfänger von Hameln/ OBA
Am 19. März 1879 wurde im Leipziger Stadttheater eine Oper uraufgeführt, die in den nächsten Jahrzehnten ihren Weg durch Europa machte: Der Rattenfänger von Hameln von Victor E. Nessler. Grundlage der „Großen romantischen Oper“ war natürlich die berühmte Sage, die Geschichte vom Rattenfänger, der im Auftrag der Hamelner Bürger das Ungeziefer vertreibt und dann, als ihm der versprochene Lohn vorenthalten wird, mit den Kindern der Stadt davonzieht. Damit die operntypischen Liebesgeschichten nicht fehlen, ist der Titelheld, wie schon in der Goethe-Ballade vom Rattenfänger, auch ein „Mädchenfänger“, der dem Damenchor ebenso den Kopf verdreht wie der Fischer- und der Bürgermeistertochter.
Der Rattenfänger war nicht die erste, wohl aber die bis dahin erfolgreichste Oper Nesslers, die in Leipzig auf die Bühne kam. Wie sehr damals in Leipzig das Musikleben blühte, zeigt schon die Tatsache, dass mindestens vier einschlägige Zeitschriften nebeneinander existierten: Die „Allgemeine musikalische Zeitschrift“, die von Robert Schumann gegründete „Neue Zeitschrift für Musik“, die „Signale für die musikalische Welt“ und das „Musikalische Wochenblatt“ informierten wöchentlich oder monatlich Leipzig und die „musikalische Welt“ über Aufführungen klassischer Werke, vor allem aber auch über Novitäten, über Ur- und Erstaufführungen, die ganz anders als heute das Musikleben bestimmten.
So hatte sich der elsässische Komponist Victor E. Nessler 1864 nicht etwa nach Paris, sondern nach Leipzig gewandt, um seine musikalische Karriere voranzubringen; und auch den Librettisten Friedrich Hofmann, der aus Thüringen stammte, zog es 1858 in die „geistige Metropole Sachsens“.
Die „Signale für die musikalische Welt“ begannen ihre Besprechung der Rattenfänger-Uraufführung mit leiser Ironie: „Die beiden Verfasser der Oper haben ihren Wohnsitz – wie zuvörderst bemerkt sein soll – in Leipzig: der Librettist als Mitarbeiter der „Gartenlaube“, der Componist als Chordirektor am Stadttheater. Beide Männer sind auch in weiteren Kreisen nicht unbekannt: Herr Hofmann besonders durch seine gemütvollen poetischen und prosaischen Beiträge in dem genannten Weltblatt, Herr Nessler durch seine Bestrebungen auf dem Gebiete der Männergesang-Composition.“

Oskar Herfurth/ Der Rattenfänger von Hameln/ OBA
Zu diesem Zeitpunkt allerdings war Nessler nicht mehr Chordirektor, sondern bereits als Kapellmeister ans Carola-Theater gewechselt; sein Nachfolger wurde der später weltberühmte Dirigent Arthur Nikisch. Direktor des Stadttheaters war damals Angelo Neumann, der gerade mit der Aufführung von Wagners Ring, mit der er dann auch auf Europa-Tournee ging, Aufsehen erregt hatte. Neumann erkannte schnell die Qualitäten Nikischs und machte ihn zum Kapellmeister; in dieser Funktion dirigierte er die Uraufführung des Rattenfänger wie 1884 auch die des Trompeter von Säckingen, ehe er seine Karriere in den USA und Budapest fortsetzte, um schließlich als Gewandhauskapellmeister nach Leipzig zurückzukehren.
.
.
Drei Deutsch-Nationale: Victor E. Nessler, 1841 im Elsass geboren, stammte aus einem protestantischen Pfarrhaus. Er studierte zunächst Theologie, der Erfolg seines Erstlings Fleurette in Straßburg ließ ihn jedoch zum Komponisten werden – die Quellen widersprechen sich, ob er wegen des „Fehltritts“ exmatrikuliert wurde oder aber freiwillig von der Theologie zur Musik wechselte. Nessler ging nach Leipzig und sammelte vielfältige musikalische Erfahrungen, komponierte Gelegenheitswerke und leitete Männerchöre. 1870 wurde er Chordirektor am Stadttheater, später Kapellmeister am Carola-Theater. Einige frühere Opern wie Dornröschens Brautfahrt (1867) oder Irmingard (1876), mit denen sich der junge Komponist ausprobiert hatte, waren über Leipzig nicht hin-ausgekommen; der Rattenfänger aber wurde ein Riesenerfolg, nachgespielt nicht nur an den Hofopern in Berlin, Stuttgart oder München und vielen anderen deutschen Bühnen, sondern auch in London. Danach konnte er sich zur Ruhe setzen, versuchte 1881 mit dem gleichen „Team“ – Librettist Friedrich Hofmann bearbeitete eine Vorlage von Julius Wolff: Der wilde Jäger – vergeblich an den Erfolg anzuknüpfen, bis 1884 Der Trompeter von Säckingen so einschlug, dass auch der Rattenfänger langsam in Vergessenheit geriet. Nessler kehrte wieder in das inzwischen deutsch gewordene Straßburg zurück, wo er bereits 1890 starb.
.

Der Librettist Friedrich Hofmann/ Wiki
Der Librettist Friedrich Hofmann wurde am 18. April 1813, im selben Jahr wie Giuseppe Verdi und Richard Wagner, Georg Büchner und Friedrich Hebbel, in Coburg geboren. Seine Mutter war als junges Mädchen Dienstmagd bei Jean Paul gewesen; sein Vater, während der napoleonischen Kriege 1813 bis 1815 Feldtrompeter, wurde später Hofmusikus. Als Gymnasiast dichtete Hofmann „Freiheitslieder“ für den „Vaterlandsverein“ und wurde daraufhin für alle Zukunft vom Staats-dienst ausgeschlossen. In Jena studierte er Literatur und Geschichte; erste Veröffentlichungen beschäftigten sich mit der Geschichte seiner Coburger Heimat, und 1841 zog er als Mitarbeiter von Meyers „Großem Konversationslexikon“ nach Hildburghausen. 1854 erhielt er für seine Verdienste um die Volksbildung die Doktorwürde der Universität Jena und ging bald darauf als Hauslehrer eines Verwandten der Coburger Fürsten nach Venedig. Nach Hildburghausen zurückgekehrt, wurde er zum Begründer der Coburger Mundartdichtung, ehe es ihn 1858 nach Leipzig, in die geistige Metropole Sachsens, zog. Nachdem er an verschiedenen Zeitschriften mitgearbeitet hatte, wurde er 1861 Redakteur der „Gartenlaube“. 1871 war er in deren Auftrag einer der ersten Deutschen, die das belagerte Paris besuchten. Nach dem Krieg war er mit Kriegs- und Vaterlandsgedichten erfolgreich, baute aber auch einen Suchdienst für Vermisste und Verschollene auf und setzte damit sein soziales Engagement fort, das in den 40er Jahren mit dem „Weihnachtsbaum für arme Kinder“ – der Erlös seiner Gedichte finanzierte Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder – begonnen hatte. 1883 wurde er Chefredakteur der Gartenlaube, und im Januar 1888 ernannte ihn die Gabelbachgemeinde auf dem Kickelhahn bei Ilmenau zum „Gemeindepoeten“ – als Nachfolger des verstorbenen Joseph Victor von Scheffel, dessen Trompeter von Säckingen Julius Wolff wesentlich beeinflusst hatte und der zur Vorlage der zweiten Erfolgsoper Nesslers wurde. Während eines Urlaubs in Ilmenau starb Hofmann im August desselben Jahres.
.

Der Gelegenheitsdichter Friedrich Wolf/ OBA
Die Vorlage: Julius Wolff, 1830 in Quedlinburg geboren, übernahm zunächst die elterliche Textilfabrik. Nach deren Bankrott wurde er Journalist. 1870/71 zog er in den Krieg und arbeitete anschließend als Angestellter in Berlin. Ersten Schriftstellerruhm erntete er mit einer Kriegsliedersammlung „Aus dem Felde“. In der Tradition von Scheffels ungemein populärem Trompeter von Säckingen erschien 1876 Der Rattenfänger von Hameln – eine „Aventiure“, ein Erfolg, der Wolff finanziell unabhängig machte und ihm auch die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hameln eintrug. In den nächsten Jahren verfasste er epische Dichtungen wie Tannhäuser. Ein Minnesang oder Der fliegende Holländer. Seemannssage. Er wurde zu einem Protagonisten der „Butzenscheibenromantik“ und erfüllte den Wunsch des wilhelminischen Publikums nach einem nostalgischen Rückblick in die „gute alte Zeit“. Noch nach seinem Tod 1910 erschien eine knapp zwanzigbändige Gesamtausgabe seiner Werke.
.
.
Die Komposition: Nesslers Musik im Rattenfänger von Hameln umfasst eine weite Spanne. Sie ist harmonisch und in der Verarbeitung durchaus auf der Höhe ihrer Zeit und reicht vom leichten Singspieltonfall (2. Bild) über das sentimentale Strophenlied bis zur großen Verfluchungs-Szene, vom Buffo-Terzett (Beginn 3. Akt) bis zum sechsstimmigen, kanonartig aufgebauten Ensemble (Finale des 1. Aktes: „Nun reiche mir die Hand“), vom schlichten Volkschor bis zum komponierten Chaos im Streit der Ratsherren gleich zu Beginn. Immer ist die Musik dramatisch, theater-praktisch gedacht, immer im Dienst der Szene. Nessler verwendet einige prägnante Motive, die in der Oper häufig wiederkehren, aber nicht als Wagnersches Leitmotiv, sondern eher als Erinnerungsmotiv, z. B. ein sich um sich selbst windendes, schleichendes chromatisches Motiv als Symbol für die Ratten, das gleich zu Beginn der Ouvertüre eingeführt wird, oder eine marschartige Melodie für die Rats- und Bürgermeister-welt. Auffällig sind die zahlreichen Zitate in Nesslers Musik. Mal handelt es sich um ein Detail der Instrumentation, wenn z. B. die Solobratsche das Duett zwischen Regina und Dorothea im zweiten Bild maßgeblich begleitet, ist das Vorbild klar: die zweite Ännchen-Arie aus dem Freischütz.

Nesslers „Rattenfänger von Hameln“ in Döbeln/ Szene/ MTDF
Manchmal sind es Motivfetzen (Wotans Speermotiv in der Gerichtsszene des 5. Aktes, das „Auf Wiedersehen“ aus dem ersten Quintett der Zauberflöte), manchmal auch reizt die Parallelität der Situationen Neßler zum Zitat: Wenn im 4. Akt der steinerne Roland zu sprechen beginnt, erklingt umgehend eine kurze Phrase Leporellos aus dem Finale des Don Giovanni, der Nachtwächter scheint direkt den Meistersingern entsprungen zu sein, und ob bei der Wahl des „tragischen“ c-Moll Beethovens für den Streit der Ratsherren ein Schuss Ironie im Spiel ist, sei dem Zuhörer anheimgestellt… Die Häufigkeit und Auffälligkeit der Zitate lassen jedenfalls eher auf eine Hommage an die Vorbilder schließen denn auf billiges „Klauen“. Besonders kunstvoll arbeitet Neßler im großen Duett zwischen Gertrud und Hunold zum Schluss des zweiten Aktes. Jeder Figur ist ein Soloinstrument zur Seite gestellt, Gertrud die Bratsche und Hunold das Violoncello, die die Melodielinien mitspielen. Nach Hunolds „Dich zu erringen“ in A-Dur zweifelt Gertrud „Lieber Zaubrer, sag mirs ehrlich, bist du wahr und wirklich mein“ harmonisch weit entfernt in F-Dur, stößt dann aber bei „du bist mein, ich bin die deine“ mit E-Dur über Hunolds Harmonie hinaus. In einem Zwischenspiel verschlingen sich die Melodielinien der Soloinstrumente symbolisch für die Figuren auf der Bühne. Nach einem längeren zweistimmigen Teil schließen die Sänger in hymnischer Ein-stimmigkeit in A-Dur – beide sind vereint, musikalisch wie szenisch, und Gertrud ist in Hunolds Welt angekommen.

Das Mittelsächsische Theater in Döbeln/ Wikipedia
Neuland betritt Nessler im Mittelteil der Ouvertüre, wo er ein Melodram einführt, das die Ouvertüre gleich zu einem Teil der Handlung werden lässt. Erst sehr viel später sollten Leoncavallo und Mascagni auf ähnliche (dann aber gesungene) Modelle bei I Pagliacci und bei Cavalleria rusticana zurückgreifen. Der Trauermarsch des 5. Aktes weist schon voraus bis zu Gustav Mahler, manche Finesse der Harmonie im Lied „Wenn dem Wächter das Horn einfriert“ zu Beginn des 3. Aktes zu Hugo Wolf. Und auch vor kräftigen Dissonanzen scheut Neßler in der Ouvertüre nicht zurück, um gleich zu Beginn klarzustellen, dass dieser Rattenfänger von Hameln weit mehr bietet als brave Butzenscheibenromantik. Martin Bargel
.
.
Verbreitung und Dokumente: Kaum eine Note Nesslers ist – außer einem dürftigen Querschnitt des Trompeter von Säckingen mit Hermann Prey bei Electrola und einer diskutablen Gesamtaufnahme des WDR (leider ohne Dialoge) als Nachklang der Aufführungen beim Festlichen Herbst Bad Urach bei Capriccio (noch bei jpc erhältlich) – auf Tonträger dokumentiert. Historische Einzelaufnahmen der eingangs erwähnten Arie finden sich von Prey, Tauber, Schlusnus, Melchior, Muench, vom Montanara Chor und in Blasorchesterfassung.
Dabei ist der Trompeter nicht etwa sein eigentlicher Erfolg gewesen, sondern eben der Rattenfänger. Aber die Aufführungen des damals scheidenden Intendanten des Mittelsächsischen Theaters, Ingolf Huhn, in den Theatern von Freiberg und Döbeln im Frühjahr 2004, wurden leider nicht beim MDR aufgezeichnet. Das Mittelsächsische Theater gastierte mit dem Werk bei den Musikfestspielen Dresden im Sommer 2004 und nahm es in der neuen Saison noch einmal auf, wo auch Lortzings Oper Rolands Knappen ebendort dort im Mai 2005 zur Aufführung kam.
.
.

Das Mittelsächsische Theater in Freiberg/ Wikipedia
Der Rattenfänger von Hameln, Große romantische Oper in fünf Akten von Victor E. Nessler; Libretto von Friedrich Hofmann nach dem Gedicht von Julius Wolff UA: 19. März 1879 Leipzig (1. Aufführung in moderner Zeit 2004 am Mittelsächsischen Theater Freiberg-Döbeln).
Inhalt: Die deutsche Sage tritt auf und spricht einen Prolog. Erster Akt: Rathaussaal Streit im Hamelner Stadtrat: Die Stadtkasse ist leer, die Bürger klagen über die hohen Steuern. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass es ein noch größeres Problem gebe: die Rattenplage. Aber er hat auch schon eine Lösung parat: Ein fremder Spielmann, Hunold Singuf, hat sich angeboten, die Stadt von Ratten und Mäusen zu befreien. Dafür fordert er 100 Mark und eine später zu benennende zusätzliche „Spende“. Trotz der hohen Forderungen nimmt der Stadtrat schließlich das Angebot des Rattenfängers an. Hausgarten des Bürgermeisters Regina, die Tochter des Bürgermeisters, erwartet ihren Bräutigam Heribert, den Sohn des Stadtschultheißen. Als der von einem Studienaufenthalt Heimgekehrte erscheint, sind alle zufrieden – außer dem Stadtschreiber Ethelerus, der sich selbst vergeblich um Regina bemüht hatte.
Zweiter Akt: Im Wirtshaus zum „Braunen Hirsch“. Hunold unterhält die Gäste mit seinen Liedern; insbesondere die Frauen sind von ihm fasziniert. Ethelerus lädt ihn zu einem abendlichen Treffen im Weinkeller gemeinsam mit seinem Freund, dem Kanonikus Rhynperg, ein. Da erscheint Gertrud; Hunold und sie erkennen im jeweils anderen den lange Erträumten. Die übrigen Gäste sind verwundert; Wulf, der Schmied, Gertruds Verlobter, schwört Rache. Beim Fischerhaus am Strom Gertrud und Hunold haben ein Stelldichein; Wulf versucht vergeblich, Gertrud zurückzugewinnen.

Oskar Herfurth/ Der Rattenfänger von Hameln/ OBA
Dritter Akt: Vor dem Ratskeller. Der Schreiber und der Kanonikus wetten mit dem Rattenfänger, dass auch er, der sich seines Erfolgs bei Frauen rühmt, Regina keinen Kuss abgewinnen könne.
An der Weser: Wulf beklagt sich bei seinen Nachbarn über Gertruds Untreue. Des Nachts lockt der Rattenfänger Ratten und Mäuse in die Weser; Wulf lauert Hunold auf, wird aber von diesem besiegt. Vierter Akt Offene Ratshalle Die Frauen sind glücklich darüber, dass die Ratten fort sind. Von Wulf aufgestachelt, wollen die Bürger dem Rattenfänger dennoch den versprochenen Lohn nicht zahlen. Regina, Dorothea und Heribert bezeugen, dass im Keller des Bürgermeisters noch ein „Rattenkönig“, fünf zusammengewachsene Ratten, die nicht fortlaufen konnten, geblieben, der Vertrag also nicht erfüllt sei. Hunold klagt nun Wulff an, der entgegen den Bedingungen nachts auf der Straße geblieben sei: Deshalb habe der Zauber nicht vollständig funktioniert. Außerdem fordert er nun die zusätzlich zum Geld vereinbarte Spende – einen Kuss der Bürgermeistertochter. Die Frauen finden diese Zusatzforderung apart, die Männer sind empört. Hunold will mit seinem Zauber auch Regina berücken. Die Roland-Statue auf dem Markt warnt ihn: „Recht verbürg‘ ich! Missethat würg‘ ich!“
Vierter Akt: Der Rathhaussaal als Festsaal. Die Verlobung von Heribert und Regina wird gefeiert. Regina wird unruhig, als Hunold erscheint, und fällt ihm um den Hals, nachdem er ihr ein Lied gesungen hat. Hunold wird des bösen Zaubers angeklagt.

Der Autor: Der Musiker, Dirigent, Pianist und Komponist Martin Bargel/ LIN
Fünfter Akt. Vor der Stadt Hameln. Gertrud beklagt den Verrat Hunolds an ihr. Die Richter verurteilen Hunold zum Tode. Gertrud beruft sich auf ein altes Gesetz, demzufolge das Leben eines Verurteilten einer Jungfrau geschenkt werden kann, die dann mit ihm fortziehen muss. So befreit sie Hunold, stürzt sich dann aber verzweifelt in die Weser. Vor der Kirche: An der Brücke. Aus der Kirche, wo die Hochzeit Heriberts und Reginas gefeiert wird, tönt der Gesang der Bürger. Hunold tritt auf, lockt mit Schalmeienspiel und Gesang die Kinder der Stadt herbei und führt sie über die Brücke davon. Seine Rache schreit er in die Kirche hinein; die herauseilenden Bürger müssen mit ansehen, wie die Brücke einstürzt und ihre Kinder im Berg verschwinden.
.
.
Die vorliegenden Texte übernahmen wir – mit leichten Modifikationen – dem informativen Programmheft zur Aufführung in Freiberg-Döbeln 2004, wobei wir dem dortigen Dramaturgen Christoph Nieder sehr zu Dank verpflichtet sind. Der Autor Martin Bargel war damals Dirigent am Mittelsächsischen Theater, während er in dieser Zeit und auch danach immer wieder in spannenden musikalischen Projekten in Erscheinung trat, auch mit Eigenkompositionen. Redaktion und ergänzende Texte G. H.
.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie hier.







 Eine wuchtige Wirkung entfaltete das Bühnenbild.
Eine wuchtige Wirkung entfaltete das Bühnenbild.  All diese technischen Belange treten allerdings sogleich in den Hintergrund, sobald man den Einstieg wagt. Mit dem Vorabend, also dem
All diese technischen Belange treten allerdings sogleich in den Hintergrund, sobald man den Einstieg wagt. Mit dem Vorabend, also dem  Mit der
Mit der 

 Mit dem Original also, wie es auf der CD mit dem Bassisten
Mit dem Original also, wie es auf der CD mit dem Bassisten 












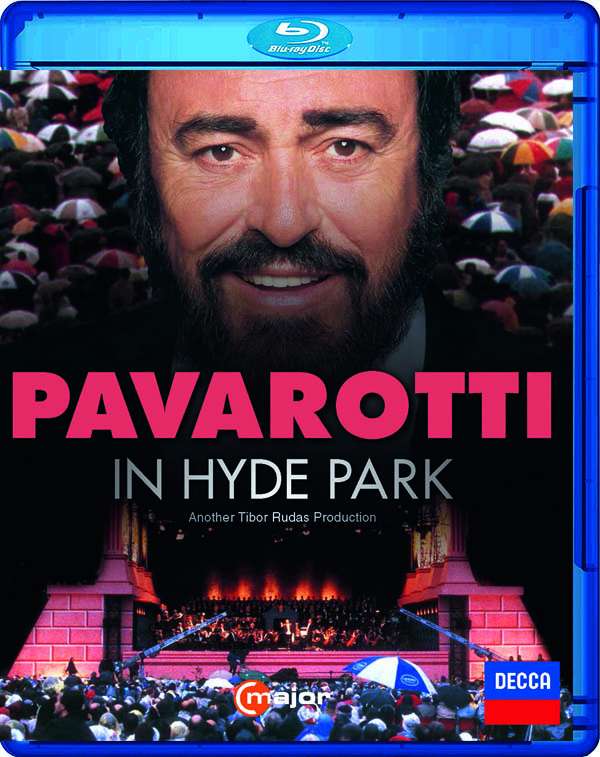

 Bei Capella Records handelt es sich im Übrigen um das Eigenlabel der 1991 von
Bei Capella Records handelt es sich im Übrigen um das Eigenlabel der 1991 von 




