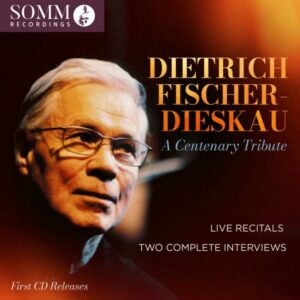.
Dietrich Fischer-Dieskau und kein Ende. Selbst nach dem Gedenken an seinen 100. Geburtstag im Mai dieses Jahres kommen Aufnahmen auf den Markt, die es zuvor auf Tonträgern nicht gab. A Centenary Tribute nennt denn SOMM Records ein Album mit Live-Produktionen vornehmlich aus London (Ariadne 5038-2). Vertonte Gedichte Goethes von Anna Amalia, der Herzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach, Johann Friedrich Reichardt, Carl Friedrich Zelter, Richard Strauss, Max Reger und Ferruccio Busoni gelangten vom Helsinki Festival 1971 auf die Neuerscheinung. Busoni spielt im Wirken des Sängers eine wichtige Rolle. Die Titelrolle seiner Oper Doktor Faust hatte er schon in den fünfziger Jahren in Berlin auf der Bühne gestaltet und auch bei der Deutschen Grammophon eingespielt. Im neuen Album ist er zudem mit vier weiteren Busoni-Liedern aus der Londoner Festival Hall von 1962 mit Gerald Moore am Klavier vertreten. Sie liegen dem Sänger vorzüglich, weil er darin seine Neigung zur Deklamation wirkungsvoll ausleben kann. Begleitet von Karl Engel folgt eine Gustav-Mahler-Gruppe aus der Royal Festival Hall von 1970 mit drei Gesängen aus der Jugendzeit und ebenfalls drei Titeln aus den Rücker-Liedern: „Ich atmet’ einen linden Duft“, „Blicke mir nicht in die Augen“ und „Um Mitternacht“.
Seinem Höhepunkt strebt das Liedangebot mit dem immer noch selten anzutreffenden Zoltán Kodály zu, der bei dem Konzert mit dem London Symphony Orchestra am 3. Juni 1960 wiederum in der Royal Festival Hall selbst am Pult steht. Bei A közelitö tél (Der nahende Winter) und Sirni, sirni, sirni (Schrei, Schrei, Schrei) handelt es sich um Vertonungen von „Gedichten, die sich mit dem Tod befassen, im ersten indirekt und im zweiten direkt“, vermerkt der Musikjournalist Jon Tolansky im Booklet, wo alle Texte in der Originalsprache mit englischer Übersetzungen abgedruckt sind. Der erste Titel nach Versen von Daniel Berzsenyi, einem Vorreiter der ungarischen Romantik, setzt den Herbstanfang und den kommenden Winter metaphorisch mit dem Verlust von Leben gleich, während Sirni, sirni, sirni auf ein Gedicht von Endre Ady Verzweiflung hervorrufe, indem sich ein Sarg bei einer Mitternachtsbeerdigung nähere. Kádár Kata sei durch Kodalys Transkription des gleichnamigen siebenbürgischen Liedes während seiner zweiten Sammeltour von Volksmusik dieser Region entstanden. Später habe er es zunächst für Gesang und Klavier und dann für Gesang und Orchester arrangiert. Es sei ein stimmungsvolles Stück voller Melancholie, dem Thema Heimatlosigkeit angemessen. „Fischer-Dieskau, der hier in ungarischer Sprache singt, bringt die ganze Bandbreite seiner Stimmfarben … zur Geltung, um die eindringliche Atmosphäre dieser bemerkenswerten Werke zu erzeugen“, so Tolansky. Das erste und das dritte Werk geraten mit fast elf beziehungsweise gut fünfzehn Minuten formal in die Nähe von Zyklen. Fischer-Dieskau ist sehr gut in Form und erfasst das Wesen dieser impressionistisch gehaltenen Musik ganz genau. Er überwindet die Fremdsprachigkeit indem er die musikalischen Stimmungen und Vorgänge genau vermittelt. Auch wer des Ungarischen nicht mächtig ist, wird so in die Lage versetzt, dem Geschehen zumindest emotional zu folgen.
Das Album wird vervollständigt durch zwei Interviews, die Fischer Dieskau gelegentlich seines 75. und seines 80. Geburtstages gab. Gesprächspartner ist der Boooklet-Autor Jon Tolansky, der auch als Produzent in Erscheinung trat und zahlreiche namhaften Sänger und Dirigenten begegnet ist. Er kennt die Szene genau und stellt seine Fragen mit Sachverstand. Die Themen sind allerdings nicht ganz neu für jemanden, der sich in der Biografie des Sängers auskennt. Fischer-Dieskau bemüht sich um kritische Distanz, erzählt von seinen ersten musikalischen Eindrücken im Elternhaus, wo er besonderes Gefallen an Schallplatten mit Lohengrin-Musik fand. Mit Schuberts Winterreise, die ihn sein langes Künstlerleben lang beschäftigte, sei er sehr frühzeitig in Berührung gekommen durch einen Liedervortrag von Emmi Leisner. Man werde nie wirklich zum Kern dieser Liederzyklus vordringen. Aber er versuche es, sich anzunähern über vierundzwanzig Stationen des Leidens und der Leidenschaft. Der Inhalt sei im Wesentlichen derselbe, wird aber auf sehr, sehr, sehr unterschiedliche Weise behandelt. Angesprochen auf sein professionelles Bühnendebüt als Posa in Verdis deutsch gesungenem Don Carlos 1948 räumt Fischer-Dieskau ein, dass es sich um eine für einen Anfänger fast unmögliche Partie handele. Zuerst habe er sehr gezögert, sich dann aber doch darauf eingelassen. Mit der Veröffentlichung des Mitschnitts aus der Städtischen Oper Berlins unter der Leitung von Ferenc Fricsay sei er überhaupt nicht einverstanden. Doch es spiele keine Rolle. Den Dirigenten Wilhelm Furtwängler nennt der Sänger einen väterlichen Freund. Als er ihm vorschlug, Mahler zu singen, war er zunächst schockiert, weil er Mahler sein Leben lang nicht mochte. Aber dann tat er es. Die Lieder eines fahrenden Gesellen von 1952 mit Furtwängler und dem Philharmonia Orchestra haben seither Kultstatus in Sammlerkreisen. Solcherart sind die Themen und Anmerkungen von Dietrich-Fischer Dieskau den Interwies. R.W.