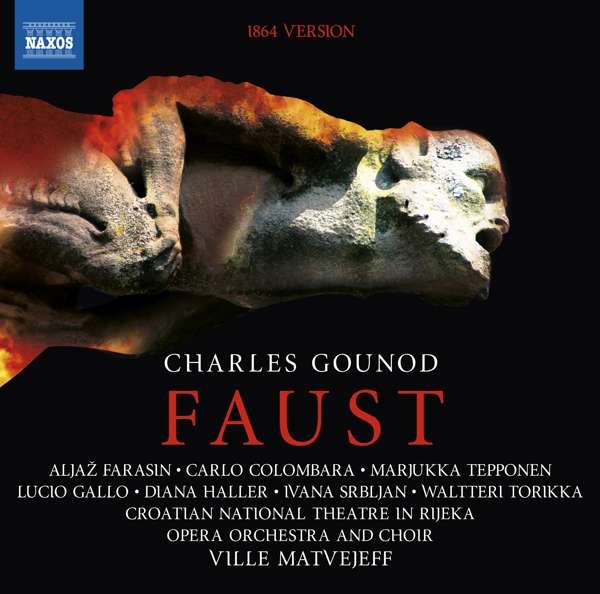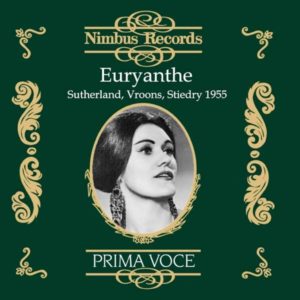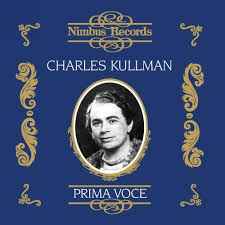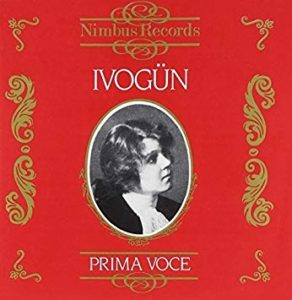.
Nach Erstaufführungen im amerikanischen Albuquerque 2015 und Wilmington/Delaware 2016 (operalounge.de berichtete über beide) präsentierte Bregenz bei seinen Festspielen 2016 Franco Faccios vergessene Oper Amleto von 1865 – eine der spannendsten Opern-Wiederentdeckungen der letzten Jahre (in Europa). Dazu gab uns Antonio Barrese, eminenter Dirigent und Musikwissenschaftler, vor allem aber Wiederentdecker und Restaurator der Partitur des Amleto anlässlich seiner Bühnen-Produktionen der Oper in Albuquerque und Delaware ein ausführliches Interview zum Werk und den aufregenden Umständen der Ausgrabung in den Archiven des Musikverlages Ricordi, das wir hier aus gegebenem Anlass wiederholen. Von der Aufführung in Albuquerque gibt es inzwischen eine DVD und CD, aus Delaware zumindest einen Radiomitschnitt – Bregenz hatte also mitnichten die erste Wiederentdeckung des Amleto in moderner Zeit, wie von der Intendantin noch im Radio-Interview gerne behauptet wurde (wo auch Entdecker Barese kleingeredet wurde). Allerdings sind die amerikanischen Dokumente aus Copyright-Gründen der Universal/Ricordi nur in den USA und nicht ins Ausland lieferbar… Die Aufführung in Bregenz wurde am 20. Juli 2016 in Ö1 Radio und ORF3 TV live übertragen und liegt nun auf DVD bei C-Major/ Unitel/ Bregenzer Festspiele sowie als CD-Ausgabe bei Naxos (8.660454-55, 2 CD) vor, eine Besprechung von Matthias Käther findet sich am Schluss.. G. H.
.
.

Franco Faccio/OBA
Amleto von Faccio – zur Einführung: Ein fünfundzwanzigjähriger Komponist, dem bisher nur eine Vorstellung vergönnt war, und ein dreiundzwanzigjähriger Librettist bei der ersten bedeutenden Erfahrung mit einer Oper: der Musik und den Worten dieser beiden jungen Burschen, die die Kunstwelt von Kopf bis Fuß erneuern wollten, galt der Beifall des Genueser Publikums des Teatro Carlo Fenice.am 30. Mai 1865. Seitdem sind knapp 150 Jahre vergangen seit der Premiere von Amleto, eine tragedia irica in vier Akten, an die Franco Faccio, der Komponist, und Arrigo Boito, der Librettist, viele Erwartungen und Hoffnungen geknüpft hatten. Es handelte sich um ein wahres und tatsächliches Manifest der Scapliatura (= Liederlichkeit, literarische Protest-Bewegung in Mailand), aber die Aufnahme war einige Jahre danach eine ganz andere, als die Scala dieselben Noten ohne Wenn und Aber auspfiff.
Es lohnt sich, die Geschichte dieser Oper sich noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, um die Gründe für den Misserfolg von 1871 zu verstehen, obwohl sie ohne Zweifel innovativ und originell war. Die Geschichte des Amleto von Faccio und Boito ist alles in allem eine kurze. Leider sind die Quellen nicht so zahlreich, wie man es erwarten könnte: Zum Beispiel weiß man von der Zeit vor der Komposition lediglich, dass die beiden jungen Leute voller Pläne und Initiativen waren, nachdem sie das Konservatorium von Mailand verlassen hatten. Warum ausgerechnet eine der bedeutendsten Tragödien Shakespeares? Es scheint so, als habe Boito begonnen, an dem Libretto noch vor I Fiamminghi zu arbeiten, das dann am 2. Juli 1862 in Polen vollendet wurde. Viel zahlreicher sind die Zeugnisse von diesem unseligen Genueser Premierenabend des Jahres 1865. Zur Besetzung gehörten bedeutende Sänger wie Mario Tiberini als Hamlet, Angiolina Ortolani-Tiberini als Ofelia, Elena Corani und Antonio Cotogni als Königin und König. Die Tatsache, dass das Teatro Carlo Felice zwei fast Unbekannte akzeptiert hatte, ist auf das persönliche Eingreifen von Alberto Mazzuccato zurück zu führen, der am Konservatorium Lehrer Boitos gewesen war und Freund des Dirigenten Angelo Mariani, ebenfalls für dieses Debüt ausgewählt.
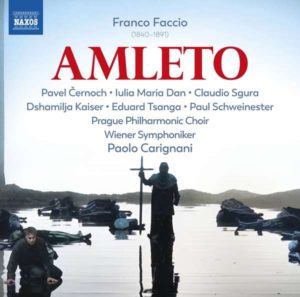 Die Zeitschrift Movimento schrieb damals: „Gestern Abend öffneten sich die Pforten des Carlo Felice für die angekündigte Aufführung der neuen Partitur von Franco Faccio, den Amleto. Groß waren die allgemeinen Erwartungen, da Zweifel laut geworden waren in Bezug auf das neue Genre, an dem sich der junge Maestro versucht hatte. Das Publikum kam in Massen und in der Haltung, dessen, der zu einem wohl bedachten Urteil, sagen wir es offen, mit Strenge bereit war. Aber die Bereitschaft zum Zweifel flaute schnell ab, und nach genauer Prüfung fiel die Entscheidung; man applaudierte und das ganz spontan, aus Überzeugung und mit Enthusiasmus. Ebenso las an es in der Gazzetta di Genova: „Der Oper wurde allgemein nach dem ersten Akt Beifall gespendet, nach dem Duett Ofelia und Amleto, am Ende des zweiten Akts, nach der Canzone der Ofelia im dritten Akt und nach dem Tauermarsch im vierten Akt. Der junge Maestro wurde mehrmals auf die Bühne gerufen.“
Die Zeitschrift Movimento schrieb damals: „Gestern Abend öffneten sich die Pforten des Carlo Felice für die angekündigte Aufführung der neuen Partitur von Franco Faccio, den Amleto. Groß waren die allgemeinen Erwartungen, da Zweifel laut geworden waren in Bezug auf das neue Genre, an dem sich der junge Maestro versucht hatte. Das Publikum kam in Massen und in der Haltung, dessen, der zu einem wohl bedachten Urteil, sagen wir es offen, mit Strenge bereit war. Aber die Bereitschaft zum Zweifel flaute schnell ab, und nach genauer Prüfung fiel die Entscheidung; man applaudierte und das ganz spontan, aus Überzeugung und mit Enthusiasmus. Ebenso las an es in der Gazzetta di Genova: „Der Oper wurde allgemein nach dem ersten Akt Beifall gespendet, nach dem Duett Ofelia und Amleto, am Ende des zweiten Akts, nach der Canzone der Ofelia im dritten Akt und nach dem Tauermarsch im vierten Akt. Der junge Maestro wurde mehrmals auf die Bühne gerufen.“

Ingrid Wanja übersetzt tapfer und unverzagt aus dem Italienischen für uns – Danke Ingrid!
Das eindeutige Talent von Faccio wurde also anerkannt. Nicht derselben Meinung war Giuseppe Verdi, nach dessen Auffassung niemand etwas hatte verstehen können bei all dem „Krach“. Die sechs Jahre, die zwischen Genua und Mailand verstrichen, waren voller Abenteuer und Erfahrungen, vor allem die Teilnahme am Dritten Unabhängigkeitskrieg im Jahre 1866, der beide (Faccio und Boito) betraf, um nicht vom Fiasko des Mefistofele zu sprechen, des es 1868 an der Scala gab. Die Kunst der „Liederlichkeit“ bedurfte also einer schönen Auffrischung, so sehr, dass man 1870 von einer möglichen Wiederaufführung des Amleto in Florenz sprach. Man entschied sich jedoch für Mailand, die Scala und die Saison 1870/71. Tiberini wurde wieder engagiert für dieselbe Rolle, aber auch der Rest der Besetzung war vorzüglich, mit Virginia Pozzi-Branzanti als Ofelia und dem Dirigenten Eugenio Terziani als Dirigenten. Leider erkrankte Tiberini, und das Debüt an der Scala wurde um zwei Wochen verschoben. Aber das reichte nicht. Der Tenor aus den Marken war vollkommen ohne Stimme und desorientiert. Sein Auftritt war ein komplettes Unglück, viele Noten brachte er überhaupt nicht heraus. Faccio zeigte sich ruhig und gelassen, aber in Wirklichkeit hatte sich Nervosität seiner bemächtigt. Es gab zwar einigen Applaus, aber alles in allem sprach man sofort von einem Fiasko. Es ist wirklich schade, dass man Amleto nicht mehr zu Faccios Lebzeiten aufgeführt hat (er starb fünfzigjährig im Jahre 1891, nachdem er in Irrsinn verfallen war). Eigentlich handelte es sich, wie der Verleger Tito Riccordi bemerkte, um einen Amleto aufgeführt ohne Hamlet, vielleicht war es auch Schicksal, dass man diese Tragödie so schnell vergaß. Aber die große Leidenschaft, die Antonio Smareglia, einer der wichtigsten Schüler von Faccio, für die Partitur hegte, ist doch zu erwähnen, für eine Musik und eine Bearbeitung des Stoffes, die in dieser Epoche für zu ehrgeizig und wenig respektvoll gegenüber Shakespeare gehalten wurden. Aber man kann auch von einem wertvollen und konkreten Zeugnis sprechen, das die „Liederlichkeit“ im 19. Jahrhundert zu schaffen versuchte. (Übersetzung Ingrid Wanja)
.
.

Anthony Barrese: Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler/AB
Und nun Fragen an Antony Barrese zu Faccios Amleto: Zunächst einmal die übliche Frage: Was hat Sie zu dieser Oper und zu dem Komponisten geführt? Ich selbst bin und war immer fasziniert von diesen compositori minori im überwältigenden Schatten von Verdi – wie Apolloni oder natürlich Gomes, Montèro, Carrer.Wie sind Sie also auf diesen Komponisten aufmerksam geworden?Hamlet ist mein Lieblingsstück von Shakespeare, und das schon seit meinen frühen Teenagerjahren. Als ich anfing, die Welt der Oper zu erforschen, war ich schockiert, als ich feststellte, dass es keine glaubwürdige (meiner Meinung nach) Opernbearbeitung des Themas gab. Und dann hörte ich, dass Boito ein Hamlet-Libretto geschrieben hatte, und dass es nicht nur sein erstes Shakespeare-Libretto war, sondern sein erstes Libretto überhaupt. Ich kam also wegen des Librettos zur Oper und entdeckte dann später die Musik, aber alles wegen meiner Liebe zu Shakespeares Hamlet.
Verdi ist der Eckpfeiler dieser Periode – was unterscheidet Faccio von Verdi? Wie individuell ist seine Musik im Vergleich zu Verdi? Hat er Rossini gekannt (sicher auch G. Tell und all das, wie Verdi)? Wie sehr ist er Donizetti und den Belcanto-Komponisten verpflichtet? Ich höre mir gerade Ihre Musikbeispiele von Amleto auf Ihrer Website an – seine große Arie und Szene – Hamlet als Tenor scheint so seltsam nach Thomas und all dem. Es macht ihn sicher jünger, vielleicht weniger gewichtig und traditioneller?

„Amleto“: Antonio Cotogni als Il Re der Uraufführung/AB
Faccios Musik ähnelt in vielerlei Hinsicht der von Verdi, aber in dem Maße, in dem er einzigartig ist, ist er definitiv mehr auf die orchestralen Farben bedacht. So gibt es zum Beispiel im Vorspiel des 3. Akts vor Ofelias Wahnsinnsszene wunderbare Stellen mit hohen Streichern und Flageoletts (ganz ähnlich wie zu Beginn von Lohengrin). Außerdem verwendet er sehr subtile Techniken wie Beckenschläge ppp, ein Effekt, den man vor dem Verismo nicht oft sieht. Zweifellos kannte Faccio Rossinis und Donizettis Musik. Während Spuren von Rossini nur schwer zu finden sind, wird Donizettis Präsenz in der Wahnsinnsszene von Ofelia deutlich, in der sie von einem Flötenobligato begleitet wird (Anklänge an Lucia di Lammermoor).
Hamlet mit einem Tenor zu besetzen, erscheint mir in der italienischen Tradition sinnvoller, vor allem im mittleren und späten Verdi, wo der Held ein Tenor ist und das Böse eine tiefere, dunklere Stimme hat. In der Tat sind alle Stimmtypen perfekt besetzt. Ofelia ist ein lyrischer Sopran, Geltrude liegt irgendwo zwischen einem Sopran und einem Mezzosopran, was ihr eine dunklere, eher matronenhafte Qualität verleiht. Und der Geist ist ein Basso profundo, was seiner Figur mehr dramatisches und musikalisches Gewicht verleiht.

„Amleto“: Signora Tiberini war die erste Ofelia/DeRenzis/AB
Außerdem entspricht Hamlets Gesangslinie viel mehr den späteren Verismo-Komponisten. Es ist keine besonders hohe Rolle (B ist die höchste Note, die er hat), und es gibt einen Mangel an gehaltenen hohen Noten. Das soll nicht heißen, dass die Gesangslinie nicht ausdrucksstark ist, denn das ist sie, und zwar an sehr wichtigen Stellen. Aber Faccio achtet darauf, die Gesangslinie im Zaum zu halten und sie nur in Momenten höchster musikalischer und dramatischer Bedeutung explodieren zu lassen.
Gibt es Informationen über die Oper „Amleto“? Wurde sie oft aufgeführt? Wann und warum wurde sie nicht mehr gespielt? Amleto wurde 1865 im Teatro Carlo Felice in Genua uraufgeführt. Allem Anschein nach war es ein Erfolg, sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern. Bald nach der Premiere schlossen sich Boito und Faccio Garibaldis Armee an und kämpften für die italienische Einigung. Ihre Reisen brachten sie in engeren Kontakt mit der Musik Beethovens und Wagners (Wagner war in Italien zu dieser Zeit nur durch seine Schriften oder Klavierauszüge bekannt). Die erste Wagner-Oper, die in Italien erklang, Lohengrin, wurde erst 1871 aufgeführt). Dies trug zu den zahlreichen Überarbeitungen bei, die Faccio vornahm. Nach der katastrophalen Premiere von Boitos Mefistofele (La Scala 1868) wussten Faccio und seine Kollegen, dass sie einen Erfolg brauchten, und so wurde für 1871 eine weitere Aufführung von Amleto an der Scala geplant.

„Amleto“: Virginia Pozzi-Branzanti, Ofelia in Mailand/Fondo Antonio Cervi
Die Vorbereitungen verliefen reibungslos, bis in der letzten Woche der Sänger des Amleto (Tiberini) erkrankte und die Premiere um einige Wochen verschoben werden musste. Tiberini erholte sich, doch kurz vor der Premiere erkrankte er erneut. Die Theaterkommission der Scala befand Tiberini für gesund genug, um zu singen, und er machte weiter. Was dann geschah, war eine Katastrophe. Tiberini, immer noch sehr krank, konnte die Rolle nicht singen. Er markierte die Gesangslinie, transponierte Teile davon eine Oktave nach unten und hörte in anderen Abschnitten einfach ganz auf zu singen. Wie Giulio Ricordi sagte: „Hamlet wurde ohne Hamlet aufgeführt“. Es war ein desaströser Abend, und Faccio ließ das Stück nie wieder aufführen. Tatsächlich wurde es seit jenem Abend an der Scala, dem 12. Februar 1871, nicht mehr aufgeführt.
Der einzige Grund dafür, dass es seither nicht mehr aufgeführt wurde, ist, dass außer dem autographen Manuskript des Komponisten kein Material vorhanden war. Entgegen der üblichen Praxis wurde von Ricordi nie ein vollständiger Klavierauszug des Werks angefertigt. Als ich also auf das Material stieß, musste ich es buchstäblich Note für Note aus dem autographen Manuskript der Gesamtpartitur abschreiben. Nachdem ich die Partitur transkribiert hatte, machte ich mich daran, einen Klavierauszug zu erstellen, so dass ich sofort hören konnte, wie die Musik klang.
.Ich denke, der einfachste Grund, warum das Werk seit 1871 nicht mehr aufgeführt wurde, ist, dass 1) Faccio es nie wieder spielen ließ und 2) es nach seinem Tod kein Material (Klavierauszug, Kopien der Gesamtpartitur, Orchesterstimmen usw.) gab, außer dem autographen Manuskript des Komponisten, das nicht für Aufführungszwecke bestimmt ist.
.

„Amleto“: Das Ehepaar Tiberini sang die Uraufführung in Genua/Ipernity
Einige Bemerkungen zur Oper. Struktur, Anordnung der Stimmen und Figuren, musikalische Anmerkungen. Sie sind selbst Komponist (und haben italienische Wurzeln): Worin liegt für Sie der Reiz? Die Struktur des Werks lehnt sich sehr stark an Shakespeare an, ebenso wie die Figuren. Viele Nebenfiguren werden weggelassen (Osric, Rosencrantz und Guildenstern usw.), aber viele der kleinen Figuren werden beibehalten (Spielerkönig und -königin, Lucianus, Totengräber usw.). Wie ich bereits sagte, sind die Stimmen sehr typisch für die italienische Oper des 19. Der Held (oder Anti-Held) Amleto wird von einem Tenor gesungen. Die süße, unschuldige Ofelia – ein Sopran. Die ältere und weise Geltrude wird von einem reicheren, dunkleren Sopran gesungen (im Libretto ein „Mezzosopran“). Der böse König Claudio, ein hoher Verdi-Bariton, und der Spettro, ein Basso rofundo. Auch die kleineren Rollen machen Sinn: sowohl der Totengräber als auch Polonio werden von komischen Bässen gesungen, Hamlets Freunde Orazio und Marcello von Comprimario-Bässen und Laertes von einem Comprimario-Tenor.
.
Einige Bemerkungen zu Faccio? Seine Stellung in Verdis Leben, als Dirigent von Aida und so weiter. Gibt es ein gutes Buch über ihn? Es ist schwierig, Informationen zu finden. Es gibt zwei Bücher über Faccio, beide von Raffaello de Rensis, eines heißt Franco Faccio e Verdi, das andere heißt L’Amleto di Franco Faccio. Beide Bücher enthalten einen Großteil des gleichen Materials. In seiner Jugend war Faccio zusammen mit Boito eine wichtige Figur in der Scapigliatura-Bewegung junger Komponisten, Schriftsteller, Künstler usw., die die italienische Kunst radikalisieren und aus ihren traditionellen Fesseln befreien wollten.

„Amleto“: Marco Tiberini war der Uraufführungssänger/DeRensis/Ipernity
Es gibt nur sehr wenige Werke der Scapigliatura-Kunst, die Einfluss hatten. Vieles davon waren Polemiken und Manifeste. Tatsächlich wurde Amleto als der beste Versuch eines solchen Beispiels angesehen, vor allem nachdem Boitos Mefistofele bei seiner Uraufführung ein solcher Reinfall war. Trotz ihrer antagonistischen Haltung gegenüber Verdi wurden sowohl Faccio als auch Boito später offensichtlich zu großen Bewunderern und Verfechtern von Verdis Musik. Im selben Jahr, in dem Amleto an der Scala ein Desaster war, leitete Faccio die italienische Erstaufführung von Aida an der Scala. Anschließend dirigierte er die Uraufführung von Otello (neben vielen anderen wichtigen italienischen Werken) und wurde sozusagen der erste Musikdirektor der Scala, der maestro scaligero.
.
1871 ist ein spätes Datum für italienische Komponisten im konventionellen Stil, die Veristen stehen an der Schwelle – ich höre in der Musik viel vom zeitgenössischen Idiom von Gomes (Fosca nämlich): War das so oder wie sehr unterscheiden sich diese Komponisten voneinander? Verdi hat eine andere Richtung eingeschlagen, denke ich – aber das führt zu Catalani und Mascagni, oder? Ich denke, es gibt definitiv Nuancen des Verismo in der Musik. Besonders in der Musik von Amleto. Zwischen der Uraufführung 1865 und der Inszenierung an der Scala 1871 gab es viele Änderungen. Am auffälligsten ist dies bei der Arie „Sein oder Nichtsein“ von Amleto, die in der ursprünglichen Fassung viel deklamatorischer war. Wie ein ausgedehntes Rezitativ. Tatsächlich lautete die Kritik an der ursprünglichen Fassung, dass es „zu wenig Melodie“ und „zu viel Rezitativ“ gebe. Eine Kritik, die sich Faccio bei der Überarbeitung zu Herzen nahm. Aber selbst bei einer größeren Überarbeitung, wie der Wahnsinnsszene von Ofelia, behielt er die deklamatorische Qualität in der Vokalmusik bei, erweiterte aber die melodische Gestaltung im Orchester.
Er war ein brillanter Orchestrator und nutzte das Orchester eindeutig, um eine Stimmung zu erzeugen. Zum Beispiel hören wir im 1. Akt, Szene 2 auf dem Schloss von Elsinore, bevor wir Hamlet, Horatio und Marcellus sehen, 4 Solocelli (Schatten von Guillaume Tell und Vorboten des Liebesduetts im 1. Akt von Otello und des Abschnitts im 3. Faccio setzt das Orchester auch sehr wirkungsvoll in der Marcia Funebre im 4. Akt ein, die dem Drama zwischen der Komödie der Totengräber und der Konfrontation zwischen Laertes und Hamlet etwas Luft zum Atmen gibt. Es ist ein faszinierendes Stück, das für sich allein stehen kann, aber auch im Kontext des Dramas funktioniert.
.

„Amleto“: Der junge Franco Faccio zur Zeit der Komposition/DeRensis/Sammlung Heinsen
Meine Ausbildung als Komponist hat mir bei der Aufbereitung dieses Materials in unschätzbarer Weise geholfen. Zum Beispiel waren viele Seiten des autographen Manuskripts verblasst. Aber ich fand heraus, dass, wenn ich den Bass und die Gesangslinie herausfinden konnte, der Rest relativ einfach war, wenn man der Logik der tonalen Harmonie folgte. Wenn ich in der Bratschenstimme nicht erkennen konnte, ob es sich um ein C oder ein B handelte, ich aber wusste, dass der Bass ein Ab war und der Tenor ein Es sang, war die Bratschenstimme höchstwahrscheinlich ein C, weil es die Terz des Akkords war. Solche Dinge wurden auf fast jeder Seite sehr nützlich. Der Reiz, eine italienische Oper aus einer der größten Perioden des italienischen Musikschaffens wieder aufleben zu lassen, und die Aussicht, dass sie möglicherweise eines Tages zum Standardrepertoire gehören wird, ist sehr aufregend.
.

Karikatur Franco Faccios/Sammlung Heinsen
Einige Bemerkungen zur Edition, zur Realisierung, zum Projekt? Ich wurde zum ersten Mal auf eine italienische Hamlet-Oper mit einem Boito-Libretto aufmerksam, als ich im Winter/Frühjahr 2002 zum ersten Mal für die Sarasota Opera arbeitete. Im Jahr 2003 nahm ich Kontakt zu Gabriel Dotto auf, einem in Mailand lebenden Musikwissenschaftler, der früher für den italienischen Verlag Ricordi gearbeitet hatte. Ich hatte gehört, dass viele der Archive während des Krieges zerstört worden waren, und ich war mir nicht sicher, ob Ricordi das Autogramm von Amleto noch hatte. Er antwortete mir: „Wie das Glück (und eine ziemlich heldenhafte Anstrengung der Ricordi-Leitung vor sechzig Jahren) es wollte, wurden keine Autographen des historischen Archivs im Krieg zerstört, da die Sammlung heimlich an einen sicheren Ort gebracht wurde.“ (Obwohl die „Produktionskopien“ von Partituren, Leihbibliotheken usw. bei den Bombenangriffen verloren gingen).
Da Ricordi zu dieser Zeit ein neues Domizil in der Biblioteca Brera im Herzen von Mailand bezog, schickte er meinen Brief an Maria Pia Ferraris, die leitende Archivarin des neu eröffneten Ricordi-Archivs. Es stellte sich heraus, dass Ricordi tatsächlich einen Mikrofilm des Autographs besaß, und als dieser eintraf, begann ich mit der mühsamen Aufgabe, das Manuskript zu transkribieren. Zur gleichen Zeit fand meine Frau eine Kopie (ebenfalls ein Mikrofilm) von Boitos Libretto in der Performing Arts Library in New York. Das Libretto war besonders wichtig, da Faccios Handschrift schwer zu entziffern und die Qualität des autographen Manuskripts schlecht war. Der anerkannte amerikanische Musikwissenschaftler und Verdi-Experte Phillip Gossett war unglaublich großzügig und half mir, die handschriftlichen Eigenheiten der Partitur zu entziffern.
.

Franco Faccio: zeitgenössische Karikatur/Sammlung Heinsen
Wie bereits erwähnt, war die Erstellung des Zusatzes ein mehrjähriges Projekt, das noch nicht abgeschlossen ist. Nachdem ich das autographe Manuskript Note für Note auf Notenpapier transkribiert hatte (ein Prozess, der weit über ein Jahr dauerte), gab ich die gesamte Partitur in ein Notensatzprogramm ein. Danach fertigte ich eine Transkription einer Klavierpartitur an, um sie leichter verwenden zu können, und gab dann die gesamte Klavierpartitur in ein Notensatzprogramm ein. Danach verbrachte ich Jahre damit, Korrekturen vorzunehmen, Fehler zu finden, die beiden verschiedenen Libretti (1865, 1871) zu vergleichen und die Partitur generell zu überarbeiten. Als beschlossen wurde, dass wir das Werk an der Opera Southwest aufführen würden, begann ich mit der Anfertigung der Orchesterstimmen. Die Anfertigung der Orchesterstimmen förderte viele weitere Fehler in der Orchesterpartitur zutage, und das Durchspielen des Stücks am Klavier offenbarte Fehler im Klavierauszug.

Franco Faccio/Karikatur/Sammlung Heinsen
Was die Umsetzung des Stücks angeht, so haben wir 2004 das Trio des dritten Akts an der Sarasota Opera in einem Konzert mit ihren Apprentice Artists aufgeführt (mit Klavierbegleitung), und 2007 habe ich Ofelias Trauermarsch in einem Konzert mit dem Dallas Opera Orchestra dirigiert. Darüber hinaus sind mir keine weiteren öffentlichen Aufführungen dieser Musik in den Vereinigten Staaten bekannt. Unser Projekt im Oktober/November 2014 an der Opera Southwest war die amerikanische Erstaufführung der gesamten Oper. Bevor wir mit den Proben in Albuquerque begannen, haben wir ein Vorabkonzert der gesamten Oper mit der Baltimore Concert Opera in Baltimore Maryland gegeben. Diese Aufführungen haben mit Klavierbegleitung stattgefunden, ohne Inszenierung, ohne Kostüme, ohne Bühnenbild, etc. Nur der Gesang und das Klavier. Bei Opera Southwest haben wir dann 2014 die komplette Oper mit Orchester, Bühnenbild, Kostümen, Licht, Make-up, Inszenierung usw. aufgeführt (Amleto / Alex Richardson; Claudio / Shannon DeVine; Geltrude / Caroline Worra; Ofelia / Abla Hamza; Laerte / Javier Gonzalez; Polonio / Matthew Curran; Lo Spettro / Jeff Beruan; Orazio / Joseph Hubbard; Marcello / Paul Bower) an der Delaware Opera zudem 2016 (Joshua Kohl/ Amleto; Sarah Asmar / Ofelia; Tim Mix / Claudius,; Lara Tillotson / Geltrude; Matthew Vickers / Laertes; Ben Wager / Lo Spettro).
.
.

Büste Faccios in seinem Heimatort Monza/Sammlung Heinsen
Ein paar Worte über den Komponisten: Franco Faccio (8. März 1840, 21. Juli 1891) war ein italienischer Komponist und Dirigent. Der in Verona geborene Faccio wurde als Dirigent der Musik von Verdi bekannt. Er studierte Musik in Mailand und begann nach seinem Abschluss eine Karriere als Komponist. Er schrieb die Opern I profughi Fiamminghi (Mailand, 1863) und Amleto (Genua, 1865), letztere eine der vielen Opern, die auf William Shakespeare’s Hamlet basieren. Beide Opern hatten weder bei den Kritikern noch beim Publikum Erfolg. Die für den Amleto komponierte Marcia Funebre gilt jedoch als ein wichtiges Beispiel für Faccios Lyrik. Seine Popularität wird durch die Transkriptionen für Blasorchester im späten 19. Jahrhundert deutlich. Noch heute kann man diesen Teil der Oper in Korfu während der Osterzeit hören, wenn die Kapelle der Philarmonischen Gesellschaft von Korfu ihn während der Epitaph-Litanei des Heiligen Spyridon am Morgen des Karsamstags aufführt. 1867 wurde Faccio Direktor des Mailänder Konservatoriums und 1872 wurde er zum Direktor des Mailänder Teatro alla Scala ernannt. Faccio dirigierte die Uraufführung von Verdis Otello (1887), in der seine langjährige Geliebte Romilda Pantaleoni als Desdemona, Francesco Tamagno als Otello und Victor Maurel als Jago mitwirkten. Er dirigierte auch die Londoner Erstaufführung von Otello, bei der Tamagno seinen Triumph als Mohr wiederholte. Zuvor hatte er bereits die italienische Erstaufführung von Aida (1872) und die Premiere der überarbeiteten Fassung von Simon Boccanegra (1881) dirigiert. Faccio starb in Monza im Alter von nur 51 Jahren. (Übersetzung G. H.)
.
.
.
 Dazu Matthias Käthers Ansicht zu CD und DVD aus Bregenz bei Naxos und C-Major: Faccio war ein wichtiger Verdi-Dirigent, er leitete unter andrem die erste italienische Aida und die Otello-Premiere, und er hätte sicher auch den Falstaff dirigiert, wenn er nicht zwei Jahre vor der Premiere an Krebs gestorben wäre – also ein gewiefter Verdi-Kenner, der sich wie kein anderer mit den Finessen des älteren Maestro auskannte. Und das merkt man seiner Hamlet-Oper auch an, die ganz auf typische Verdi-Kontraste setzt.
Dazu Matthias Käthers Ansicht zu CD und DVD aus Bregenz bei Naxos und C-Major: Faccio war ein wichtiger Verdi-Dirigent, er leitete unter andrem die erste italienische Aida und die Otello-Premiere, und er hätte sicher auch den Falstaff dirigiert, wenn er nicht zwei Jahre vor der Premiere an Krebs gestorben wäre – also ein gewiefter Verdi-Kenner, der sich wie kein anderer mit den Finessen des älteren Maestro auskannte. Und das merkt man seiner Hamlet-Oper auch an, die ganz auf typische Verdi-Kontraste setzt.
Doch ihn einen Epigonen zu nennen wäre ungerecht. Denn das Aufregende an Faccio ist, dass sein Hamlet in groben Zügen die Spätwerke Verdis vorwegnimmt. Vieles ist so radikal in diesem Werk von 1865, dass man es eigentlich in den 1880er oder 90er Jahre verorten würde. In der Tat gehörte Faccio zu einer kleinen wilden Gruppe, die zum Teil das vorwegnahm, was die Veristen um Mascagni und Leoncavallo 25 Jahre später umsetzten. Leider kam diese Gruppe damals mit ihren Ideen viel zu früh und war wenig erfolgreich. Übrigens gehörte auch ein junger begabter Dichter und Komponist dazu, der noch viel von sich reden machen sollte – Arrigo Boito. Und der hat auch das Libretto für diesen Hamlet verfasst. Das ist deswegen spannend, weil Boito später für Verdi auch zwei Shakespeare-Bearbeitungen schreiben sollte, Otello und Falstaff.
Die Hamlet-Premiere in Genua 1865 wurde freundlich aufgenommen, fand aber wegen der Radikalität der Oper keine große Resonanz im restlichen Italien, geschweige denn der Welt. 1871 war an der Mailänder Scala ein Revival geplant. Doch der Hamlet-Sänger war so schrecklich indisponiert, dass er nicht nur schlecht sang, sondern auch verbal überhaupt nicht zu verstehen war. Es gab ein gigantisches Fiasko, und Faccio war so verletzt, dass er nicht nur alle weiteren Aufführungen untersagte, sondern nie wieder eine Oper schrieb. Das Werk blieb vergessen, bis es der Musikwissenschaftler Anthony Barrese vor wenigen Jahren wieder ausgrub – und nach einer kleinen US-amerikanischen Premiere 2014 gab es die vielbewunderte europäische Erstaufführung bei den Bregenzer Festspielen 2016. Genau diese Produktion ist hier mitgeschnitten und verewigt worden. Die Inszenierung von Olivier Tambosi war ein großer Erfolg, und es wurde sogar die Vermutung geäußert, dass diese Oper demnächst eine Repertoireoper werden könnte.

Faccios Oper „Amleto“ in der deutschen Erstaufführung in Chmenitz/ Szene/ Foto Nasser Hashemi (Staatstheater Chemnitz 18 November 2018/ Produktion aus Bregenz 2016; Dirigent Gerrit Prießnitz; Hamlet Gustavo Peña ; Claudius Pierre-Yves Pruvot; Polonius Magnus Piontek; Horatio Ricardo Llamas Márquez; Marcellus Matthias Winter; Laertes Cosmin Ifrim; Ophelia Guibee Yang; Gertrude Katerina Hebelkova; Der Geist / Ein Priester Noé Colín; Der König Gonzago / Ein Herold Tommaso Randazzo; Die Königin Giovanna Ina Yoshikawa; Lucianus / Erster Totengräber André Eckert; Zweiter Totengräber Alexander Jahn; Chor der Oper Chemnitz; Robert-Schumann-Philharmonie
Ich bin da weniger optimistisch. Auch andere visionäre Opern jenseits des Verdi-Kanons wie Boitos Mefistofele oder Catalanis La Wally haben es nicht ins Repertoire geschafft. Hamlet hat schöne Momente – allerdings sind die meisten Einfälle auch nicht besser als die in Ambroise Thomas‘ Shakespeare-Oper, und sollte jemand die (längst fällige) Hamlet-Vertonung von Mercadante reanimieren, müssten wir auch noch über ein zweites Konkurrenzwerk nachdenken. Faccios Hamlet ist ohne Zweifel visionär, und grade als gut inszeniertes Spektakel wirkt das Werk stark. Allein schon wegen Boitos genialer Adaption, die sehr viel vom authentischen Shakespeare rettet, ist es hörenswert. Aber rein musikalisch wird Faccio wohl stets eine Assoziationskette zum Verhängnis, für die er nichts kann. Man fragt sich natürlich: was wäre das wohl für eine tolle Oper geworden, wenn Boito den Text nicht Faccio, sondern Verdi angeboten hätte! Man merkt dann doch, grade an den entscheidenden Stellen: es bleibt oft bei der aufgeregten Geste der großen Oper ohne echte Schöpferkraft, es fehlt manchmal an neuralgischen Stellen der Funke des echten Genies – wie etwa im berühmten Monolog „Sein oder Nichtsein“.
Hier haben wir den seltenen Fall, dass ein Werk nicht so sehr wegen der Interpretation unbefriedigend bliebt, sondern wegen der Musik. Erstaunlich, mit welcher Leidenschaft sich die Beteiligten in die Partien werfen, der Tscheche Pavel Cernoch ein bisschen auf den Spuren von Jose Carreras, aber im positiven Sinne und großem gestalterischen Eigenanteil, Claudio Sgura als schurkischer Baritonkönig voller Emphase und großem Pathos (den es auch braucht), Dsamihla Kaiser als Mutter Gertrude beeindruckend auf dem Weg zur Eboli in Verdis späteren Don Carlos. Die Romänin Iulia Maria Dan schlägt sich mutig mit der schwierigen Rolle der Ophelia herum, meist erfolgreich und stimmschön. Sehr beeindruckend auch die Energie von Paolo Carignani am Pult der Wiener Symphoniker. Hier wurde nichts falsch gemacht, und Verdi-Fans sollten sich das unbedingt anhören. Dennoch bleibt ein wehmütiges Gefühl: da haben wir Verdis Dirigenten und Verdis Librettisten, aber das ergibt leider noch keinen Verdi. Und der wäre vielleicht der Einzige, der aus dem Stück wirklich nicht nur eine schöne Oper, sondern eine Jahrhundert-Sensation gemacht hätte. Matthias Käther
.
Foto oben: Edwin Booth als Hamlet 1860/Wikipedia; Links: http://anthonybarrese.com/biography/ http://anthonybarrese.com/projects/amleto-project/excerpts/
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.
.





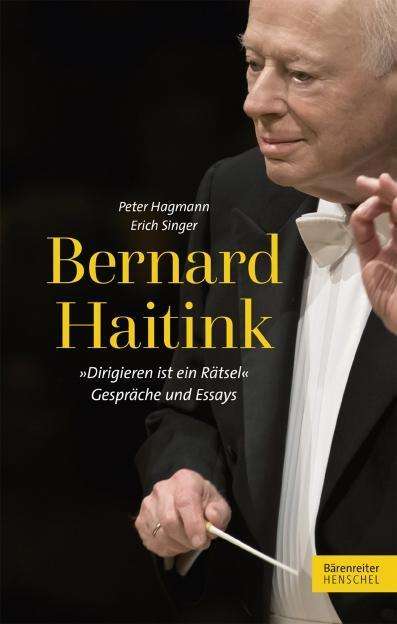



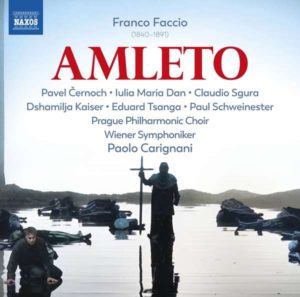 Die Zeitschrift Movimento schrieb damals: „Gestern Abend öffneten sich die Pforten des Carlo Felice für die angekündigte Aufführung der neuen Partitur von Franco Faccio, den Amleto. Groß waren die allgemeinen Erwartungen, da Zweifel laut geworden waren in Bezug auf das neue Genre, an dem sich der junge Maestro versucht hatte. Das Publikum kam in Massen und in der Haltung, dessen, der zu einem wohl bedachten Urteil, sagen wir es offen, mit Strenge bereit war. Aber die Bereitschaft zum Zweifel flaute schnell ab, und nach genauer Prüfung fiel die Entscheidung; man applaudierte und das ganz spontan, aus Überzeugung und mit Enthusiasmus. Ebenso las an es in der Gazzetta di Genova: „Der Oper wurde allgemein nach dem ersten Akt Beifall gespendet, nach dem Duett Ofelia und Amleto, am Ende des zweiten Akts, nach der Canzone der Ofelia im dritten Akt und nach dem Tauermarsch im vierten Akt. Der junge Maestro wurde mehrmals auf die Bühne gerufen.“
Die Zeitschrift Movimento schrieb damals: „Gestern Abend öffneten sich die Pforten des Carlo Felice für die angekündigte Aufführung der neuen Partitur von Franco Faccio, den Amleto. Groß waren die allgemeinen Erwartungen, da Zweifel laut geworden waren in Bezug auf das neue Genre, an dem sich der junge Maestro versucht hatte. Das Publikum kam in Massen und in der Haltung, dessen, der zu einem wohl bedachten Urteil, sagen wir es offen, mit Strenge bereit war. Aber die Bereitschaft zum Zweifel flaute schnell ab, und nach genauer Prüfung fiel die Entscheidung; man applaudierte und das ganz spontan, aus Überzeugung und mit Enthusiasmus. Ebenso las an es in der Gazzetta di Genova: „Der Oper wurde allgemein nach dem ersten Akt Beifall gespendet, nach dem Duett Ofelia und Amleto, am Ende des zweiten Akts, nach der Canzone der Ofelia im dritten Akt und nach dem Tauermarsch im vierten Akt. Der junge Maestro wurde mehrmals auf die Bühne gerufen.“














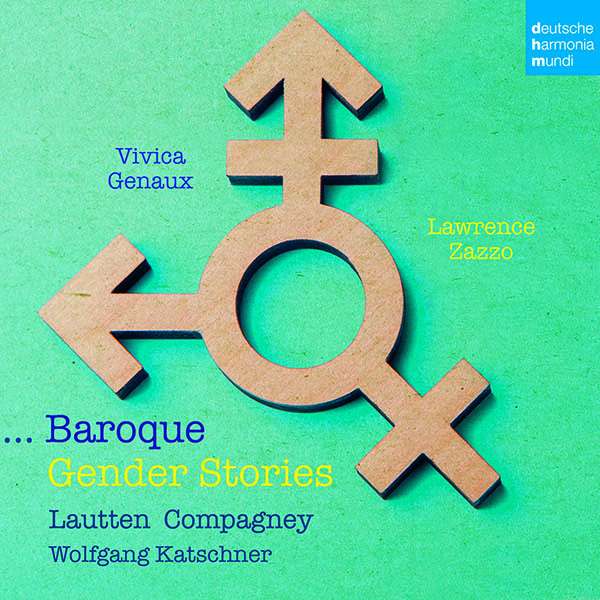

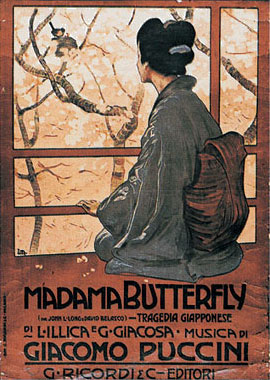
 Der Bassbariton
Der Bassbariton