.
Auch in diesem Jahr sind wir bei der Auswahl der besuchten Live-Aufführungen wählerisch und konzentrieren uns auf wenige und eben für uns interessante Operntitel oder -Locations. Eine Auflistung alle Festival-Beiträge finden sie hier.
.
Im Pflegeheim und Krankenhaus – Donizetti Opera: Das Festival in Donizettis Geburtsstadt Bergamo zeigte 2025 Caterina Cornaro, Il furioso nell’isola di San Domingo sowie die beiden Einakter Il campanello und Deux hommes et une femme.
Die vergangene Dekade hat dem Donizetti Festival, das unterschiedliche Namen trug, aber seit zehn Jahren als Donizetti Opera firmiert, viel Beachtung sowie Preise und Auszeichnungen eingebracht. Die kluge Programmgestaltung, die Öffnung nach vielen Seiten, das Vermittlungsangebot und die internationale Vernetzung wurden gewürdigt. Nach dem überraschenden Rückzug des bisherigen künstlerischen Leiters, Francesco Micheli, wurde dem seit 2017 als Direttore Musicale des Festivals fungierenden Riccardo Frizza aufgrund seiner künstlerischen Erfolge zusätzlich der Posten des Künstlerischen Leiters übertragen. Der international gut beschäftige 54jährige Dirigent aus dem unweiten Brescia wird für Kontinuität und die internationale Anerkennung der Festspiele sorgen, die sich weiterhin auf die drei Wochenende zwischen Mitte November und Anfang Dezember konzentrieren und stets drei Opern präsentierten. So auch in diesem Jahr. Und wieder im Teatro Donizetti in der modernen Unterstadt, der Città Bassa, sowie im Teatro Sociale in der mittelalterlich geprägten Oberstadt, der Città Alta. Das verbindende Thema sei „Il matrimonio“, „die Hochzeit“, was aber genauso austauschbar und inhaltlos wie die Motti ist, mit der hierzulande die Spielzeitprogramme überschrieben werden. Was nicht heißt, dass Hochzeiten, unglückliche, erzwungene oder getrübte, in den Opern nicht eine unwesentliche Rolle spielen

Gaetano Donizetti/ Museo Bergamo/ Wikipedia
Die von den Doppel-Direttore Frizza im Teatro Donizetti geleitete Caterina Cornaro von 1844, die letzte der zu seinen Lebzeiten aufgeführte Oper Donizettis, ist zwar keine ausgesprochene Rarität, doch Donizetti Opera spielte erstmals die Fassung „con l’intero testo poetico musicato da Donizetti e il finale secondo la volontà del compositore“. Eine ausgesprochene Rarität dagegen ist Il furioso nell’isola di San Domingo (Der Wahnsinnige auf der Insel Santo Domingo) von 1833, die ebenfalls im Teatro Donizetti „nella versione integrale della partitura del 1833“ aufgeführt wurde. In Teatro Sociale gab es eine Produktion mit zwei Einaktern: die Farsa Il campanello von 1836 in der Fassung von 1837 sowie die 1860 posthum uraufgeführte Opéra-comique Deux hommes et une femme, die mit dem italienischen Text von Enrico Colosimo auch als Rita bekannt ist
Der zwölf Jahre nach Donizettis Tod an der Opéra Comique in französischer Sprache uraufgeführte Einakter Deux femmes et une femme wirkt in seiner Beschränkung auf drei Personen und der Abfolge der Nummern, drei Arien, drei Terzette, dazu Ouvertüre, Terzett und Vaudeville, wie eine Reminiszenz an Rossinis frühe Farsen, doch die zwischen La fille du régiment und Don Pasquale entstandene Musik greift den Geist der französischen Musikkomödien der 1840er Jahre auf und versprüht romantische Duftigkeit. Sie ist von bezaubernder Anmut, besitzt Esprit und Witz. Als er 1838 in Paris eintraf, beschäftigte sich Donizetti im Auftrag der Opéra Comique mit einer heiteren Oper, für die ihm der Komödienspezialist Gustave Vaëz einen Originalstoff einrichtete: Die Wirtin Rita ist mit Pepé verheiratet. Da sie von ihrem ersten Mann Gasparo geschlagen wurde, schlägt sie nun ihrerseits Pepé. Gasparo gilt seit einem Schiffsunglück als verschollen. Ein Fremder taucht im Gasthof auf. Es handelt sich natürlich um Gasparo. Pepé wittert seine Chance, Rita loszuwerden. Als Gasparo erkennt, dass seine Frau, von der meinte, sie sei bei einem Brand umgekommen, noch lebt, will er abhauen. Beide Männer spielen um Rita. Der Sieger im Spiel muss Rita nehmen. Gasparo gewinnt bzw. verliert, denn er muss Rita zurücknehmen. Mit einer List gelangt Gasparo aber an die alte Heiratsurkunde und verprügelt Pepé, der verspricht, Rita zu behalten. Die Aufführung an der Opera Comique zerschlug sich, ebenso in Neapel, wohin das Werk 1841 geschickt wurde. Erst 1860 fand die späte Uraufführung statt; Bergamo präsentierte jetzt die Edizione critica von Paolo A. Rossini und Francesco Bellotto.

Bergamo – Donizetti Opera 2025: „Il Campanello“/Szene/Foto Gianfrnco Rota
Der in Neapel spielende und dort 1836 im Teatro Nuovo uraufgeführte Einakter Il campanello bzw. Il campanello di notte (Die Nachtglocke) um den Apotheker Don Annibale Pistacchio, der die junge Serafina heiratet, ist dagegen bekannter. Serafinas Ex-Lover Enrico will dem Paar die Hochzeitsnacht vermiesen, läutet die Nachtglocke und hält den Apotheker in wechselnden Verkleidungen vom Vollzug der Hochzeitsnacht ab. Am nächsten Tag muss Don Annibale in dringenden Geschäften nach Rom. Enrico freut sich. In Bergamo wurde jetzt erstmals Ilaria Naricis kritische Ausgabe jener Fassung aufgeführt, die Donizetti selbst 1837 für das Teatro del Fondo in Neapel erstellte, wobei er die Sprechtexte durch Seccorezitative von Salvadore Cammarano und den neapolitanischen Dialekt durch Italienisch ersetzte.
Stefania Bonfadelli inszenierte die beiden jeweils gut einstündigen Komödien mit merklicher Lust (28. November). Die einstige Belcanto-Virtuosin kennt das Metier, hat sich als Regisseurin mehrfach ausgezeichnet, darunter 2017 mit Un giorno di regno in Martina Franca sowie anschließend bei Rossini in Wildbad mit Matilde di Shabran und La scala di seta, und setzt die jungen Absolventen der Talentschmiede Bottega Donizetti mit gewinnender Lässigkeit in Szene. Man merkt Bonfadelli an, dass ihr die Stoffe zu dünn und leicht erscheinen, weshalb sie die Farsa und die Opéra comique geschickt verschränkt: das Hotel Rita befindet sich direkt neben der der Pharmacie Pistacchio. So kommt es, dass sich der unförmige Hausdiener mit dem Servierschürzchen nach der Pause im zweiten Stück als Pepé herausstellt, in der Apotheke die Jalousie heruntergelassen wird, während Serafina und Enrico sich zum Schäferstündchen zurückzeihen, aber sich schließlich völlig entzweien usw. Bonfadelli hat die beiden Stränge unaufdringlich in Beziehung gesetzt und in die frühen 1960er Jahre verlegt, was den Chordamen und köstlichen stummen Darstellerinnen zu sehenswerten Hochfrisuren verhalf. In Campanello machte der sehr junge Pierpaolo Martella mit seinem dunkel kernigen, gutsitzenden Kavaliersbariton als Don Annibale bella figura. Erstaunlicherweise ist auch der Enrico ein hoher Bariton. Francesco Bossi nutzte die vielen Bravourszenen, die ihm Donizetti gab, gefällt durch Leichtigkeit und rasant prasselndes Plapper-Parlando, etwa in seinem Brindisi „Mesci, mesci, e sperda il vento“ oder in der Verkleidung als alter Mann, der Rezepte und Arzneien herunterrattert; „Mesci, mesci, e sperda il vento“ ersetzte in der zweiten Fassung das ursprünglich eingelegte Orsini-Lied “Il segreto di esser felice“, das Ugo Mahrieux anschließend aparterweise im Fortepiano sanft anklingen ließ. Mit kräftiger Soubrettensüße gab Lucrezia Tacchi die Serafina, während sich Eleonora de Prez als deftige Madama Rosa ihrem Schwiegersohn an den Hals schmiss. Während Campanello doch sehr schablonenhaft bleibt, ist Deux homme et une femme das reichere Stück, mit dem Donizetti die für ihn typische Schwebelage von Witz und Ernst und Melancholie schön austariert. Christina De Carolis war die etwas säuerlich spitz klingende Rita mit hurtigem Ziergesang. Eine Überraschung bot der offenbar bestens an Mozart und Belcanto-Etüden geschulte Chilene Cristóbal Campos Marín, der den Pepé mit eleganter Klangfülle, Stilgefühl und ironischem Funkeln gab. Alessandro Corbelli, mindestens eine Generation älter als die ihm anvertrauten Schüler, spielte als Gasparo seine jahrzehntelangen Erfahrungen aus und trumpfte mit lautem Ton und praller vis comica auf. Für die musikalisch treffsichere Verblendung der Stücke war Enrico Pagano zuständig, der mit dem auf Originalinstrumenten spielenden Orchestra Gli Originali einen beseelten, punktgenau reagierenden Komödienton realisierte.

Bergamo – Donizetti Opera 2025: „I Furioso al Isola di San Domiungo“/Szene/Foto Gianfrnco Rota
In der Uraufführung von Il campanello sang Giorgio Ronconi die virtuose Partie des Enrico. Er hatte drei Jahre zuvor seine erste Donizetti-Partie kreiert, als er die Titelrolle in Il furioso nell’isola die San Domingo gesungen hatte. Die Geschichte um Cardenio, der über den Betrug seiner Frau Eleonora verrückt wurde und deshalb seit einigen Jahren auf der Insel San Domingo lebt, ist eine der merkwürdigsten, die Donizetti vertont hat. Es ist zugleich die erste Oper, in der er dem Bariton eine Hauptrolle übertrug. Giorgio Ronconi war bei der Uraufführung von Il furioso nell’isola di San Domingo am 2. Januar 1833 am Teatro Valle in Rom erst 22 Jahre alt. Ronconi wirkte noch in weiteren Uraufführungen Donizettis mit, darunter als wichtigste im gleichen Jahr und am gleichen Haus Torquato Tasso, und kreierte 1842 den Nabucco. Das auf der Titelseite als Melodramma bezeichnete Werk, zu dem Rossinis Aschenputtel-Dichter Jacopo Ferretti das Libretto nach einer Episode aus Don Quijote verfasste, ist der Gattung nach eine Semiseria, also eine halbernste Geschichte und behandelt den holprigen Heilungsprozess des Cardenio, der von Bartolomeo und seiner Tochter Marcella betreut wird und dem unabhängig voneinander Eleonora und sein Bruder Fernando auf die Insel folgen. Für die Semiseria-Elemente ist der von einem Bassbuffo gesungene Diener Kaidamà zuständig. Er ist ein Schwarzer, in der aktuellen Inszenierung ein Clown. Gespielt wurde die zu Donizettis Lebzeiten ungemein erfolgreiche Oper zuletzt 2006 in Gelsenkirchen in Andreas Baeslers Einer flog über das Kuckucksnest-Inszenierung und 2013 beim Festival in Bergamo (mit Simone Alberghini und Cinzia Forte); ich erinnere mich recht gut an die Aufführung 1987 in Savona (unter Carlo Rizzi mit Stefano Antonucci und Luciana Serra). Die aktuelle Produktion in Bergamo benutzt die Edizione critica von Eleonora Di Cintio. Bereits während der originalen zweiteiligen Sinfonia, die Alessandro Palumbo anstelle des 1833 in Rom gespielten Preludios benutzt, führt uns die wirkungsvoll gesteigerte Larghetto-Allegretto-Form in ein Altersheim, wo der alte Cardenio in seinen Erinnerungsstücken kramt und seine Gedanken, trotz der Einlenkungen der jungen Pflegerin, zurück auf die Insel San Domingo schweifen. Das kleine Zimmerchen weitet sich, die hübsche hellbunte Tapete mit Flora und Fauna aus exotischen Regionen wird zum karibischen Inselreich. Immer wieder zoomen Regisseur Manuel Renga und sein Ausstatter Aurelio Colombo, die durch den kürzlich beim Verdi Festival in Busseto erarbeiten Macbeth in Erinnerung sind, durch die horizontale und vertikale Verengung des schwarzen Rahmens in die kleine Kammer des greisen Cardenio, der sich anfangs noch als junger Mann an der Seite seiner Braut Eleonora sieht, aber mehr und mehr in einen Strudel gezogen wird, in dem er und die Zuschauer nicht mehr zwischen Realität und Wahnvorstellungen unterscheiden können. Renga gelingt es, diese Verschiebung der Zustände sehr überzeugend ohne inszenatorische Kapriolen auszuspielen, denn der Zustand des sich mal mit seiner Vergangenheit, sprich mit Eleonora, versöhnenden, dann wieder selbstmörderisch wütenden Cardenio wäre auf der Bühne tatsächlich schwer zu fassen. Bei Renga und Colombo werden ein Schrank zur Tür zur Außenwelt, schweben Möbel und Gegenstände im ersten Finale durch die Luft. Endlich klärt sich Cardenios Zustand und, obwohl vieles ringsum in Trümmern liegt, stellen sich er und Eleonora nochmals zum Hochzeitsfoto in Positur. Der alte Cardenio (Andrea de Manincor) und die ihn umhegende alte Eleonora beschauen sich die Idylle, von der wir nicht wissen, ob sie Wirklichkeit oder Traum ist. Gleichmals bezwingend gestalten Polumbo und das Orchestra Donizetti Oper diese in den ersten Jahrzehnten nach der Uraufführung populäre Oper, die eine stärkere Verbreitung verdient hätte. Spannend und wie aus einem Guss wölben sie in dem Meisterwerk aus Donizettis mittlerer Periode einen Bogen von der Sinfonia über die reichen Ensembleszenen, das vielgliedrig aufgedröselte und dann wieder virtuos geballte erste Finale, die beiden interessanten Duette Cardenios mit Kaidamà und sein Duett mit Eleonora – dazu die Cavatinen der Eleonora und des Fernando – bis zum Rondo „Se pietoso d’un obblio“ der Eleonora. Obwohl das Finale der Primadonna gehört, bleibt Cardenio die zentrale Figur. Es ist eine der anspruchsvollsten Partien, die Donizetti für Bariton geschrieben hat. Der ariose, deklamatorische und reich durchbrochene Gesangspart, reizt den gesamten Tonumfang eines Baritons aus, fordert Sprünge und lange, edle Phrasen, so dass auch der mit prächtig ausladendem Bariton und glanzvoller Höhe singende Paolo Bordogna in der Tiefe einige Male in Bedrängnis kommt und mehrfach wünscht man, dass der energische, steifgerade Ton sich zu einem warmen Legato weitet. Ein brillanter Singdarsteller ist der Bariton Bruno Taddio, bei dem Singen und Spielen gleichwertig ausbalanciert sind, sein Kaidamà ist ein trauriger Clown, der sich am Ende seine Schminke aus dem Gesicht wischt. Durchaus brillant singt der italo-argentinische Tenor Santiago Ballerini den Fernando, der als Figur ein Solitär bleibt, während Valerio Morelli und Giulia Mazzola als Bauer Bartolomeo und seine Tochter Marcella viele Ensembleszenen mit kräftigen Akzenten versahen. Als Eleonora verbindet Nino Machaidze mit dunkelschwerem melancholischem Timbres und runden Höhen die Brillanz und Koloraturfertigkeit eines Soprano leggero mit der Fülle und Entfaltung eines Soprano lirico, dem im ersten Finale viel an dramatischer Kraft und Agilität abverlangt wird. Eine großartige Aufführung (29. November).

Bergamo – Donizetti Opera 2025: „Catarina Cornaro“/Szene/Foto Gianfrnco Rota
Männer, die sich in wahnhafte Vorstellungen flüchten, bleiben bei Donizetti die Ausnahme. Wahn bleibt den Damen vorbehalten. Caterina Cornaro folgt dieser Regel perfekt. Zumindest in der mit dem Teatro Real in Madrid koproduzierten Inszenierung des einstigen Festspielleiters Francesco Micheli. Da sitzt also eine hochschwangere Frau im roten Kleid im Krankenhaus, wartet auf Schwestern oder Ärzte, die ihr Röntgenaufnahmen zeigen oder Auskunft über das Befinden ihres Gatten geben. Im Lauf des langen Wartens verschlechtert sich offenbar der Zustand des Mannes, im Krankenbett wird er von einem Raum in den anderen geschoben, ein Arzt, in dem findige Zuschauer den einstigen Geliebten Gerardo erkennen, kommt in höchster Eile hinzu und greift zum Operationsbesteck. Doch alles vergebens. Das ist ein Strang in Michelis Erzählung, denn die Frau, eine moderne Schwester der Caterina Cornaro, wischt über Handyfotos und erinnert sich an Venedig, „C’era una volta a Venezia“. Zwischendurch werden ihre Gedanken und Wünsche auf die Wände projiziert, was der Aufführung nicht unbedingt bekommt, denn Caterinas peinliches Plappern wirkt wie aus einer Vorabendserie, „Um zu überleben habe ich eine andere Liebe gewählt“, „Ich bitte dich Geliebter, lebe“, „Unser Sohn soll seinen Vater kennenlernen“. Begleiterinnen erscheinen in schönen Renaissanceroben (Alessio Rosati), entsprechende Architekturteile, die Matteo Paoletti Franzato erdacht hat, formen sich zu Sälen und Raumfluchten.
Wir erinnern uns: Caterina (1454-1510) war die letzte Königin von Zypern (1473-89). Als sie 14 Jahre alt war, wählte sie Jakob II. von Lusignan, der König von Zypern, zur Gattin. 1472 segelte Caterina nach Zypern, wo die Hochzeit stattfand. Bereits wenige Monate später starb Jakob II. Auch ihr nach dem Tod des Gatten geborener Sohn, für den sie die Regentschaft übernommen hatte, starb noch als Säugling, worauf Caterina rechtmäßige König von Zypern wurde. Um sich Zyperns zu bemächtigen, zwang die Republik Venedig Caterina zu Abdankung. Die einem alten Patriziergeschlecht entstammende Caterina, die von Bellini und Tizian gemalt wurde, behielt den Rang einer Königin und wurde ins goldene Exil nach Asolo gedrängt, wo sie ihre Residenz mit Dichtern, Gelehrten und Künstlern zu einem Musenhof ausbaute. Auch einige Opern behandelten ihr Schicksal. Darunter Halévys La reine de Cypre (1841)., auf die Giacomo Sacchero zurückgriff, als er für Donizetti Caterina Cornaro verfasste, wo die kurz vor der Eheschließung mit Gerardo, ursprünglich Gerard de Coucy, stehende Caterina durch Mocenigo, der die Interessen der Republik vertritt, gezwungen wird, Lusignano zu heiraten. Andernfalls werde Gerardo umgebracht. Caterina lässt sich darauf ein, bleibt dem 14 Jahre älteren Lusignano, der sie aufrichtig liebt, eine gefühlskalte Gattin. Die Männer begegnen sich, erkennen, dass sie beide von der Republik Venedig getäuscht und um ihre Liebe gebracht wurden. Gerardo letzte Begegnung mit Caterina ist nur noch Entsagung. Beide Männer sterben im Kampf für Zyperns Unabhängigkeit.
Ursprünglich bestimmte Donizetti seine Caterina Cornaro 1842 für Wien, doch als er vom Münchner Erfolg von Lachers Caterina Cornaro-Oper hörte, bestimmte er seine Version für Neapel, wo sie am 12. Januar 1844 am Teatro San Carlo uraufgeführt wurde. Da er sich für eine Reise zu schwach fühlte, hatte Donizetti Saverio Mercadante gebeten, ein Auge auf die Vorbereitungen zu haben, und war dennoch voller böser Vorahnungen. Die Uraufführung war ein Fiasko. Das Stück mit seinem überlangen Prolog und dem sehr kurzen zweiten Akt ist beklemmend und düster. Darüber kann auch der Chor der Festgäste nicht hinwegtäuschen, denn rasch trübt der Auftritt des Mocenigo das musikalische Geschehen derart ein, dass nicht nur der ausführliche Prolog von einer nächtlichen düster-dichten Stimmung beherrscht wird, die an den Prolog von Verdis Simone Boccanegra erinnert, sondern das ganze Stück wie mit Trauerflor umrandet bleibt. Nur einmal im ersten Duett Caterina/ Gerardo „Dolce amor mio“ flammen Liebe und Leidenschaft auf. Der Rest ist dann Leiden, Aufopferung, Hingabe. Carmela Remigio, beliebt in Bergamo, wo sie u.a. Lucrezia Borgia und Mayrs Medea war und in Il castello di Kenilworth gesungen hat, sang die Caterina gleich in ihrer Arie „Vieni, o tu, che ognora io chiamo“ mit flacher, farb- und glanzloser Stimme und anämischer Gleichförmigkeit, die zur Hochschwangeren passt. Aber zu einer verdienten Neuentdeckung und einer vierten großen Donizetti-Königin in der Reihe von Anna Bolena, Maria Stuarda und Elisabetta in Roberto Devereux, als welche Riccardo Frizza die Caterina Cornaro sieht, reicht es nicht. Die in Bergamo gespielte alternative Fassung enthebt Caterina ihrer Schlussarie, da sie mit dem Tod des Lusignano endet, der Caterina noch gesteht, dass auch Gerardo im Kampf für ihn gefallen sei.
Als Gerardo ist der Sizilianer Enea Scala dagegen ein feuriger Liebhaber, wie ihn sich jede Königin nur wünschen könnte. Scala hat einen schmalen, gut fokussierten und leuchtkräftigen Tenor, singt mit fabelhafter Diktion, geradezu ekstatischer Leidenschaft, manchmal ein wenig kurzatmig im Überschwang und mit gleichförmiger Klangpracht, doch verschwenderischer Energie. Die hatte Vito Priante nicht. Der Bariton musste nach der Romanze des Lusignano aufgeben. Das Cover sang zunächst hinter der Bühne, bevor der südkoreanische Bariton Wonjun Jo ab dem zweiten Teil auch szenisch präsent war. Jo nutzte die Chance als Einspringer, sang mit unerschütterlich festem und sicheren Bariton. Die darstellerische Tapsigkeit sieht man dem armen Mann auf der Krankenliege bzw. im Krankenhaushemdchen gerne nach. Mit seinem nachtschwarzen Bass, der jedermann das Fürchten lehrt, machte Riccardo Fassi als Mocenigo großen Eindruck; dieser Vertreter der Republik wirkt wie ein Sendbote der Hölle, der alle Fäden in der Hand hält. Noch ein Einspringer. Am Morgen der Aufführung (30. November) stellte sich heraus, dass Frizza die Oper nicht würde dirigieren können. Der 28jährige Aram Khacheh war ein vollwertiger Ersatz und leitete das Orchestra Donizetti Opera und den Coro dell‘Accademia Teatro alla Scala, der alle drei Opern souverän bewältigte, mit stupender Sicherheit und Präzision. Der in Rom geborene Sohn persischer Elterngewann hatte im Vorjahr den Cantelli-Wettbewerb gewonnen und bewies sich auf Anhieb als Ausnahmetalent. An ihm lag es nicht, dass die Caterina Cornaro dennoch eine Enttäuschung blieb.
2026 gibt es L’esule di Roma, Alahor in Granata und Le convenienze ed inconvenienze teatrli. Rolf Fath
.
.
Teatro Municipale Piacenza – Trilogia Popolare: Welch interessante Idee. Ein Sopran, ein Tenor und ein Bariton singen drei Opern Giuseppe Verdis innerhalb von fünf Tagen. Ich hatte mir das schön vorgestellt, zugleich könnte es Aufschluss darüber geben, wie in einem kleineren oder mittleren italienischen Haus die Werke des Großmeisters behandelt werden. Wobei das sicher keiner in dem zwischen Mailand und Parma gelegenen Piacenza gerne hören möchte, wurde doch das 1804 mit einer Oper von Giovanni Simone Mayr eröffnete Teatro Municipale gerne mit der Mailänder Scala verglichen, nachdem ihm der Architekt und langjährige Bühnenbildner der Scala, Alessandro Sanquirico, um 1830 die heutige Fassade angepasst hatte. Klein ist das neoklassizistische und teils rokokohaft verspielte gold-rote Opernhaus mit seinen fünf Rängen keineswegs, doch sehr häufig bespielt wird es nicht. Das Opernprogramm macht, wie in mehreren Städten in der Lombardei oder Emilia Romagna, einen reichen Eindruck, doch die fünf oder sechs Titel werden jeweils nur zweimal gegeben und wandern von Ort zu Ort, darunter Como oder Brescia, Cremona, Modena, Reggio Emilia, Pavia, Lecce oder eben auch Piacenza. Der Verbund der OperaLombardia wirkt da segensreich, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Land der Oper die Häuser abends viele häufiger geschlossen als festlich erleuchtet sind. Doch, wenn sie öffnen putzen sich alle heraus.

Piacenza/“Rigoletto“/Szene/Foto Maria Parmigiani
Piacenza, zu dessen Provinz immerhin Verdis Landgut in Sant’Agata gehört, hat sich als Reaktion auf das gerade zu Ende gegangene Festival Verdi in Parma etwas Eigenes einfallen lassen: eine Piacentiner Produktion der Trilogia Popolare mit den drei gleichen Sängern. In zwei chronologischen Durchläufen. Das ist wie der Ring innerhalb von sechs Tagen. Trilogia Popolare muss man in Italien nicht erklären. Es handelt sich um die drei populärsten Opern von Verdi, die natürlich in kleinster Weise als eine solche Trilogie geplant waren oder eine Einheit bilden, die Nummern 17 bis 19 in Verdis Opernkatalog bzw. der 1851 in Venedig uraufgeführte Rigoletto, Il Trovatore, der im Januar 1853 in Rom herauskam, sowie die knapp sechs Wochen später wieder in Venedig erstmals aufgeführte La Traviata. Die Bezeichnung entstand aufgrund der anhaltenden Popularität erst im Nachhinein. Antonio Gramsci, Schriftsteller, Politiker und Mitbegründer der kommunistischen Partei Italiens, erkannte ihre Bedeutung für die nationale Kultur und bezeichnete sie als „autenticamente nazionalpopolare“. Rigoletto und La Traviata haben einiges gemeinsam. Beide basieren auf französische Vorlagen von Victor Hugo bzw. Alexandre Dumas fils, zu den Piave die Libretti verfasste, beide wurden auf unterschiedliche Weise von der Zensur gebeutelten und beide nehmen durch ihre emotionale Darstellung zweier Außenseiter ein, mit denen Verdi die Bourgoisie seiner Zeit kritisierte. Der vergleichsweise konventionelle Trovatore war trotzdem oder gerade deshalb die im 19. Jahrhundert meistgespielte Oper Verdis. Alle drei stellen einen Kraftakt nicht nur für ein Theater von der Ausstattung des Teatro Municipale in Piacenza dar.
Die drei Sänger waren Luca Salsi und Francesco Meli, beide ausgesprochen Stars in ihrer Heimat, sowie die Newcomerin Maria Novella Malfatti. Für den unweit von Piacenza geborenen Salsi ist es ein Heimspiel, auch Meli stammt im weitesten Sinn aus der Gegend, nämlich aus Genua. Die 32jährige Malfatti kommt aus der Toskana. Der Wechsel von einer Oper zur anderen sollte ihnen kein Problem bereiten. Die Sänger der Uraufführungen waren stilistisch breit aufgestellt. Die erste Gilda hatte beispielsweise vorher Odabella und Abigaille gesungen, was man heute von keiner Gilda erwarten würde. Auch Fanny Salvini-Donatelli, die Ur-Violetta, hatte zuvor Abigaille gesungen. Rosetta Penco, die die Leonora kreierte, war auch die erste Luisa Miller und Giovanna d’Arco. Felice Varesi, der erste Rigoletto, sang und kreierte mehrere von Verdis großen Bariton-Partien. Auch die Uraufführungstenöre hatten zuvor oder später mehrere Verdi-Partien übernommen; der erste Herzog, Raffaela Mirate, und erste Alfredo, Lodovico Graziani, hatten ebenfalls als Manrico reüssiert. Von Anfang an war in Piacenza vorgesehen, dass Ernesto Petti die Baritonpartien im zweiten Zyklus singen würde. Doch dann stieg Salsi aus dem Trovatore aus, da er sich auf die am 1. November von RAI 3 übertragene Tosca aus Rom vorbereiten musste – war aber am Tag darauf pünktlich zur Nachmittags-Traviata wieder zurück in Piacenza – worauf Petti bereits im ersten Zyklus als Luna auftrat und schließlich musste sich Malfatti im ersten Zyklus durch Ruth Iniesta ersetzen lassen. Francesco Meli blieb die Konstante. Natürlich auch Francesco Lanzillotta, der gerade in Parma beim Verdi-Festival einen zwingenden Macbeth dirigiert hatte, sowie der Coro del Teatro Municipale di Piacenza und das Orchestra Sinfonica di Milano.
Roberto Catalano fand mit seiner Ausstatterin Marian Moreira eine ansprechende Form, um den drei unterschiedlichen Stücken eine einheitliche Bildsprache zu geben, ohne sie in ein Korsett zu zwingen. Auch keine provinzielle Kulissenschieberei. Stattdessen stellt im Rigoletto ein klarer, weißer spätbarocker-klassizistischer Raum mit drei Portalen auf der Rückseite den Herzogspalast dar. Für die weiteren Schauplätze bedarf es außer den Kronleuchtern, den wenigen Möbeln für Rigolettos Heim oder der Außenmauer für die Schänke nur durchscheinende Wände. Das wirkt nüchtern geschmackvoll und greift die Architektur der Stadt auf, konzentriert sich ganz auf die Hauptfiguren, nimmt aber auch die Nebenfiguren wie den gedemütigten Conte di Monterone wichtig, bei dessen Fluch sich der Tod aus dessen weiten Schleppe wälzt und fortan wie ein Gift, welches den Palast mit schwarzen Schwären überzieht, gegenwärtig ist. Bis er schließlich bei Rigolettos letzten „La maledizione“ triumphierend zurückbleibt. Dieser hochästhetische Rahmen bleibt auch im Trovatore und der Triavata erhalten.
Luca Salsi kostet diese letzte Phrase, „La maledizione“, mit schier endlosem Atem aus, worauf ihm das Publikum zu Füßen liegt (29.10). Der klangprächtige Salsi singt den Hofnarren ansonsten ohne zur Galerie zu schielen, geradlinig im Duett mit Gilda, etwas angeschlagen in der Höhe, doch mit satt voluminösem, gelegentlich eingedickt opakem Ton in „Cortigiani“. „Si venedtta“ beginnt er ganz leise, um es dann umso eindrucksvoller zu steigern, doch ohne mit Ruth Iniesta die bravouröse Variante zu wählen. Die Spanierin ist eine mädchenhaft zurückhaltende Gilda mit exquisiten Tönen in „Tutte le feste“. Francesco Meli ist nicht der geborene Verführer, scheint über den Herzog, wie auch den Alfredo, hinausgewachsen zu sein, aber man erlebt einen Sänger mit einer klaren, druckreifen Diktion und souveränem Umgang mit den Rezitativen, das trompetenhelle Timbre ist nicht jedermanns Sache, aber er gefällt durch ein gut fokussiertes zartes Piano, gibt den Arien Schwung und Leidenschaft und gestaltet seine große Szene zu Beginn des zweiten Aktes „Ella mi fu rapita“ wie aus dem Lehrbuch, verzichtete aber bei der Cabaletta „Possente amor“ auf den Bravourschlenker, wie denn auch die zweite Strophe seines „La donna è mobile“-Schlagers etwas zu prosaisch klang. Insgesamt bleibt Meli eine Spur zu gleichförmig, fehlt es ihm an draufgängerischer Brillanz. Alle anderen waren vorzüglich und vermittelten den Eindruck eines geschlossenen Ensembles, das jede Nuance des Textes erfasst, hervorzuheben sind die auffallende Giovanna von Ester Ferraro und der ausgezeichnete Bass Adolfo Corrado als sinister Sparafucile und zwei Tage später als spannender Ferrando, dem man bei seiner Erzählung an den Lippen hängt. Obwohl das Orchester am ersten Abend noch etwas ungenau klang, gelang es Francesco Lanzillotta, das Drama bereits mit wenigen Strichen präzise zu umreißen.
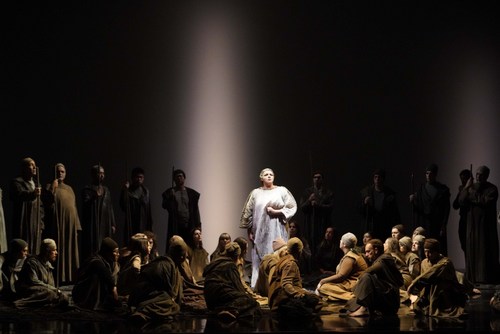
Piacenza/“I Trovatore“/Szene/Foto Gianni Cravedi
Zwei Tage darauf (31.10.) schreitet wieder die dünne und lange Nosferatu-Gestalt des kahlköpfigen Todes durch das Mittelportal, das jetzt das Schloss Aliaferia und die weiteren Schauplätze im Nordwesten Spaniens darstellen wird. Er ist der ständige Begleiter der im weiten Prachtgewand wandelnden und offenbar in der Asche wühlenden Azucena, durch deren majestätische Aura Regisseur Catalano und Teresa Romano Verdis ursprüngliche Absicht unterstreichen, die Oper nach der Zingara zu benennen. Erst jetzt schildert Ferrando die langen zurückliegenden traumatischen Vorgänge.
Feinsinnig erfasst Lanzillotta die notturnen Schwingungen, betont nicht die bizarre Kühnheit und Originalität, nicht das Primitive und Unbehauene der Musik, sondern die hochromantische, leidenschaftlich vorwärtsdrängende Geschichte, die der Regisseur ganz auf das Viereck der Protagonisten und szenisch geschmackvolle Unauffälligkeit beschränkt. Mit königlicher Haltung und Stimme bildete Teresa Romanos Azucena das Zentrum der Aufführung. Mit ausdruckvoll leidenschaftlich changierender Tiefe, warmer Mittellage und ausladender Höhe sang sie eine geradezu explosive Azucena, deren beiden große Soloszenen wild und zugleich verführerisch klangen. Beeindruckend auch Maria Novella Malfatti, deren Leonora zwar noch nicht ausgereift ist, aber die reichen Anlagen der jungen Sopranistin zeigen, ein Lirico-Spinto Sopran mit gelegentlich dunkler Einfärbung, bezaubernder Koloratur, etwas steifen und aufgesetzten Höhen, filigranen Piani und hinreichend Attacke und Bravour für den vierten Akt. Ernesto Petti, der Bariton aus Salerno, gibt den Luna mit noble Machogeschmeidigkeit und anfangs etwas schmalbrüstigem Klang, zeigt aber ab dem Cantabile „Il balen del suo sorriso“ die Vorzüge einer guten Ausbildung und eines sicheren kernigen Baritons . Der Manrico bringt alle Vorzüge des Francesco Meli zu Geltung, die tadellose Technik, die leidenschaftlich geformten Phrasen mit den generös entfalteten Bögen („Ah! Si, ben mio“), die elegante Diktion, den drängenden Impetus, Sturm und Drang des Singens wie es dieser Figur so gut ansteht, doch wieder ohne den letzten Kick an Brillanz und Bravour, sprich das sichere hohe C, das das Publikum so gerne gehört hätte.

Piacenza/“La Traviata“/Szene/Foto Maria Parmigiani
Schließlich als umjubelter Abschluss der von den Medien viel beachteten Trilogie La Traviata, die zum Triumph der kühl eleganten Maria Novella Malfatti wird (2. November), die brillante Koloratur, Temperament und Leidenschaft vereint, die große Arie rückenliegend auf dem breiten Tisch singt, „Amami Alfredo“ mit Kraft und dunklem Pathos erfüllt und den dritten Akt durch eine fein abgestufte Interpretation trägt, bis sie schließlich ihrem treuen Begleiter, dem Tod, in die Arme stürzt. Der elegante Raum ist zunehmend von schwarzen Flecken überzogen und die Fäulnis hat sich bis zum Bühnenrahmen fortgesetzt. In der von Lanzillotta schwermütig und elegisch, doch nie sentimental dirigierten Aufführung baut Meli seine große Szene zu Beginn des zweiten Aktes („Lunge da lei“) wieder vorbildlich und mit verschwenderischem Klang auf, und seinen kurzen Ausfall in der Cabaletta verzeiht das Publikum gerne, da er im dritten Akt das Duett „Parigi, o cara“ mit den zärtlichsten Pianotönen umhüllt. Salsi singt den Germont mit der Fülle seiner Möglichkeiten, ein wenig zu kalkuliert und trickreich. Auf solche Comprimarii wie Davide Maris Sabatino als Douphol, Omar Cepparolli als Doktor Grenvil, Nicola Zambon als Marchese und Simone Fenotti als Gastone, die sich wirkungsvoll von dem dezenten Chor abheben, könnte manches Staatstheater stolz sein. Rolf Fath
.
.
Teatro Regio di Parma: Das 25. Festival Verdi im Zeichen Shakespeares. „Sciopero“, das Unwort der frühen Jahre, als ich regelmäßig in mehrere italienische Theater reiste, ist wieder da. Damals musste man regelmäßig auf Zugstreiks gefasst sein, die allerdings durch einen gut funktionierenden Überlandbusverkehr abgefedert wurden, oder auf Aktionen, die den Theaterbetrieb lahmlegten, so dass es durchaus passieren konnte, dass die Zuschauer bereits auf den Dirigenten warten und stattdessen die Intendanz die kurzfristige Absage der Aufführung verkündete.
Der aktuelle Generalstreik betraf auch die Falstaff-Premiere im Teatro Regio und machte somit die sogfältige Planung des Festival Verdi kaputt, das sein 25jähriges Jubiläum im Zeichen Shakespeares begehen wollte. Vielleicht liege ich falsch. Aber mir erschien das diesjährige Programm ohnehin etwas bescheiden. Was daran liegen mag, dass das Rahmenprogramm von der Verdi-Street Parade bis zu den unzähligen Verdi-Off Programmpunkten in Lauf der zehn Jahre, die dieses Neben-Festival besteht, immer reichhaltiger wurde. Und Verdi hat eben nicht mehr Opern nach Shakespeare komponiert.
Es bleibt im Jubiläumsjahr also bei drei Opern, im Gegensatz zu vier Opern in zurückliegenden Jahren, davon eine in einer bereits gezeigten Inszenierung. Dies wäre der Falstaff gewesen, mit dem Jacopo Spirei einen Blick ins Brexit-England geworfen hatte, wo sich unter dem Blick von Elisabeth II. nichts zum Guten wendete. Das Thema ist gewichtig: Shakespeare war, neben Schiller und Victor Hugo, der Schwerpunkte in Verdis literarischer Beschäftigung. Die Shakespeare-Bewunderung umspannt Verdis gesamtes Schaffen und mehr als ein halbes Jahrhundert vom frühen Macbeth (1847) bis zum späten Otello (1887) und dem Schwanengesang Falstaff (1893), von der Romantik bis zum Anbruch der Moderne, von der Belcanto-Oper bis zum Musikdrama. Vom politischen Drama, in das kein Lichtstrahl fällt, bis zur dunklen Eifersuchtstragödie des Otello, mit dem, wie der künstlerische Leiter Alessio Vlad unterstreicht, Verdi gar bis zum Expressionismus vorstieß.
Für seine erste Oper nach einem Stück des verehrten Shakespeare hatte Verdi 1846 noch selbst das Prosa-Szenarium mit den Höhepunkten des Dramas mit der Prophezeiung der Hexen, dem Mordplan, der Ermordung des Königs Duncan, dem Bankett und der Nachtwandelszene entworfen. Der von Verdi bereits bei Ernani und I due Foscari beschäftigte Francesco Maria Piave brachte das Gerüste in Reime und stellte das Libretto fertig. Verdi war unzufrieden und demütigte Piave, indem er Andrea Maffei für Korrekturen heranzog. Bei den anschließenden, reich dokumentierten Proben im Frühjahr 1847 in Florenz kümmerte sich Verdi, der im Vorjahr aufgrund eines Burnout noch ein halbes Jahr pausieren musste, um alles, feilte an allem und jedem sowohl bei szenischen wie musikalischen Belangen und erwies sich erstmals als der Mann des Theaters, der er fortan blieb. Vor allem die Bankettszene mit der Erscheinung des toten Banquo wollte er mit allen Mitteln der Illusionskunst dargestellt sehen. Die Uraufführung war ein Ereignis. Für Paris arbeitete Verdi die Oper 18 Jahre später um, denn „Es gibt das Stücke“, wie er meinte, „die entweder schwach sind oder, was noch schlimmer ist, gar keinen Charakter haben“.
Das Festival Verdi kehrte im Jubiläumsjahr zur Urfassung von 1847 zurück, die hier bereits 2018 gespielt wurde und durchaus ihre Meriten hat. Acht Jahre später lässt sich die aktuelle Neuinszenierung der Urfassung im Teatro Verdi in Busseto deutlich mit der späteren Version vergleichen, die man aufgrund der gerade erst im Vorjahr gezeigten ersten szenischen Aufführung der (bereits 2020 konzertant gespielten) Versione francese, Paris 1865 noch in bester Erinnerung hat. Diese 1874 in italienischer Sprache erstmals an der Mailänder Scala erklungene Fassung hat sich seither durchgesetzt. Die Cabaletta der Lady zu Beginn des zweiten Aktes „Trionfai“ ersetzte Verdi später durch „La luce langue“. Neben dem Duett Lady/ Macbeth „Ora di morte“ anstelle der Cabaletta „Vada in fiamme“ des Macbeth im dritten Akt, besteht die wesentliche Änderung im neuen Finale mit der abschließenden Schlachtfuge statt der ursprünglichen Szene des Macbeth „Mal per me“.
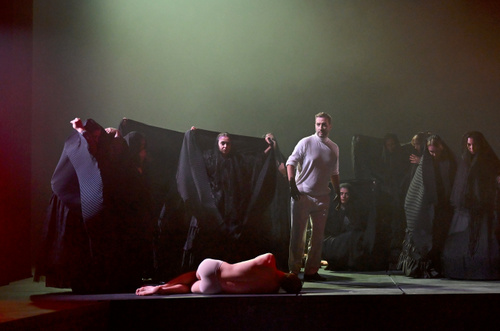
Verdi Festival Parma 2025: Verdis „Macbeth“ 1847/Szene/Roberto Ricci Teatro Regio di Parma
Bei der Aufführung im kleinen Teatro Verdi in Busseto (4. Oktober) hätte man vielleicht erwartet, dass Regisseur Manuel Renga, in Erinnerung durch seinen hiesigen Falstaff sowie Chiara e Serafina beim Donizetti Festival, mit den technischen Möglichkeiten und Gegebenheiten eines historischen Theaters arbeitet, wie sie Verdi im Teatro della Pergola mit den dortigen Versenkungen ausnützte, stattdessen umrahmt er den Orchestergraben durch eine großzügige, von den Akteuren bespielte Treppenanlage, wodurch das Orchester quasi zum Träger der Handlung wird. Das ist ganz geschickt, denn Francesco Lanzillotta lässt den Macbeth in der ganzen knarzigen Wildheit aus Verdis frühen Jahren erklingen, hat aber den Nachteil, dass der ohnehin unglaublich kleine Zuschauerraum durch wegfallende Reihen zusätzlich verkleinert wird. Aus der Loge ist das wunderbar anzusehen, denn wir sind ganz nah am Geschehen und die Sänger streifen mit ihren Kostümen fast über unsere Brüstung. Besonders wirkungsvoll erscheint die Szene beim Hexensabbat, als Macbeth neuerlich die Wesen befragt und erfährt, dass ein von einer Frau Geborener ihn töten und er regieren werde, bis sich der Wald von Birnam auf ihn zubewegt, sowie die anschließende Prozession der acht Könige. Obwohl die Stimmen der Erscheinungen aus einer Loge kommen und die Könige durch ein Schatten- und Puppenspiel illustriert werden, blicken Macbeth und die Hexen tief in den Graben, wo die Musik das Drama entzündet und das Phantastische in die Realität eindringt. Regisseur Renga hält sich nicht mit tiefenpsychologischen Schachzügen auf und stellt das Übernatürliche ins Zentrum, die schwarzen Frauen, die mit allerlei Gerätschaften, Schattenfiguren, Seilen und Schriftstücken in die Vergangenheit und Zukunft blicken können: „Vaticinio“ sagt die Leuchtschrift quer über der Waldszene mit den Hexen, die „Prophezeiung“ erfüllt sich, bestimmt zugleich die Realität, die Rengas Ausstatter Aurelio Colombo mit zeitlosen Kostümen in eine weiße Kastenbühne packt, wo die Lady auf den Gatten wartet, wo Duncans nackter Körper aufgebahrt ist, wo das Bankett stattfindet und Macbeth den Teufel und die Mächte der Hölle selbst zu sehen glaubt; dazu eine Waschschüssel mit schwarzer Flüssigkeit, in der sich Macbeth und die Lady die Hände so schmutzig machen, dass sie nie wieder sauber werden. Das ist sinnfällig, einfach, wirkungsvoll. Lanzillotta zaubert mit dem Chor des Teatro Regio di Parma und dem Orchestra Giovanile Italia mit der ganzen Überwältigungskunst, zu der Verdi fähig ist. Gespielt wurde die kritische Edition von David Lawton. Das ergibt nicht nur im ersten Finale einen Raumeffekt von vibrierender Intensität und Dichte, der die Zuschauer in das Geschehen hineinzoomt, sondern zeigt, wie Verdis moderne psychologisierende Anlage in Belcantoschablonen eindringt und wie gestisch motiviert seine Musik ist. Rau, grell, aber auch federnd und elegant. Der von Mozart und Rossini kommende Baritono nobile Vito Priante ist die richtige Besetzung für die Titelrolle, die er erstmals sang. Die sicherlich recht konventionelle, doch wiederum sehr schöne Cabaletta „Vada in fiamma“ gewinnt durch einen Sänger dieses Typs an Überzeugungskraft, darüber hinaus besitzt der Bariton eine durchgehend dunkle und reiche Substanz, die auch den reflektierenden Momenten gerecht wird. Maria Cristina Bellantuono gelingt als Lady ein Kraftakt, der nicht überall möglich scheint. Die 33jährige aus Bari stammende Sopranistin hält sich nicht bei kleinen Rollen auf, hat schon vor zwei Jahren im dortigen Teatro Petruzzelli Turandot gesungen und macht deutlich, dass Verdis erste Lady eine überragende Koloraturvirtuosin war, so markant klingen die Gruppetti, kristallin die Verzierungen und gestochen klar die Höhen in „Vieni t’affretta“ und der Arie „Or tutti sorgete“ sowie in der hochromantisch virtuosen Arie „Trionfai“, doch die Partie ist auch kräftezehrend strapaziös, wodurch die ohnehin erkämpfte Mittellage und Tiefe vielfach noch trotziger klingt. Eine Wucht ist der 31jährige Adolfo Corrado, dessen voluminöser, tiefschwarzer Bass, unerschütterlich wie eine Klangsäule steht. Matteo Roma, der den Macduff sang, dürfte sich eher im lyrischen Fach wohlfühlen, während Francesco Congiu als Malcolm Potenzial für die italienische jungen Helden von Puccini und Verdi erkennen ließ. Markant die in Pesaro ausgebildete Melissa D’Ottavi als tonschöne Dama di Lady Macbeth.
.
Mit Otello war Verdi erstmals nach langer Unterbrechung wieder zu Shakespeare zurückgekehrt. Nach sechsjähriger, anhand Verdis Briefwechsel mit Boito reich dokumentierter Entstehungszeit und 16 Jahre nach seiner letzten Oper (Aida 1871) kam es, abgesehen von den Neufassungen des Simon Boccanegra und Don Carlos, wieder zu einer veritablen Premiere, die sich für den 74jährigen Verdi am 5.2.1887 an der Mailänder Scala zu einem Triumph gestaltete. Fünf Monate später erklang die Oper bereits in Parma, wo Roberto Abbado sie zur Eröffnung des Festival Verdi jetzt erstmals in der von Linda B. Fairtile besorgten neuen Edizione critica dirigierte, ohne einen ähnlich starken Eindruck wie der Macbeth-Kollege zu hinterlassen. Mit der Filarmonia Arturo Toscanini warf Abbado einen, vielleicht auch beeinflusst von der Inszenierung, kühl analytischen Blick auf das Werk, zu dem er keine Beziehung aufzubauen scheint. Die Konversationsszenen, Rede und Gegenrede in den Szenen Otellos mit Desdemona sowie in Jagos Momenten mit Cassio und Rodrigo, wirken merkwürdig gestelzt, ein großer dramatischer Fluss aus geballten Chorszenen, deklamatorischen Monumenten und ariosen Blöcken stellte sich nicht ein, selbst der formidable Chor des Teatro Regio wirkte in der Sturmszene zu Beginn oder im großen Concertato des dritten Akts wie ausgebremst. Erst im vierten Akt stellte sich eine Dringlichkeit und Wort-Musik-Einheit ein, die der Aufführung ansonsten so ganz abging. In der zweiten Aufführung (5. Oktober) sprang Jusif Eyvazov für den indisponierten Fabio Sartori ein. Dieser Otello ist ein erfahrener Feldherr, der schon viele Schlachten geschlagen hat, das Timbre ist etwas gräulich geworden, die Klangqualität wirkt nicht mehr einheitlich glänzend. Eyvazov ist ein routinierter, robuster, doch genauer Otello, der sich den dramatischen Herausforderungen in die Arme wirft, die Monologe scharf meißelt, während die Pianopassage („Venere splende“) nicht seine Sache sind. Für die Desdemona hat Mariangela Sicilia einen engelsgleich duldenden Lirico-Spinto- Sopran mit einem edlen Silberstreifen in der Höhe, während Mittellage und Tiefe nicht von gleicher Qualität und Substanz sind. Der Höhepunkt ist zweifellos Ariunbaatar Ganbaatar, ein Stimmwunder wie sein unwesentlich älterer mongolischer Landsmann Amartuvshin Enkhbat. Ganbaatar singt mit noch weicherem Legato, eindringlicherer Textbehandlung, und er ist ein guter Schauspieler. Der häufig von ausgeprägten Charakterstimmen gesungene Jago wirkt durch Ganbaatars sinnlichen Schöngesang noch abgefeimter, noch abgrundtief böser. Der in Parma, wo er bereits den Riccardo sang, geförderte Davide Tuscano ist als Cassio Inbegriff des nice guy. Wie all den vor ihr gesungenen Vertrauten und Freundinnen gab Natalia Gavrilan auch der Emilia starkes Profil.
.

Verdi Festival Parma 2025: Verdis „Otello“ 1847/Szene/Roberto Ricci Teatro Regio di Parma
Bei den Eröffnungspremieren setzt das Festival Verdi lieber auf die vertrauten Handschriften von Regisseuren wie Pizzi, Kokkos, de Ana, Lievi oder Audi als die Buhgewitter bei Jung-RegisseurInnen wie Carrasco oder Duos vom Kaliber Ricci/Forte zu riskieren. Nach diesem Muster fiel Otello in die Hände des verdienten Schauspiel-Regisseurs Federico Tiezzi, der ab den 1990er Jahren auch Opern inszenierte, darunter den Simon Boccanegra an der Berliner Staatsoper. Tiezzi verhielt sich unauffällig, beschriftete die schwarzen Bühnenwände mit zentralen Begriffen wie „morte“, „nulla“, „fazzoletto“ und „dolore“, die vom Regen teilweise wieder wegwischt werden, und ließ Clowns und Tänzer venezianische Lockerheit verströmen. Der schwarze Kasten trägt eindeutig die Handschrift der einstigen Ronconi-Mitstreiterin und stilprägenden Szenografin Margherita Palli. Die Altmeisterin stattete ihn mit Leuchtstelen und -tafeln, Podesten und Tischen auf eleganten Rahmen puristisch aus, unterteilte ihn gelegentlich durch rote Vorhänge oder gab durch eine schmale Öffnung den Blick auf den Weltraum frei. Im dritten Akt weisen kämpfende oder zum Sprung ansetzende Raubtiere in Museumsvitrinen, zwischen denen der Chor in Konzertkleidung Aufstellung nimmt, auf die Zerrissenheit der Handlung hin. Erst im vierten Akt, der sich inmitten der weiten, leeren Bühne auf ein kleines, modernes Zimmer konzertiert, in dem nur Desdemona und Otello Platz haben, kommen sich Musik und Drama nahe. Der Raum wird nahezu zur Gänze von einem Bett samt bespanntem Kopfteil ausgefüllt, wie es in vielen Schlafzimmern Parmas stehen könnte, und schimmert im grünlich diffusen Licht eines Edward Hopper, wobei Tiezzi die Mischung aus Traum und Realismus in den Fotos von Gregory Crewdson als Anregung nennt. Rolf Fath
.
.
Bayreuth Baroque Opera Festival: Lustvolles Barock-Spektakel. Im nach stilvoller Restaurierung 2018 wieder eröffneten Markgräflichen Opernhaus von Bayreuth gibt es seit 2020 alljährlich im Spätsommer ein Festival, das der Countertenor Max Emanuel Cencic gegründet hat. Neben seiner Funktion als Intendant wirkt er auch als Sänger und Regisseur, ist der Spiritus rector des Unternehmens, welches sich vor allem der Opera seria des frühen 18. Jahrhunderts widmet. Nach Werken von Porpora, Vinci, Vivaldi, Monteverdi und Händel in den vergangenen Jahren stand in dieser Saison der in Venedig wirkende und dort 1676 gestorbene Komponist Francesco Cavalli im Mittelpunkt des Programms, womit man einen Schritt zurück in das 17. Jahrhundert ging.
Die Festspieleröffnung galt dem Dramma per musica von 1666 Pompeo Magno, einer venezianischen Karnevalsoper. Die in Rom verortete Handlung um Konsul Pompeo und Issicratea, Königin von Ponto, sowie deren totgeglaubten Gemahl Mitridate und Sohn Farnace verlegte Cenic nach Venedig mit seinem bunten, ausgelassenen Karnevalstreiben, bevölkerte die Szene mit vielerlei Figuren, die man von den Straßen der Lagunenstadt kennt – Damen, Kavaliere, Kurtisanen, Nonnen, Kleriker, Intriganten, verwirrte Alte, Kleinwüchsige. Letztere sorgten en travestie mit zur Schau gestellten üppigen (Stoff-)Brüsten für besonderes Aufsehen. Corina Gramosteanu hatte aber auch Kostüme von opulenter Eleganz geschaffen mit edlen Materialien, stilvollen Ornamenten und subtilen Farben. Die Welt der Commedia dell´arte wurde lebendig in Kleidung und Masken, in drastischen erotischen Details, aber auch im turbulenten Treiben der Akteure. Sie alle – Sänger wie Komparsen – waren mit totalem Einsatz, atemberaubendem Tempo, ansteckender Spielfreude und imponierender körperlicher Agilität dabei. Chiara d´Anna als Bewegungscoach hatte vorzügliche Arbeit geleistet, für jede Figur das für sie typische Bewegungsvokabular gefunden. Auf Venedig stimmte auch Helmut Stürmers Bühne mit ihrem Portal, über dem der venezianische geflügelte Löwe thront, und einem Saal mit Säulen, Podesten und bunten Glasfenstern ein.

Cavalli „Pompeo Magno“ Bayreuth Baroque 2025/ Foto © Clemens Manser Photography
Ein exzellentes Ensemble brachte Cavallis Musik mit Elan und Vitalität zum Klingen. Nicht weniger als acht Countertenöre mit Vertretern aus mehreren Generationen waren vertreten, darunter das Urgestein der Gattung Dominique Visse, der als Diener Delfo wie stets lustvoll krähte. Dagegen war der Italiener Nicoló Balducci als Pompeos Sohn Sesto ein Newcomer und mit seiner klangvollen, ausgewogenen Stimme sowie den bravourösen Koloraturläufen mehr als willkommen. Im schwarz/goldenen, reich verzierten Wams war er auch optisch ein Blickfang. Zur jüngeren Generation zählt auch der österreichische Counter Alois Mühlbacher, der als Issicrateas und Mitridates Sohn Farnace im weißen Pierrot-Kostüm jugendlich keusche Klänge einbrachte und später auch noch als halbnackter Amor mit weißen Flügeln und knappem Lendenschurz auftrat. Renommiert ist Valer Sabadus durch seine zahlreichen Tondokumente und Auftritte bei Musikfestivals. Auch bei Bayreuth Baroque war er schon zu Gast. Hier sang er solide den Servilio und hatte Gelegenheit für muntere Liebesspiele mit seiner angebeteten Giulia, Tochter des römischen Konsuls Cesare, im großen Doppelbett. Charaktervolle stimmliche Counter-Momente brachten Kacper Szelazek als exaltiert grölende Arpalia, Issicrateas Dienerin, sowie Pierre Lenoir und Angelo Kidoniefs als Primo und Secondo Prencipe ein.
In der Titelrolle gab Max Emanuel Cencic keinen virilen, auftrumpfenden Helden, sondern einen gebrechlichen alten Mann mit weißem Haar, was zur stimmlichen Verfassung des Counters harmonierte. Doch nach verhaltenem Beginn gewann die Stimme an Fülle und Durchschlagskraft, gefiel besonders im sanften Schlaflied („Sonno, placido nume“) am Endes des 1. Aktes. Zwei Damen werden heiß umworben in diesem Stück. Pompeo begehrt Giulia, deren. Herz jedoch Servilio gehört. Die belgische Sopranistin Sophie Junker sang sie mit schöner lyrischer Substanz bei lebhaftem Agieren. Sesto wirbt vergeblich um Issicratea, die ihrem Gemahl Mitridate die Treue hält. Die Argentinierin Mariana Flores war die Primadonna des Abends und trug gebührend hoheitsvolle Roben. Mit flammendem, strengem Sopran von resoluter Attacke und fulminantem Ausdruck sowie einem vehementen Koloraturfeuerwerk setzte sie sich souverän an die Spitze des Ensembles. Der italienische Tenor Valerio Contaldo formte ein eindrückliches Porträt des Mitridate, der Arpalia tötet, am Ende aber seine Tat gesteht und von Pompeo begnadigt wird. Die baritonal getönte Stimme sorgte mit virilem Duktus in der Arie „Tormentosa gelosia“ für einen vokalen Höhepunkt.
Die Besetzung ergänzten der niederländische Charaktertenor Marcel Beekman, der als die verrückte Alte Atrea ein Kabinettstück bot und kicherte, winselte, keifte, der britische lyrische Tenor Nicholas Scott, der als Claudio, Sohn des Cesare, in „Rendimi la mia pace“ nachdrücklich auftrumpfte, und der begabte junge Bariton Victor Sicard als Cesare. Am Ende gibt es einen fröhlichen, jauchzenden Abgesang, den Farnace anstimmt und der den glücklichen Ausgang preist („Imparate, o mortali“).
Leonardo García-Alarcón spornte hier mit seiner Cappella Mediterranea, die er 2005 gegründet hatte, alle Sänger noch einmal an. Seine Leitung voller Energie und Schwung trug den vierstündigen Abend, was ihm und den Mitwirkenden am Ende euphorische Publikumsovationen bescherte. Das Residenzorchester des Bayreuth Baroque Opera Festival 2025 hatte mit seinem Musizieren voller Spannung und Klangreichtum immer wieder begeistert – mit festlichem Bläserglanz, federnden Rhythmen, majestätischen Märschen, aber auch lyrischen Inseln und kammermusikalischer Delikatesse in den Ritornellen (6. 9. 2025).
.
 Das Orchester mit seinem argentinischen Dirigenten begleitete auch mehrere Solisten bei ihren Konzerten, welche traditionell zum Festival gehören. Am 5. September war der italienische Countertenor Carlo Vistoli mit seinem Programm Opera Antica zu erleben. Konzeptionell korrespondierte der Abend mit der Cavalli-Oper, bot er doch Werke von Zeitgenossen des Komponisten, wie Antonio Cesti, Claudio Monteverdi und Alessandro Stradella. Reizvolle instrumentale Einlagen – u.a. eine Sinfonia aus Cavallis Erismena, die Xácara del primer tono von Lucas Ruiz de. Ribayaz, die Tarantela von Santiago de Murcia und die Ciacona in B-Dur von Antonio Caldara – sorgten für vielfarbige Klänge, rasante Steigerungen und melancholische Episoden.
Das Orchester mit seinem argentinischen Dirigenten begleitete auch mehrere Solisten bei ihren Konzerten, welche traditionell zum Festival gehören. Am 5. September war der italienische Countertenor Carlo Vistoli mit seinem Programm Opera Antica zu erleben. Konzeptionell korrespondierte der Abend mit der Cavalli-Oper, bot er doch Werke von Zeitgenossen des Komponisten, wie Antonio Cesti, Claudio Monteverdi und Alessandro Stradella. Reizvolle instrumentale Einlagen – u.a. eine Sinfonia aus Cavallis Erismena, die Xácara del primer tono von Lucas Ruiz de. Ribayaz, die Tarantela von Santiago de Murcia und die Ciacona in B-Dur von Antonio Caldara – sorgten für vielfarbige Klänge, rasante Steigerungen und melancholische Episoden.
Vistoli besitzt (für mich) den schönsten Countertenor unserer Zeit. Die Stimme ist rund, weich, warm und ausgeglichen, kann zärtlich schwärmen, ergreifend klagen, aber auch männlich auftrumpfen. Im ersten Teil stellte er Szenen aus fünf Opern Cavalliis vor, beginnend mit dem Lamento des Apollo aus Gli amori di Apollo e Dafne, bei dem die Stimme sogleich in ihrem Wohllaut. berührte. Ein schöner Wechsel dazu war der freudige Überschwang des Xerse, „Ombra mai fu“, aus der gleichnamigen Oper, die zu Händels getragener Version einen starken Kontrast bildete. Immer wieder wechselten die Emotionen – ob im flehentlichen Lamento des Idraspe aus Erismena, der heiteren Arie des Giasone, „Delizie, contenti“, aus der gleichnamigen Oper oder der inbrünstigen Arie des Endimione, „Lucidissima face“, aus La Calisto. Aus Monteverdis Poppea stellte Vistoli zwei Szenen des Ottone vor – das schwärmerische „E pur io torno“ und das verzweifelt klagende „I miei subiti sdegni“. Der affektreiche Gesang des Solisten und seine vorbildliche Wortbehandlung imponierten immer wieder – so in der erregten Arie des Alidoro aus Cestis L´Orontea oder in zwei Szenen des Nino aus Stradellas Il Trespolo tutore. Da gab es im Dialog mit der Flöte auch bravouröse Koloraturgirlanden zu hören und am Ende in der Wahnsinnsszene des Nino ganz sanftes, entrücktes Verlöschen. Zwei Gesänge von Monteverdi – „Voglio di vita uscir“ und „Si dolce è ´l tormento“ – als Zugaben beendeten diesen beglückenden Abend im Markgräflichen Opernhaus. Bernd Hoppe .
.
Pacinis Amazilia bei Festival Il Belcanto Ritrovato im italienischen Fano (Apulien): Vor fast genau zweihundert Jahren, am 6. Juli 1825, wurde Giovanni Pacinis Oper Amazilia im Teatro San Carlo in Neapel mit einer wirklich bemerkenswerten Besetzung aufgeführt.
Nun, am 23. August 2025, wurde die Oper im Rahmen des jährlichen Festivals Il Bel Canto Ritrovato (IBR) im Teatro della Fortuna in Fano, Italien, zum ersten Mal in einer vollständigen modernen Aufführung wiederbelebt. Das IBR möchte das umfangreiche Erbe der italienischen Oper erkunden, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde, einer Zeit, in der selbst das kleinste Dorf auf der italienischen Halbinsel wahrscheinlich ein Opernhaus hatte und das Operngeschäft seinen größten und intensivsten Höhepunkt erreichte.
Amazilia mit einem Libretto von Giovanni Schmidt, hat eine interessante und verworrene Geschichte, wie ich an anderer Stelle geschrieben habe(dazu auch die beiden Artikel in operalounge.de, s. am Ende), und lag Pacini offensichtlich sehr am Herzen Pacini sehr am Herzen, da sie während der Flitterwochen des Komponisten mit seiner ersten Frau geschrieben wurde und er sein zweites Kind nach der Heldin benannte. Pacini, der während seiner langen Karriere fast 80 Opern schrieb, war 29 Jahre alt, als er Amazilia komponierte; es war seine 28. Oper.

Pacinis „Amazilia“ bei Festival Il Belcanto Ritrovato 2025 in Fano/Konzertausschnitt/Foto Luigi Angelucci
Die beeindruckende Besetzung der Oper bei ihrer Uraufführung 1825 in Neapel im Rahmen der Geburtstags-Feierlichkeiten für die bourbonische Königin Maria Isabella umfasste den Tenor Giovanni David als Zadir, den Bass Luigi Lablache als Cabana und die Sopranistin Joséphine Fodor-Mainvielle als Amazilla selbst. Ihre Virtuosität macht eine Wiederaufführung der Oper heute schwierig, da nicht viele Sänger die Musik, die Pacini dem Original-Cast zu singen gab, bewältigen können.
Ursprünglich ein Einakter, wurde die Oper 1827 in Wien in einem erweiterten Format mit einer neu komponierten Ouvertüre und zwei neuen Gesangsnummern präsentiert und in zwei Akte unterteilt. Es war diese Fassung, die in Fano vom Bel Canto Ritrovato in einer neuen kritischen Ausgabe von Gianmarco Rossi aufgeführt wurde.
Die einfache Story, die in Florida spielt, handelt von der Rivalität zweier Stammesführer, Cabana und Zadir, um die Hand von Amazilia, einer indianischen Jungfrau, die zum Stamm von Cabana gehört. Die spanischen Konquistadoren schweben im Hintergrund und sorgen für einen Deus ex machina, um die Rivalität beizulegen und ein glückliches Ende herbeizuführen, nachdem Zadir einen Kampf gegen Cabana verloren hat und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll.
Da das Werk für die Geburtstagsfeier einer Königin mit spanischer Abstammung geschrieben wurde, diente das Lob der spanischen Weisheit und Friedensstiftung unter den Konquistadoren, so ungerechtfertigt es auch war, als nicht allzu subtile Art, der Königin ein Kompliment zu machen, und auch als Möglichkeit, die Geschichte an der berüchtigten neapolitanischen Zensur vorbeizuschmuggeln, die Monate zuvor ein ähnlich benanntes Pastiche verboten hatte
.In vielerlei Hinsicht ist Pacini der faszinierendste der weniger bekannten Opernkomponisten im Italien des 19. Jahrhunderts, weil er zu seiner Zeit so beliebt war und weil er so viel geschrieben hat; bei Pacini gibt es eine Menge Musik für Musikwissenschaftler und Opernhäuser zu entdecken, die mutig genug sind, etwas anderes zu versuchen, als immer wieder dieselben wenigen Titel zu recyceln. Die Musik von Amazilia bietet viele wunderbare Momente, und selbst manche eher formelhaften Passagen sind melodiös.

Pacinis „Amazilia“ bei Festival Il Belcanto Ritrovato 2025 in Fano/Konzertausschnitt/Foto Luigi Angelucci
Man könnte mit der völlig unbekannten Sinfonia beginnen, die Pacini für Wien schrieb, weil die Wiener erwarteten, dass eine Oper eine vollständige, formelle Ouvertüre haben sollte. (Donizetti musste derselben Tradition folgen.) Die Sinfonia in diesem Fall ist absichtlich rau und laut und voller Kesselpauken, vielleicht als Vorahnung der Welt der Indianerstämme, deren Konflikte die Grundlage der Geschichte bilden, aber sie ist gut aufgebaut und zweifellos eine Verbeugung vor dem symphonischen, „germanischen” Musikgeschmack der Österreicher. Einige der langsamen Stücke sind ebenfalls bestens komponiert und einprägsam, wie zum Beispiel Zadies eröffnende Cavatina „Come mai calmar le pene” und Amazilias wunderschöne „Ah! Non fia mai ver”.
Pacini wurde wegen seiner Kreativität und seiner Gewandtheit in dieser Form als „Maestro delle Cabalette” bekannt, und die Cabaletten in Amazilia sind immer eingängig und interessant aufgebaut, angefangen mit Cabanas „Paventi il perfido”. Zadirs „Io ti vidi, t’adorai” war so beliebt, dass Mauro Giuliani ein Thema und Variationen für Gitarre darauf komponierte. Und während wir Cabaletten normalerweise als schnelle Stücke betrachten, die im Kontrast zu den langsamen Cantabiles einer Cavatina oder einer Arie stehen, war Pacini seinen Komponistenkollegen um Jahre voraus, als er die doppelt so schnelle Cabaletta „Parmi vederlo” schrieb, ein Jahrzehnt, bevor Donizetti eine langsame Cabaletta für das Finale seiner Lucrezia Borgia komponierte. „Parmi vederlo” beginnt mit einem traurigen Adagio, gefolgt von einer teuflisch schwierigen schnellen Koloratur, die Amazillas Qualen wirkungsvoll zum Ausdruck bringt, als sie glaubt, dass Zadir auf den Scheiterhaufen kommen wird „Parmi vederlo” war so beliebt (und ungewöhnlich), dass es Sopranistinnen wie Giuditta Pasta und Giulia Grisi als „Aria di baule” diente, die es in verschiedene Opern einfügten, in denen sie auftraten. Selbst in unserer Zeit hat Beverly Sills es in ihre Aufführungen von Rossinis Assedio di Corinto aufgenommen; es ist in der kommerziellen Sills-Aufnahme der Oper erhalten geblieben, aber Pacini wird als Urheber nicht genannt…
In Amazilia gibt es keine großartigen Ensembles, wie sie Rossini in den 1810er und 1820er Jahren schrieb, aber das Trio für die drei Hauptdarsteller, das in der Zwei-Akt-Fassung als Finale des ersten Aktes dient, ist spannend und angemessen klimatisch. Das kleine finaletto, das die Oper beendet, ist jedoch etwas enttäuschend, ebenso wie das gesamte lieto fine mit seinem absurden Lob der spanischen Konquistadoren. Tatsächlich kann sich Amazilia nie ganz von ihrem ursprünglichen Zweck als Geburtstagsgeschenk für Königin Maria Isabella lösen. Am Ende hat man das Gefühl, dass der Komponist und sein Librettist eine willkürliche Frist für ihr Werk erreicht hatten und das Drama schnell beendeten, damit die Königsfamilie weiter essen und trinken konnte, wodurch die Oper ziemlich unerwartet und abrupt endet.
.Das IBR versammelte eine Gruppe talentierter junger Sänger für ihre einzige Aufführung. Amazilia selbst wurde von Paola Leoci gesungen, die sich durch ihre technische Meisterschaft und ihr engagiertes Einbringen in die Rolle auszeichnete. Leoci hatte gerade die weibliche Hauptrolle der Fanni in La cambiale di matrimonio beim Rossini-Festival gesungen. Sie passte die Soubretten-Stimme, die sie für Fanni in der leichten Komödie verwendet hatte, erfolgreich an die dramatischeren Anforderungen und die größere Beweglichkeit an, die für Amazilia erforderlich waren. Ihre atemberaubende Darbietung der teuflisch schwierigen Koloratur in „Parmi vederlo” konnte sich durchaus mit der von Sills aufgenommenen Version messen – und diesmal wussten wir, dass sie von Pacini stammte.

Pacinis „Amazilia“ bei Festival Il Belcanto Ritrovato 2025 in Fano/Schluss-Applaus/Foto Luigi Angelucci
Wenn die Rolle der Amazilia für jede Sängerin eine Herausforderung darstellt, dann ist die Tenorrolle des Zadir, die für Giovanni David geschrieben wurde, vielleicht noch schwieriger. Das IBR gab uns Manuel Amati, der die extrem hohen Töne sang und die schwierige Koloratur meisterte, für die David berühmt war, obwohl Amati eine eher kleine Stimme besitzt. Bass Giorgio Caoduro vervollständigte das Trio der Hauptdarsteller als Cabana. Auch seine Rolle ist extrem schwierig; der ursprüngliche Cabana, Luigi Lablache, war der berühmteste Bass in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Caoduro begann etwas zögerlich, da er sofort mit einer großen Arie mit einer technisch anspruchsvollen Cabaletta konfrontiert war, wurde aber im Laufe der Aufführung immer stärker und sicherer; er war sehr gut in seinem „Wiener” Duett mit Amazilia, „Tu sprezzar gli affetti miei”. Die Nebenrollen wurden von Mariano Orozco (Orozimbo), Naomi Umani (Mila) und Michele Albiati (Alvaro) wahrgenommen. Das Orchestra Sinfonica G. Rossini und der Chor des Teatro della Fortuna in Fano wurden von Enrico Lombardi geleitet. Lombardi hauchte Pacinis vergessener Musik neues Leben ein und zeigte uns einen Komponisten, der trotz seines Rufs, es mangele ihm an „Wissenschaft”, es verstand, interessante Orchesterwerke zu schreiben.
.Die Inszenierung war leicht halbszenisch, d. h. sie war mehr als ein reines Konzert mit Sängern, die vorne auf der Bühne standen, aber weniger als eine szenische Aufführung ohne Kulissen und Kostüme. Tomasso Casadei sorgte für passende Hintergrundprojektionen der im Libretto beschriebenen Schauplätze, darunter Floridas „bergiges” Gelände, eine Beschreibung, die jeden, der schon einmal in Florida war, zum Schmunzeln bringen dürfte.

Festival Il Belcanto Ritrovato in Fano: Die Macher mit Hausherrn/Intendanten Rudolf Colm in der Mitte/Foto Luigi Angelucci
Es ist unwahrscheinlich, dass Amazilia jemals außerhalb eines Festivals aufgeführt wird, da es sich um ein Geburtstagsgeschenk für einen längst vergessenen Monarchen handelt, das Werk ein abruptes Ende hat und es schwierig ist, Sänger zu finden, die die Musik singen können. Dennoch enthält es viele musikalische Juwelen, und die Aufführung trug dazu bei, unser Verständnis für einen Komponisten zu vertiefen, der zu lange im Schatten stand. Chronologisch gesehen liegt die Oper in Pacinis Karriere zwischen Alessandro nelle Indie (die in Neapel häufiger aufgeführt wurde als alle Opern, die Rossini für diese Stadt schrieb) und seinem L’ultimo giorno di Pompei, einem noch größeren Erfolg. Als solche ist sie Teil eines Trios, das den ersten Teil von Pacinis sehr fruchtbarer Karriere krönt.
Die Aufführung wurde von Bongiovanni aufgezeichnet und soll in etwa einem Jahr erscheinen. Zum ersten Mal hat das IBR eine kritische Ausgabe seiner Hauptoper herausgebracht, die in diesem Fall von dem hervorragenden jungen Musikwissenschaftler Gianmarco Rossi erstellt wurde – ein wirklicher Beitrag zur Musikwissenschaft.
.
Das IBR-Festival bestand nicht nur aus Amazilia. Es gab zahlreiche Konzerte und Vorträge rund um Pacini, aber die Konzerte umfassten auch faszinierende Musik von anderen Komponisten, die heute noch unbekannter sind als Pacini. Es gab ein Konzert mit Orchesterauszügen aus Opern, die an der Scala uraufgeführt wurden, aber von sizilianischen Komponisten geschrieben worden waren; mehrere davon waren Werke von Pacini – Il barone di Dolsheim (1818), La vestale (1823) und I cavalieri di Valenza (1828). Giulias Arie mit Harfe „Io son rea, né imploro” aus La Vestale war äußerst schön, die beste von allen.

Festival Il Belcanto Ritrovato 2025: Nicola Vaccai (* 15. März 1790 in Tolentino bei Ancona; † 5. August 1848 in Pesaro) war einer der aufgeführten Komponisten/Wikipedia
Aber es gab auch Stücke aus Mario Aspas I due Savoiardi (1838), Pietro Coppolas La festa della Rosa (1836) und Placido Mandanicis Il Buontempone di Porta Ticinese (1841). Coppola ist ein Komponist, der viel mehr Beachtung verdient; ein weiteres seiner Werke, Nina pazza per amore, war ein großer internationaler Erfolg und zu seiner Zeit ein größerer Kassenschlager als jede Oper von Rossini, während Mandanicis unwiderstehlicher Il Buontempone voller mitreißender Musik ist und Mailand auf einzigartige Weise feiert, so wie viele andere Opern untrennbar mit Rom, Venedig oder Neapel verbunden sind. Dieses Konzert wurde gekonnt begleitet vom Orchestra Sinfonica G. Rossini unter der Leitung von Daniele Agiman. Agiman war so begeistert von dem Trio aus Il Buontempone di Porta Ticinese, mit dem das Konzert endete, dass er selbst eine Zugabe (Encore) des gesamten Stücks forderte, noch bevor das Publikum dies tun konnte, und die drei talentierten Sänger der La Scala Accademia (Fan Zhou, Aldo Sartori und Sung Hwan Park) sangen es erneut. Das Publikum war begeistert.

Festival Il Belcanto Ritrovato 2025: Pietro Antonio Coppola (* 11. Dezember 1793 in Castrogiovanni; † 13. November 1877 in Catania)war einer der aufgeführten Komponisten/Wikipedia
Ein Open-Air-Konzert im Innenhof mit Blick auf das Haus von Nicola Vaccai feierte Werke von vier Komponisten aus Pesaro – natürlich Rossini, aber auch Vaccai und die fast völlig unbekannten Gioacchino Albertini und Vincenzo Federici. Weitere Werke von Pacini waren in einem Konzert zu hören, das seine Opern mit Passagen aus seinen künstlerischen Memoiren verband. Mit anderen Worten: Das IBR bot uns ein reichhaltiges Programm seines Hauptkomponisten Pacini, aber auch Kostproben anderer einst beliebter Opernkomponisten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die in Vergessenheit geraten sind, und erfüllte damit seine Mission, dieses reiche Erbe für das Vergnügen des heutigen Publikums zu erschließen. Das IBR, das nun bereits im vierten Jahr erfolgreich stattfindet, ist auch für den erfahrensten Opernliebhaber wieder eine lehrreiche Erfahrung. CDs mit den Werken des letzten Jahres, Luigi Rossis La casa disabitata und einem Konzert mit Auszügen von Vaccai, sind jetzt beim Label Bongiovanni erhältlich.
Abgesehen von der Figur in der Oper (und dem Namen von Pacinis Tochter) ist „Amazilia” der Name einer Kolibri-Gattung, die denselben Namensstamm hat wie die Heldin der Oper. Das IBR trägt mit seinen zahlreichen wissenschaftlichen und künstlerischen Initiativen dazu bei, dass diese seltenen und farbenprächtigen Geschöpfe wieder fliegen können. Charles Jernigan/DeepL/G.H.
.
Dazu auch bei operlounge.de: Pacinis Kinder sowie Die vergessene Oper: Pacinis Amazilia
.
.
36. Musikfest Bremen: Musikalische Glanzlichter: Halbszenische Opernaufführungen haben eine schöne Tradition beim Musikfest an der Weser. Fast immer sind sie hochkarätig besetzt mit exzellenten Solisten und einem renommierten Dirigenten. Im Konzertsaal Die Glocke stand am 27. 8. 2025 bei Mozarts Die Zauberflöte der junge Finne Tarmo Peltokoski vor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, seit Anfang 2022 Principal Guest Conductor des Orchesters. Seine eminente musikalische Begabung offenbarte sich bereits in der Ouvertüre, die er spannungsvoll und kontrastreich aufbaute. Feierlich und würdevoll erklang die Einleitung zum 2. Aufzug, wobei Transparenz und Schlankheit des Klanges stets gewahrt blieben. Das ChorWerkRuhr (Einstudierung: Michael Alber) absolvierte zuverlässig seine Auftritte von der Empore. Romain Gilbert hatte die Handlung an der Rampe diskret, doch spielfreudig arrangiert, wobei er von Hervé Garys Lichtdesign unterstützt wurde, welches besonders mit den Rot- und Blau-Tönen bei der Feuer- und Wasserprobe Sinn machte.
Ein Salzburg würdiges Ensemble sorgte für einen Abend voller Sängerglanz, angeführt vom Schweizer Tenor Mauro Peter, der den Tamino schon 2018 in der verunglückten Inszenierung von Lydia Steier bei den Salzburger Festspielen gesungen hatte. Sein kultivierter lyrischer Tenor hat mittlerweile an Farbe, Volumen und Kraft gewonnen. Das verhalf der gefühlvoll vorgetragenen „Bildnis“-Arie zu starker Wirkung und erbrachte für „Wie stark ist nicht dein Zauberton“ eine ideale Balance von Virtuosität und Emphase. Eine perfekte Besetzung war auch für seine Pamina gefunden worden, denn Elsa Dreisig wartete mit leuchtendem Sopran, innigem Gefühl und bester Stimmführung auf. Während ihre Ausflüge in das italienische und französische Fach in der Vergangenheit zwiespältig ausfielen, konnte sie hier in ihrem ureigenen Repertoire überzeugen und mit der Arie „Ach, ich fühl´s“ für ein sängerisches Glanzlicht sorgen. Nicht weniger als eine Sensation markierte der Auftritt von Kathryn Lewek als Königin der Nacht. Man muss schon an Edda Moser oder Diana Damrau in ihrer besten Zeit zurückdenken, um ein vergleichbares Niveau zu finden. Mit dunkel grundiertem, fülligem Sopran von warmem Klang konnte sie die mütterlichen Gefühle der Figur plastisch transportieren, mit rasender Attacke, phänomenalen Koloraturläufen und gestochenen staccati gleich Messerstichen ihren Rachefuror verdeutlichen. Von seltener klanglicher Homogenität erklang das Trio der drei Damen mit Silja Aalto, Iris van Wijnen und Marie Seidler. Dies ist auch den Solisten der St. Florianer Sängerknaben zu bescheinigen, die die Gesänge der Drei Knaben wohllautend und intonationsrein vortrugen. Nobel und sonor erklang der schlanke Bass von Manuel Winckhier in Sarastros beiden Arien, mit beeindruckender Autorität im letzten Auftritt des Priesters „Die Strahlen der Sonne“. Der ungarische Bassbariton Marcell Bakonyi gefiel mit potenter, kerniger Stimme als Sprecher und gab darüber hinaus noch den Zweiten Geharnischten, assistiert vom slowenischen Tenor Martin Logar als Erstem. Scharfzüngig und grell charakterisierte Andreas Conrad den Monostatos.
Wie oft war auch hier Papageno ein Publikumsliebling. Der Schweizer Bariton Äneas Humm sang ihn mit angenehmer Stimme, allerdings gespreizt gesprochenem Dialog und überflüssigen Extempores sowie einer gänzlich überflüssigen Einlage mit dem Song „The Sound of Silence“. An seiner Seite war Miriam Kutrowatz eine reizende Papagena – in der Verkleidung als altes Weib zunächst keifend und krächzend, nach der Demaskierung dann aber entzückend singend. Der Abend, welcher in seiner musikalischen Perfektion viele internationale Festspielaufführungen übertraf, wurde vom Publikum gebührend bejubelt.
.
Stets gehören auch Konzertabende mit Interpreten von Weltrang zum Programm des Musikfestes. Am 28. 8. 2025 war Gelegenheit, die finnische Sopranistin Camilla Nylund zu erleben. Das Programm, Von Heldinnen und Helden betitelt, bot zwei der forderndsten Finalszenen der gesamten Opernliteratur: „Starke Scheite“ aus Wagners Götterdämmerung und den Schlussgesang der Salome aus Strauss´ Oper. Zudem war das zweite renommierte Orchester der Hansestadt zu hören – die Bremer Philharmoniker unter ihrem GMD Marko Letonja. Das Konzert markierte eine würdige Feier zum 200. Jubiläum des Klangkörpers. Brahms´ „Akademische Festouvertüre“ war ein schwungvoller Auftakt mit seinen Anklängen an Studentenlieder.
Camilla Nylund hatte als Einstieg Elisabeths Hallen-Arie aus Tannhäuser gewählt, in der die Stimme leicht verhärtet klang. Dann aber Brünnildes Weltabschied in einem silbernen, eng anliegenden Kleid, das die Sängerin umschloss wie ein stählerner Panzer und auch optisch einer Walküre entsprach. Grandios meisterte sie mit ihrem kraftvollen Sopran und unangefochtenen Spitzentönen die lange Szene, dominierte bis zum letzten Moment das Orchester, welches der Dirigent groß aufrauschen ließ.
Nach der Pause Richard Strauss mit seiner „Sinfonischen Fantasie“ aus Die Frau ohne Schatten, welche 1946 entstand und Motive aus dem monumentalen Werk vereint. Klänge, Farben, Lyrismen und Dissonanzen fügten sich in der Wiedergabe des Orchesters zu einem Klangrausch von magischer Wirkung. Auch der nachfolgende „Tanz der sieben Schleier“ aus Salome verfehlte in der lasziven Atmosphäre und orgiastischen Steigerung nicht seinen Effekt. Zweifellos besitzt Nylunds Stimme eine neue Qualität und Dimension, was auch Salomes Schlussgesang bewies. In ihrem Charakter, ihrer Klangfarbe ist sie nicht eigentlich hochdramatisch, wohl aber in ihrer Leistungsfähigkeit. Und so bot sie auch als Salome einen mühelos bewältigten Auftritt von ekstatischer Steigerung und tranceartigem Schluss, der in seiner Tragik tief berührte.
.
Verdienstvoll und vom Publikum hoch geschätzt sind die Veranstaltungen des Musikfestes in Bremens Umgebung. Der prachtvolle Dom zu Verden ist ein solcher Ort, wo am 29. 8. 2025 Mozarts Requiem d-Moll KV 626 erklang. Hochrangige Interpreten der Barock-Szene waren versammelt, so das 1990 von Václaw Luks gegründete Collegium 1704 und das 2005 von ihm ergänzte Collegium Vocale 1704. Der Dirigent entschied sich für die von Eybler und Süssmayr vollendete Fassung des von Mozart als Torso hinterlassenen Werkes. Und er stellte ihm ein hierzulande unbekanntes Stabat Mater von Frantisek Ignác Tuma voran, welches der 1704 geborene böhmische Komponist ca. 1750 schuf. Das Werk von strenger Schlichtheit ist nur sparsam instrumentiert und atmet kaum barocken Geist. Fast mutet es modern an, wie hier alte und neue Stile kombiniert sind. Orchester und Chor beeindruckten mit hoher Klangkultur und das Solistenquartett konnte in zwei Duetten bereits seine Qualität herausstellen, wie es danach bei Mozarts Werk noch deutlicher wurde. Tereza Zimkovás Sopran war von keuschem Klang, der Mezzo von Henriette Gödde dagegen eher von fraulicher Sinnlichkeit. Herausragend war der Tenor von Krystian Adam in seiner Potenz und Substanz, Tomás Selc komplettierte mit einem Bass von warmem, weichem Klang. Der Gesang des Chores war überwältigend, ob im Kyrie mit seiner apokalyptischen Dimension, dem gewaltigen Confutatis maledictis oder dem erhabenen Agnus Dei. Und am Ende überraschten die 17 Sängerinnen und Sänger noch mit einer unbekannten Zugabe – einem frühen A-capella-Werk von Zelenka, das den Abend bewegend und würdig beschloss. Bernd Hoppe
.
.
LGBT in Pesaro 2025: Das Rossini Opera Festival endete mit einer hervorragenden Aufführung der Missa, die Verdi nach Rossinis Tod im Jahr 1868 für ihn organisiert hatte. Sie besteht aus 13 Sätzen, die jeweils von einem anderen Komponisten der damaligen Zeit komponiert wurden (der letzte von Verdi selbst), wurde jedoch zu Verdis Lebzeiten nie aufgeführt und blieb tatsächlich unaufgeführt, bis sie 1970 von David Rosen entdeckt und 1988 in Deutschland aufgeführt (und anschließend aufgenommen) wurde. Sie war zuvor noch nie beim Rossini-Festival aufgeführt worden. Die Qualität der einzelnen Abschnitte ist unterschiedlich, aber der letzte Abschnitt von Verdi, den er später in seine Requiem-Messe für Manzoni übernahm, ist glühend.
Ansonsten bestand das Festival aus drei Hauptopern – der Rarität Zelmira, einer skurrilen Interpretation von L’Italiana in Algeri und Rossinis erster aufgeführter Oper, La cambiale di matrimonio, die zusammen mit seiner Liedersammlung „Soirèes Musicales” aufgeführt wurde.
.

Rossini Opera Festival 2025: „Zelmira“/Szene/Foto Amati Bacciardi
Zelmira wurde mit einer spektakulären Besetzung von Sängern unter der Leitung von Giorgio Sagripanti mit dem Orchester des Teatro Communale in Bologna in einer Inszenierung des spanischen Regisseurs Calixto Bieito aufgeführt. Bieito machte sich zunächst in der Opernwelt einen Namen, indem er Standardwerke auf subversive Weise mit viel Nacktheit, Gewalt und explizitem Sex inszenierte und damit das biedere Opernpublikum in Europa schockierte – ein Quentin Tarantino der Opernwelt. Nun scheint Bieito sich von der Infragestellung westlicher Werte, wie sie in kulturellen Ikonen wie Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ oder Bizets „Carmen“ verkörpert sind, zu einer völlig nihilistischen Welt des unerbittlichen Negativismus und der Sinnlosigkeit weiterentwickelt zu haben.
In dieser Inszenierung von Zelmira gab es keine Nacktheit und die Gewalt wurde gedämpft, aber die Inszenierung untergrub alle Werte, die wir normalerweise mit der Oper und Rossini verbinden, und suggerierte, dass alles an der sozialen und kulturellen Erfahrung der Oper bedeutungslos ist – die Musik, die Aufführung, die Inszenierung und das Publikum selbst. (…) Der Sinn der Inszenierung bestand darin, dass sie sinnlos war: Nichts hatte irgendeine Bedeutung. Es gab keine Übertitel, um der Handlung zu folgen, wahrscheinlich weil die Inszenierung so oft im Widerspruch zum Libretto stand, aber auch weil die gesungenen Worte bedeutungslos sind. Der Nihilismus, ein in Europa und Amerika mittlerweile weit verbreitetes Phänomen, da so viele Institutionen und Persönlichkeiten ihre Bedeutung verloren haben – Religion, Politik, demokratische Institutionen und die Künste –, scheint in Bieitos Inszenierung nun auch die Oper befallen zu haben. Die Gründe, warum man in die Oper geht, sind zunichte gemacht. Selbst die Handlungen, die mit einem Opernabend verbunden sind – Ticket kaufen, sich ankleiden, anreisen, zuhören, applaudieren – sind bedeutungslos. Bieito verspottet weniger die Institution oder das Publikum, als dass er uns sagt, dass eine kulturelle Handlung nicht mehr Bedeutung hat als alles andere.
Wenn die „Bedeutung” Bedeutungslosigkeit ist, dann sahen wir keinen Grund zu bleiben. Wir gingen in der Pause. Eineinhalb Stunden totale Negation waren genug. Wenn die Musik wertlos war, die harte Arbeit der Sänger und des Orchesters bedeutungslos und die Inszenierung ein endloser Kreislauf sich wiederholender Handlungen ohne jeden Grund, warum dann bleiben? Unser Akt des Nihilismus bestand darin, zu gehen und ein Eis zu kaufen. Italienisches Gelato an sich ist anti-nihilistisch. Oder vielleicht war Bieito einfach nur verwirrt und hatte keine Ahnung, was er tat.
.

Rossini Opera Festival 2025: „L´Italiana in Algeri“/Szene/Foto Amati Bacciardi
Rosetta Cucchis Inszenierung von Italiana in Algeri befand sich gewissermaßen am anderen Ende des philosophischen Spektrums. Sie interpretierte die Geschichte von Isabella, der Italienerin auf der Suche nach ihrem lange verschollenen Freund Lindoro, neu als eine Gruppe von Drag Queens, deren Bus auf einer Reise eine Panne hat. „Isabella und ihre Mädchen” werden von den Polizisten unter Mustafà verhaftet, einem despotischen Herrscher, der von seiner Frau Elvira gelangweilt ist. Die gestrandeten italienischen Drag Queens versprechen ihm eine Art neue Stimulation, sexuell oder anderweitig. In einer cleveren Vorführung vor der Oper hält die Gruppe mit einem regenbogenfarbenen VW-Bus vor dem Teatro Rossini und die „Polizei“ jagt die extravagant gekleideten Drag Queens, um sie schließlich ins Theater zu treiben, damit die Oper beginnen kann. Es ist ein lustiges Durcheinander in wilden Kleidern und leuchtenden Farben.
.Cucchi verwendet Isabellas patriotische Arie „Pensa alla patria”, um eine Art ernsthafte Aussage über die Befreiung von Homosexuellen oder die Akzeptanz von Drag Queens oder die Freiheit, sein Leben so zu leben, wie man es für richtig hält, zu machen, aber es passt nicht zum Text, und tatsächlich funktioniert die ganze Drag-Überlagerung nicht: Isabella ist eindeutig eine Frau, eine Mezzosopranistin, und kein Mann in Frauenkleidung. Sie sucht einen Liebhaber, der ein Mann ist (Lindoro). Die Inszenierung entpuppt sich als Camp-Übung und nicht als ernsthafter Aufruf zur Befreiung, trotz alter Wochenschauen, die Demonstranten für die Befreiung von Homosexuellen, für Transsexuellenrechte oder für Drag Queens zeigen. Cucchi glaubt eindeutig, dass eine soziale Sache im Gegensatz zu Bieito eine Bedeutung hat, aber sie hat das falsche Mittel gewählt, um ihre Ansicht zu verbreiten. Italiana ist eine köstliche Opera buffa: Sie verspottet alberne „Türken” und italienische Männer (Taddeo), preist aber die Macht und Intelligenz italienischer Frauen. Es ist nicht La Cage aux Folles oder Priscilla, Queen of the Desert. Der Gesang war sehr gut. Daniella Barcelona ist mit 59 Jahren immer noch wunderbar, und die beiden Buffo-Bässe Giorgi Manoshvili und Misha Kiria waren in der Tat sehr gut. Der Tenor Josh Lovell hat eine liebliche tenore di grazia-Stimme, aber er hat einige hohe Töne ziemlich schlecht getroffen, und seine Stimme ist in seiner Arie im zweiten Akt gebrochen. Vielleicht war das alles nur ein Insider-Witz: Daniella Barcelona hat ihre Karriere in Travesti-Rollen verbracht, in denen sie als Mann verkleidet war. Können wir sie als „Drag King” bezeichnen?
.

Rossini Opera Festival 2025: „La cambiale di matrimonio“/Szene/Foto Amati Bacciardi
Der dritte Abend war eine Art Doppelvorstellung. Die Einakter-Oper war Rossinis Cambiale di matrimonio, die mit vier Sängern kombiniert wurde, die die „Soirées Musicales” aufführten, eine Sammlung von zwölf Liedern, die Rossini in den frühen 1830er Jahren komponiert hatte. Dieser eher seltsame Abend versuchte nicht, eine Aussage zu einem aktuellen gesellschaftlichen Thema (Drag Queens) zu machen oder eine gesellschaftliche Unzufriedenheit wie Nihilismus auszudrücken. Er war einfach nur unterhaltsam und hat Spaß gemacht. Die Lieder wurden für diesen Anlass von Fabio Maestri orchestriert und vor dem Vorhang von vier jungen Sängern auf einfache Weise präsentiert: Vittoriana De Amicis, Andreas Niño, Paola Nevi und Gurgen Baveyan. In der Oper spielte der bekannte und lustige Buffo-Bass Pietro Spagnoli die Rolle des Tobia Mill und die exzellente Paola Leoci seine hübsche Tochter Fanni. Ihr Liebhaber Edoardo wurde von Jack Swanson gespielt, und der Kanadier Slook, der mit einem Bären im Schlepptau auftauchte, wurde von Matt Olivieri dargestellt. Ramiro Mataran und Inés Lorann waren die beiden Diener Norton und Clarina. Der ehemalige Tenor Laurence Dale inszenierte eine charmante, traditionelle und lustige Produktion. Auf der Bühne stand ein realistisches zweistöckiges georgianisches Londoner Reihenhaus, und die Sänger trugen historische Kostüme. Der einzige Misston war der Bär, der fast während der gesamten Oper auf der Bühne blieb und den Witz zermürbte. Christopher Franklin dirigierte.
.
Wenn es ein Gegenmittel zur nihilistischen Zelmira gab, dann war es der letzte Teil der Messe für Rossini, Verdis „Libera me, Domine”, ein großer Schrei nach Freiheit und Sinn, gerichtet an ein kaltes Universum und gesungen von der großartigen Vasilisa Berzhanskaya. Das Universum mag nicht zuhören, aber der verzweifelte Schrei, eines der größten Werke Verdis, ist an sich schon eine Bestätigung der größten Aufgabe der Kunst – uns in der Weite von Zeit und Raum einen Sinn zu geben. Charles Jernigan/DeeplL/G. H.
.
.
Salzburger Festspiele 2025: Counter-Gipfel. Noch nie gab es im Salzburger Festspielsommer eine derart hohe Beteiligung von Counter/Falsetisten wie in diesem Jahr. Schon in der Eröffnungsproduktion mit einem Barockwerk – Händels Giulio Cesare in Egitto -, mit dem der russische Regisseur Dmitri Tscherniakov sein Debüt in Salzburg gab, waren vier Vertreter dieser Stimmgattung besetzt. Ohne Zweifel führte sie der Franzose Christophe Dumaux als Titelheld an. Viele Jahre war er auf die Partie des Tolomeo abonniert, die er weltweit und bei allen großen internationalen Festivals gesungen hat. Für die Interpretation der Titelrolle hat er sich viel Zeit gelassen – mit dem Ergebnis einer bewundernswerten Vollkommenheit. Schon der Auftritt mit „Presti omai l´egizia terra“ war in seiner energischen Attacke fulminant, ähnlich rasant das Solo „Empio, dirò, tu sei“. Dazu kontrastierte das lieblich intonierte „Se in fiorito ameno prato“ mit imitierten Vogelstimmen zauberhaft und geradezu magische Wirkung hatte „Aure, deh, per pietà“ mit berückend schwebenden Tönen.
Ihm fast ebenbürtig der ukrainische Sänger Yuriy Minenko als Tolomeo, auch er eine Größe im internationalen Barock-Geschehen. Der Regisseur zeichnet ihn als fiesen, effeminierten Schurken und lässt ihn sein Entrée „L´ empio, sleale“ mit hysterischer Aggressivität vortragen. Aber Minenko kann später auch die Schönheit seines Timbres zeigen und mit einer kunstvollen Kadenz imponieren.
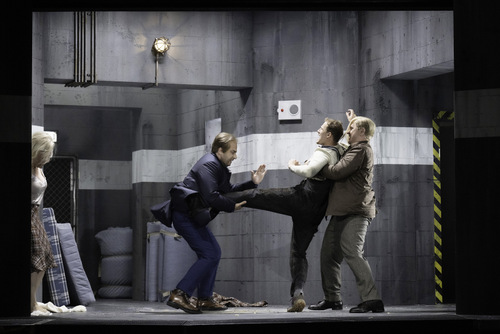
Salzburger Festspiele 2025: „Giulio Cesare“/Szene/Foto Monika Rittrershaus/SF
Ein relativ neuer Name ist der italienische Sopranist Federico Fiorio, der aber bereits an der Mailänder Scala aufgetreten ist und bei den jüngsten Festspielen Potsdam Sanssouci in Galuppis Didone abbandonata beeindruckte. Mir war sein Sesto bei aller zur Schau gestellten Virtuosität zu kindlich im Klang, ungeachtet der Tatsache, dass die Rolle einen Sänger mit jugendlicher Stimme verlangt. Wie alle Figuren in diesem unterirdischen Gefängnis ist auch er traumatisiert, allein die flatternden Hände bei „Svegliatevi nel core“ zeigen seinen pathologischen Zustand an. Später wird er eine Art Veitstanz aufführen und völlig die Kontrolle über seine Aktionen verlieren, was der Interpret mit bewundernswertem körperlichem Einsatz zeigt. Vierter Counter war der junge Amerikaner Jake Ingbar als Nireno mit auffallend klangvoller Stimme.
Gefeiert wurde Olga Kulchynska für ihre Cleopatra, mit der sie ein beachtliches Salzburg-Debüt gab. Optisch als billige Nutte eher abstoßend, gelang es ihr doch, die Gefühle für Cesare und ihre Ängste um sein Leben glaubhaft zu vermitteln. Die makellose Technik erlaubte ihr einen bravourösen Vortrag der fordernden Arien und auch die lyrischen Passagen gelangen ihr vortrefflich. Zwitschernd klang „Non disperar“, verführerisch „V´adoro, pupille“, tragisch umflort „Piangerò“ und gebührend bravourös „Da tempeste“. Einzig das recht anonyme Timbre versagt die Einordnung der Stimme in eine von Weltrang.
Gespalten. waren die Meinungen über die französische Mezzosopranistin Lucile Richardot als Cornelia. Ihre Stimme mit maskulinem, extrem gutturalem Klang verfärbte sie bis zur Hässlichkeit. Die Ausbrüche bis zum veristischen Schrei verfehlten zuweilen nicht ihre Wirkung, waren aber kaum noch in die Kategorie Gesang einzuordnen. Echte männlich-tiefe Töne brachten der moldawische Bariton Andrey Zhilikhovsky als Achilla und Robert Raso vom Young Singers Project als Curio ein. Ersterer trumpfte bei „Tu sei il cor“ mit energischer, ausladender Stimme auf, während Raso die Rezitative resolut formulierte.
Das zentrale Thema des diesjährigen Festspielprogramms, Machtkampf und Krieg, war deprimierend, doch angesichts der aktuellen Weltlage nachvollziehbar. Und natürlich war es auch in dieser Eröffnungsproduktion präsent. Wie stets fungierte Tcherniakov als sein eigener Bühnenbildner und hatte im Haus für Mozart einen unterirdischen Bunker auf die Bühne gestellt, in welchen die Protagonisten geflüchtet waren und dort in klaustrophobischer Enge eingepfercht sind. Ihre Machtkämpfe setzen sie dennoch fort. Der Einheitsschauplatz evozierte eine szenische Eintönigkeit. Elena Zaytsevsas moderne Kostüme bewegten sich im sattsam bekannten Spektrum von Business-Anzügen, Lederjacken, Hoodies und einem pinkfarbenen Girly-Outfit für Cleopatra mit Felljacke und langer Perücke. Befremdlich waren einige Ideen des Regisseurs, wie Tolomeos versuchte Vergewaltigung der Cornelia, die sich ihm angeekelt entzieht, aber darauf ihren eigenen Sohn Sesto sexuell bedrängt und damit eine inzestuöse Neigung offenbart. Auch die permanente Korrektur ihres Make-up´s während der Trauergesänge um den ermordeten Gatten schien unpassend. An Komik grenzten der schier endlos verblutende Achilla und Sesto, der am Ende den Verstand verliert und in einen Wahnsinnstanz verfällt. Vorhersehbar, dass Tschernjakov auch dem lieto fine nicht traute. Alle singen von Freude und Lust, doch eine ohrenbetäubende Explosion zeigt unmissverständlich an, dass die Wirklichkeit eine andere Sprache spricht.
Mit alarmierendem Sirenengeheul begann die Aufführung auch akustisch verstörend. Aber dann setzte die Musik ein, welche Emmanuelle Haim mit ihrem Concert d´Astrée in aggressiver Härte und schonungsloser Dramatik erklingen ließ. Da waren die weichen Streichertöne, die ziselierten Gambenakkorde und feinen Bläserpassagen der Bühnenmusik ein wunderbarer Kontrast zu den fiebrigen, harsch pulsierenden Passagen. Aus dem Orchestergraben sang der Bachchor Salzburg (Einstudierung: Michael Schneider) und sorgte gleichermaßen für dramatische Effekte (wie im Schlachtruf „Mora Cesare, mora“) und versöhnliche Harmonie (wie im Finale „Ritorni omai nel nostro core“) – wenn dies auch von der Regie nicht bedient wurde. Aber musikalisch war diese Festspieleröffnung verheißungsvoll (14. 8. 2025).
.

Salzburger Festspiele 2025: „Drei Schwestern“/Szene/Foto Monika Rittrershaus/SF
Die Besetzungsliste einer weiteren Neuproduktion, Peter Eötvös´ Oper Tri Sestri (Drei Schwestern) (Uraufführung am 13. März 1998 in der Opéra de Lyon) wies gleichfalls vier Counter auf, dazu als komischen Verfremdungseffekt den orgelnden polnischen Bass Aleksander Teliga in einer Travestie-Rolle – der Amme Anfisa. Das Trio der drei hohen Männerstimmen in den Titelrollen sorgte in Salzburg für eine Sensation. Der Sopranist Dennis Orellana als Irina sowie die Counter Cameron Shabazi als Mascha und Aryeh Nussbaum Cohen als Olga hatten den Abend schon im Prolog für sich entschieden, wo sie in schlichten weißen Kleidern (Kostüme: Emma Ryott) an ihr bisheriges Leben erinnern und von einem Neuanfang träumen. Wunderbar vereinten sich die drei Stimmen zu einem harmonischen Zusammenklang, getragen von der sphärischen Musik des ungarischen Komponisten, die 1998 uraufgeführt wurde. Der französische Dirigent Maxime Pascal breitete sie mit dem Klangforum Wien atmosphärisch aus, gab auch ihren winselnden, lärmenden Passagen gebührenden Raum. Alphonse Cemin leitete ein unsichtbares Orchester hinter der Bühne.
An Tschechows Schauspiel Drei Schwestern mit seinen intimen Kammerspiel-Szenen, mit seiner Bühne voller Birken darf man bei der Vertonung und bei der Inszenierung von Evgeny Titov nicht denken. Sie fügt sich ganz ein in das aktuelle Thema der Festspiele, zeigt eine apokalyptische Trümmerlandschaft aus geborstenem Beton und zerstörten Eisenbahnschienen im Nebel (Bühne: Rufus Didwiszus). Die Akteure müssen über riesige Gesteinsbrocken balancieren, wobei der vierte Counter, Kangmin Justin Kim in der Rolle der hysterischen und extravagant gewandeten Natascha, Andrejs Frau, dem Bruder der Schwestern, durch seine geradezu artistische Gewandtheit besonderes Aufsehen erregte. Die Hoffnung, welche Eötvös´ Musik auch innewohnt, atmet die Szenerie nicht. Der Krieg ist allgegenwärtig, wenn Soldaten mit den Utensilien des Kriegers die Bühne stürmen und Brände aufflammen. Die zugemauerten Arkaden der Felsenreitschule suggerieren zudem eine bedrückende Eingeschlossenheit.
Im Unterschied zum Schauspiel haben der Komponist und sein Librettist Claus H. Henneberg die Oper in drei Sequenzen aufgeteilt, in denen Irina, Mascha und Andrej aus ihren individuellen Blickwinkeln erzählen. Den Anfang macht Irina, die jüngste der Schwestern, der die Oboe zugeordnet ist und die von Baron Tusenbach (Mikolaj Trabka mit obertonreichem Bariton) geliebt wird. Orellana verlieh ihr einen feinen, träumerischen Sopranklang. Auch der Stabshauptmann Soljony (Anthony Robin Schneider mit sonorem Bass) liebt Irina, was zum Duell mit dem Baron führt, in dem dieser sein Leben verliert.
Die zweite Sequenz ist Andrej vorbehalten, der sich in Selbstvorwürfen quält. Seine Frau Natascha hat ein Verhältnis mit Protopopow (Henry Diaz), was der Choreograf Otto Pichler in einer Liebesszene pantomimisch umgesetzt hat. Der südafrikanischer Bariton Jacques Imbrallo zeigt sich als Andrej schonungslos nackt, so die Sinnlosigkeit seiner Existenz darstellend. Die Sequenz III ist Mascha vorbehalten, der die Klarinette gehört und die von dem Batteriekommandanten Werschinin (Ivan Ludlow mit potentem Bariton und starker Aura ) fasziniert ist. Der Abschied von ihm wegen seiner privaten Probleme ist für Mascha schmerzlich. Shahbazi bestach durch seine elegante, attraktive Erscheinung und die sinnliche, dunkel timbrierte Stimme. Der Bass Andrei Valentiy gab Maschas Ehemann Kulygin als skurrile Figur. An Irinas Namenstag erscheint er mit roter Clownsnase und langen Eselsohren, um ihr ein Geschenk zu machen. Valentiy formte daraus ein Kabinettstück und imponierte darüber hinaus mit seiner prachtvoll sonoren Stimme. Der dritten Schwester, Olga, ist keine Sequenz gewidmet, wohl aber ein Instrument – die Flöte.
Zwei Zeichen der Hoffnung setzte der Regisseur am Ende dennoch gegen Tristesse, Verzweiflung und Apokalypse. Irina malt auf eine weiße Mauer mit Kohle einen Tunnel als möglichen Ausweg und das Alte Mütterchen (Eva Christine Just) steigt aus ihrem Krankenbett, um von der vierstöckigen Schokoladentorte zu kosten. Selten gab es für eine zeitgenössische Oper solch euphorischen Jubel wie in der Felsenreitschule am 12. 8. 2025.
.

Salzburger Festspiele 2025: „Maria Stuarda“/Szene/Foto Monika Rittrershaus/SF
Für die Vielseitigkeit des diesjährigen Festspielprogramms stand auch die Inszenierung von Donizettis Maria Stuarda. Die 1835 uraufgeführte Tragedia lirica zeigte Regisseur Ulrich Rasche im Großen Festspielhaus als Machtkampf der beiden Königinnen Elisabetta und Maria. Jeder ist ein eigenes Reich zugeordnet, welches sie nie verlassen und auch in ihrem Duett die Trennung beibehalten werden. Rasche als sein eigener Bühnenbildner hat dafür zwei riesige drehbare Scheiben installiert, die auch kippen können und von unten illuminiert werden. Von oben senkt sich eine dritte Scheibe herab, welche als Leuchtkörper dient und zudem für die Projektion von Filmaufnahmen der Titelheldin (Video: Florian Hetz) genutzt wird. Umgeben werden die beiden Herrscherinnen von ihren Höflingen (Tänzer der Salzburg Experimental Academy), die sich in der Choreografie von Paul Blackman bewegen – zumeist gegen die Drehrichtung der Scheibe – oder im Gleichschritt marschieren, gegen Ende halbnackt und zunehmend gekrümmt erscheinen. Auch die beiden Regentinnen sind in ständiger Bewegung, um sich gegen die Drehung der Scheiben zu behaupten. Irgendwann ähnelt Elisabetta in ihrer gebeugten, gebrechlichen Haltung, sich mühsam vorwärts schleppend, gar einer Mutter Courage. Kate Lindsey, in Salzburg ein häufig gesehener Gast, gab sie mit strengem, stark gutturalem Mezzo, dem gelegentlich ein heulendem Beiklang eigen war. In der Erscheinung imponierte die herrscherliche, stolze, hochmütige Aura, im Ausdruck ihre Energie und Entschlossenheit. Von Sara Schwartz zumeist in Schwarz gekleidet, ist sie ein starker Kontrast zu Maria ganz in Weiß. Lisette Oropesa, kürzlich bei ihrem Rollendebüt am Teatro Real in Madrid gefeiert, war eine empfindsame schottische Königin mit weichem, lyrischem Koloratursopran. Die Auftrittskavatine „Guarda: su´ prati appare“ besaß Süße und Leuchtkraft, die Cabaletta „O nube“ Verve und strahlende Spitzentöne. Tief empfunden war ihre Preghiera vor dem Tod auf dem Schafott, bei der sie in einem transparenten hautfarbenen Hosenanzug aus glitzerndem Stoff auftreten muss – ein absurder Einfall der Kostümbildnerin. Auch Antonello Manacordas forsche Leitung der Wiener Philharmoniker wurde gelegentlich zum Problem, wenn das auftrumpfende Orchester den Sängerinnen alle Reserven abverlangte. Mit seinem robusten Latino-Tenor hatte Bekhzod Davronov als Roberto keine Mühe, sich gegen die Wiener Musiker durchzusetzen. Zur Optik als jugendlicher Beau korrespondierten seine strahlenden Spitzentöne und die Italianità seines Vortrags. Der russische Bass Aleksei Kulagin gab den Talbot mit ausladender, körniger Stimme, Thomas Lehman den Cecil mit solidem Bariton. Die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor (Einstudierung: Alan Woodbridge) sang aus dem Off, was gelegentlich zu Koordinationsproblemen mit dem Orchester führte. Das Publikum am 11. 8. 2025, mit der Interpretation von Belcanto-Opern in Salzburg nicht eben verwöhnt, feierte die Sänger ausnahmslos euphorisch.
.

Salzburger Festspiele 2025: „Hotel Metamorphosis“/Szene/Foto Monika Rittrershaus/SF
Traditionell wurde eine Produktion von den Pfingstfestspielen Salzburg in das Sommerprogramm übernommen – in diesem Jahr Barrie Koskys schon im Juni gefeiertes Vivaldi-Pasticcio Hotel Metamorphosis. Michael Levine hatte die Geschichte in einem Hotelzimmer mit Doppelbett und variierenden Gemälden verortet, welche mythologische Szenen zeigen: Pygmalion und seine Statue, Arachne und Minerva, Myrrha, Echo und Narcissus, Orpheus und Eurydice. Die Geschichten stammen aus Ovids Metamorphosen, deren berühmteste die von Orpheus ist, den Angela Winkler im schwarzen Hosenanzug (Kostüme: Klaus Bruns) mit ihrer bekannt manierierten kindlichen Stimme sprach und dabei einige Konzentrationsprobleme offenbarte. Auch Pfingst-Prinzipalin Cecila Bartoli als Eurydice (im roten Kleid) und Arachne (im bunten Hosenanzug und Turban) brauchte eine Zeit, um ihre Form zu finden. Bei „Quell`augellin che canta“ aus La Silvia entzückte sie mit den imitierten, kichernden und gackernden Vogelstimmen, bei „Dite, oimè“ aus La fida ninfa beeindruckten der schmerzliche Ausdruck und die souveräne hohe Lage. Am Ende tritt sie noch einmal als Eurydice auf, nun im schwarzen Kleid, und imponierte mit langen Bögen bei „Sposa… son disprezzata“ aus Giacomellis Il Bajazet und „Gelido in ogni vena“ aus Il Farnace, bei dem die Stimme wie erfroren klirrte. Auch Philippe Jaroussky, ein Veteran in der Counter-Szene, offenbarte als Pygmalion und Narcissus stimmliche Defizite. Überzeugend war aber der träumerische Klang in „Tu dormi in tante pene“ aus Tito Manlio.
Zum Star der Aufführung avancierte die französisch-italienische Mezzosopranistin Lea Desandre als Statua, Myrrha und Echo. Als Myrrha brillierte sie mit der Bravour-Nummer „Agitata da due venti“ aus La Griselda (früher selbst ein Ganzstück der Bartoli), wozu das lyrisch gesponnene „Non ti lusinghi la crudeltade“ aus Tito Manlio ein schöner Kontrast war. Berührend auch die Arie „Sonno, se pur sei sonno“ aus dieser Oper, die Myrrha nach ihrer Verwandlung in einen Baum singt. Überwältigend schließlich Desandre als Echo mit der Arie „Zeffiretti che sussurrate“ aus Ercole sul Termodonte mit dem reizend imitierten Vogelzwitschern. Die Besetzung komplettierte die russisch-schweizerische Merzzosopranistin Nadezhda Karyazina als Minerva, Nutrice und Juno. Als Minerva begann sie mit wimmernder Fistelstimme, als Nutrice trumpfte sie mit „Nel ,profondo cieco mondo“ aus Orlando furioso energisch auf und als Juno berührte sie mit „Ho nel petto un cor si forte“ aus Il Giustino.
Il Canto di Orfeo (Einstudierung: Jacopo Facchini) hatte in mehreren Szenen Gelegenheit für klangvolle Auftritte („Dell´ aura al sussurrar“ aus Dorilla in Tempe oder mit dem finalen „Sileant zephyri“).
Optisch wurde die Aufführung entscheidend geprägt von Otto Pichlers choreografierten Tanzszenen, die an seine Arbeiten in den Musicals an der Berliner Komischen Oper erinnerten. Vor allem zu Beginn des 2. Aktes mussten die Tänzer in bunten Röckchen und mit Blütenkränzen im Haar zur Sinfonia aus Dorilla in Tempe hopsen und kreischen. Im Finale sorgten sie beim Concerto grosso auf das „La Follia“-Thema von Geminiani immerhin für eine strengere Form. Exzellent war das orchestrale Niveau, das Gianluca Capuano mit Les Musiciens du Prince – Monaco bot. Ein reiches Farbspektrum schloss flirrende, harsche und klirrende Töne ein. Zu hören waren zärtliche, sinnliche und dramatisch explosive Momente, welche das Seelenleben der Protagonisten plastisch widerspiegelten. Das Publikum im Haus für Mozart am 13. 8. 2025 feierte die Interpreten anhaltend. Bernd Hoppe
.
.
Quietschekuh und Rumpelkammer: Bayreuther Festspiele 2025 – Die Meistersinger von Nürnberg unter Daniele Gatti und Tristan und Isolde unter Semyon Bychkov. Die rot-grün-bunte aufblasbare Kuh, deren durchgebogener Rücken und das nach oben gestreckter Euter die Nürnberger Festwiese überspannen, schwebt unantastbar über Jubel und Frohsinn, Schunkelei und Gruppentanz. Zwar hatte Beckmesser ihr kurzfristig die Luft rausgelassen, was zum Abbruch der Fröhlichkeit geführt hätte, doch Allkümmerer Sachs erkennt rechtzeitig die Notlage und verbindet Stecker und Kabel wieder. Das wäre auch zu schade gewesen. Das Bild wird in Erinnerung bleiben: eine Festwiese in quietschbunter 70er Jahre Optik als Mischung aus Volksfest und Vereinsabend, Musikantenstadl, Schlagerparade, Bauerntheater und Faschingssitzung mit zwei Merkel-Doubles, blond geschneckerlte Schlagerfuzzis, viel Volk in zünftigen Lederhosen und Dirndln. Und ganz viele Zipfelmützen, die an diesem Abend nie fehlen, als rote Vorgartenzwergmützen, fahle Narren- oder verzierte Faschingskappen.

Bayreuth 2025: „Die Meistersinger von Nürnberg“/Szene/©Enrico Nawrath press
Wie als Warnung wurde Regisseur Matthias Davids als Musicalregisseur angekündigt. Tatsächlich hat er seit 30 Jahren landauf landab an unterschiedlichsten Häusern gelegentlich Opern und Operetten, doch vor allem Musicals inszeniert. Und ich erinnere mich auch mal Gershwins Crazy for you von ihm gesehen zu haben. Gelernt hat er daraus ein Gefühl für Timing, die Mischung aus sentimentalen und leidenschaftlichen, aus kleinen und großen Szenen. Langweilig darf es nie sein. Das alles passt zu den Meistersingern, die Davids bewusst als Gegenentwurf zu Barrie Koskys und Katherina Wagners Geschichtsstunden und der jahrzehntelange Öde bei Wolfgang Wagners als – und das will bei den Längen der Schusterstube etwas bedeuten – nie langweiliges komödiantisches Entertainment bringt. Das war vielen zu leicht, zu heiter, zu oberflächlich. „Das Ganze war halt eine Farce und weiter nichts“, würde die lebenskluge Marschallin aus der anderen großen deutschen Musikkomödie sagen, die die Gefühlslage der Beteiligten erkannt hat. Oberflächlich ist Davids nie. Und die Bilder von Andrew Edwards bleiben in Erinnerung. Die sehr schmalen und sehr hohen, umsichtig mit einem Warnhinweis versehenen Stufen, die zu einem Kirchlein führen, aus dem anfangs die Kirchgänger strömen, angetan entweder in Trachten der Dürer- und Wagner-Zeit oder gar im modetrendigen Männerwickelrock. Auf der Fläche daneben treffen sich Eva und Stolzing erstmals. Er hat ein Herzchen aus Papierfliegern auf den Boden gelegt und flattert mit zwei Papierflügeln wie ein verliebter Teenager-Engel. Anschließend schwenkt die Handlung in das Innere eines Versammlungsraums. Im zweien Akt dann die bunt illuminierte, mittelalterliche Gasse mit den wie im Erzgebirge gedrechselten Häusern von Sachs und Pogner, samt Bäumchen von der Märklin-Eisenbahn und einer zum Bücherschrank umfunktionierten Telefonzelle. Am Ende des Aktes bricht ein Pandämonium aus, die Bäume scheinen sich zu biegen, die Häuser rücken auseinander, die Dächer heben sich, eine wütende Prügelei beginnt, die zwischenzeitlich zwischen den Hauptbeteiligten im Boxring geführt wird. Und schließlich diese Festwiese, die aus der krähwinkelschen Enge in die Weitläufigkeit der gegenwärtigen Unterhaltungsbranche führt. Ähnlich bunt – und stillos würde manch einer meinen – hat Susanne Hubrich die Kostüme zusammengesucht als habe ganz Nürnberg im Second-Hand-Laden gewühlt, doch auch mit viel Sinn für aparte Kombinationen und Details bis hin zu dem Harlekins-Wams und den roten Socken des Sachs und seinen guten Maßschuhen, die er im dritten Akt trägt, oder den wechselnden Outfits des Beckmesser. Davids hat die Figuren eindringlich gezeichnet. Herrscht anfangs noch ein gestelzter Vorzeigeton mit demonstrativen und jedes Wort untermalenden Gesten, so gewinnen die Figuren langsam an Leben und Individualität, vor allem Stolzing und Eva wirken wie Zeitgenossen. Eva wird am Ende zur treibenden Kraft, schält sich aus der Festwiesendeko, in der sie wie ein aufgerüschter Hauptgewinn vorgeführt wird, verabschiedet sich von der Amme, gibt dem Vater die Preiskette, ergreift ihren Junker, der nach seiner Ablehnung der Meisterwürde von Sachs ausgiebig belehrt wurde und nun etwas hilflos herumsteht, und flieht ihm aus dem Treiben.

Bayreuth 2025: „Die Meistersinger von Nürnberg“/Szene/©Enrico Nawrath press
Auch Sachs selbst hat neben allen besserwisserischen Lehrer-Lämpel-Zügen grüblerisch selbstquälerische und durchaus selbstironische Momente. Wie Georg Zeppenfeld diese Entwicklung darstellerisch zeigt, ist großartig. Nicht weniger bewundernswert die, man muss schon sagen, vokale Bravour, mit der er trotz des etwas sehr beiläufigen Flieder-Monologs die Partie trägt und bis zu den Schlusssequenzen mit seinem klaren, hohen Bass und auch in der vierten Aufführung nie nachlassender Kraft (11. August) meisterlich durchleuchtet, auch wenn man sich eine opulentere, profundere Stimme vorstellen könnte. Zeppenfeld führt eine großartige Besetzung an, die es in dieser fabelhaften Geschlossenheit auf dem Grünen Hügel auch nicht alle Jahrzehnte gibt. Sachsens Sparringpartner ist Beckmesser, mit dem er nach dem Schlussgesang die endlosen Diskussionen weiterführen wird. Michael Nagy ist darstellerisch ebenso großartig, wobei ich es interessanter gefunden hatte, wenn die Regie auf einige klamaukige Züge verzichtet hätte und den aparten Sänger mit seinem schönen Kavaliersbariton als echten Konkurrenten zum favorisierten Ritter aufgebaut hätte. Der Ritter ist ein Dutt tragender Teddy im blauen Anzug. Michael Spyres singt den Stolzing mit edelzartem, groß aufblühendem Ton, goldenen Timbre, in jeder Lage speziellem Klang und endlosem Atem, schön phrasiert und textdeutlich und einer heldenhaften Leichtigkeit, wie wenn er nach „Parnass und Paradies“ noch Rossinis Koloraturen versprühen könnte. Da ist alles zwingend erfasst. Nach dem sehr guten, doch keineswegs überrumpelnden Wagner-Debüt mit dem Lohengrin im Vorjahr in Straßburg hat Spyres mit Stolzing seine ideale Wagner-Partie gefunden. Im Frühjahr geht es an der Met mit dem Tristan weiter. Dort hat Christina Nilsson kürzlich die Aida gesungen. Mit kühl gestähltem, fast schon dramatischem Sopran ist die junge Schwedin eine auffallende Eva, die sich in den Szenen mit Sachs im zweiten und dritten Akt nicht unterbuttern lässt, die Pep hat und das Quintett mit ruhigem Strahl und sattem Klang anführt. Ausgezeichnet der bestechend artikulierende, in der Höhe etwas verunsicherte und mit einem großen Spieltenor singende Matthias Stier als David. Christa Mayers schuf mit der Magdalene eine pralle Figur, unter den allesamt individuell gezeichneten Meistern fielen Daniel Jenz als Balthasar Zorn, Matthew Newlin als kettenrauchender Ulrich Eisslinger, Patrick Zielke als Hans Foltz und Jordan Shanahan als gemütlicher Kothner auf. Ein schwarzer Fleck: der eigentlich schön, doch klein, völlig unidiomatisch und unverständlich klingende Pogner des Jongmin Park. Und Daniele Gatti? Ihm eilt die Regie zur Hilfe, lässt über den betulichen und langsamen Anfang hinweghören, bis sein ausziseliertes Musizieren und die Sicherheit, mit der er Orchester und den etwas kleiner als früher besetzten Chor führt und steigert, im dritten Akt an Überzeugungskraft gewinnt. Am Ende grenzenloser Jubel, einige Buhs für den Dirigenten.
.

Bayreuth 2025: „Tristan und Isdolde“/Szene/©Enrico Nawrath press
Rätselhaft, dunkel, raunend tags zuvor die zweite von fünf Aufführungen von Tristan und Isolde (10. August). Die Inszenierung des isländische Regisseurs Thorleifur Örn Arnarsson, der mit Inszenierungen der Edda und Orestie, aber auch von Lohengrin 2014 in Augsburg und Parsifal 2023 in Hannover aufgefallen ist und prädestiniert für geheimnisvolle Urstoffe scheint, hatte im Vorjahr die kurzlebige Tristan-Inszenierung Roland Schwabs aus dem Jahr 2022 abgelöst. Isolde, die bald ihren Bräutigam Marke treffen wird, schleppt im wahrsten Sinn des Wortes einen immensen Ballast an Erinnerungen mit sich, der in Form des gewaltigen weißen Reifrocks, welcher sich wie eine Insel um sie herum ausdehnt und wallt, alles andere auf der nur wegen der herunterhängen Taue als Schiff erkenntlichen Bühne in den Hintergrund treten lässt. Ein Riss im Boden steht für den Riss in der Welt und die unerfüllte Sehnsucht der Liebenden. Das weiße Gewand, das Isolde wie einen Engel erscheinen lässt, ist bereits über und über beschrieben, und immer noch kritzelt die Tagebuchschreiberin Isolde weiter, ruft sich die zurückliegende Begegnung mit Tristan in Erinnerung, bei der sich beide ineinander verliebten: „Vergeltung“, „Rache“, „Tantris“ usw. Da braucht es keinen Liebestrank mehr, damit beide bei der Überfahrt von Irland nach Cornwall, wohin Tristan die Braut Isolde führen soll, neuerlich entflammen. Im undurchschaubaren Hantieren mit Liebes- und Todestrank ist es unwichtig, zu welchem Trank sie greifen. Um die beiden war es bereits geschehen, so das Regieteam im Programmheft, sobald Isolde sagt, „Er sah mir in die Augen“.
Ganz entfliehen können sie dem Ballast, der Vergangenheit und ihrer Geschichte nicht, wenn man die Anhäufung von Gegenständen, die ab dem Erscheinen Markes am Ende des ersten Aktes fortan das vom litauischen Bühnenbildner Vytautas Narbutas voll geräumte Schiffsinnere bestimmen, als eine solche Last nimmt. Es ist ein Lager oder Speicher, durch den dicke Röhren und Leitungen führen, angefüllt mit dem kulturgeschichtlichen Treibsand aus mehreren Jahrhunderten, Kruscht und Krempel, die wahllos und schwer zu erkennen durcheinanderliegen, Karyatiden, ein Röhrenradio, ein alter Globus, Büsten und Amphoren, Bilder, vielleicht eines von Caspar David Friedrich, das Ziffernblatt einer Comtoise, die Statue eines Kriegers. Das Vergangene lässt sich nicht wegräumen und bestimmt bis zu Tristans Fieberfantasien die Handlung. Im zweiten Akt verspielen sich Tristan und Isolde ein wenig mit dem Zeugs. Tristan erbittet von Isolde den tödlichen Schwertstoß, dem sie ihm einst verweigerte. Indem er schließlich selbstmörderisch zum Todestrank greift, entgeht er Melots Hieb. Im dritten wird Tristan auf einem der Stühle sterbend zusammenbrechen, die anderen, ohnehin zu Stichwortgebern reduziert, sinken auf den Lagern zusammen. Arnarssons Inszenierung lässt den Betrachter ratlos und verwirrt zurück.

Bayreuth 2025: „Tristan und Isdolde“/Szene/©Enrico Nawrath press
Es ist der große Abend des Semyon Bychkov, der die „Handlung in drei Aufzügen“ mit dem in Bestform spielenden Festspielorchester mit ausgepichter Klangdelikatesse aufdröselt, so detailverliebt, dass man scheinbar nie gehörte Details neu beachtet, dabei bei durchaus ausladenden Tempi von großer Spannung und Intensität bereits in der sich sehrend ballenden und steigernden Einleitung mit dem berühmten Tristan-Akkord. Sensibel leuchtet er, wie in der Einleitung zum dritten Akt, Farben und Nuancen vorimpressionistisch aus und gibt den zartesten Pianissimi Gehalt, kreiert zu Beginn des zweiten Aktes ein sensuelles Fluidum, in dem sich Camilla Nylunds schöner Sopran ebenso edel entfaltet wie im bemerkenswert sicher gesteigerten Liebestod, den Isolde mit dem Gifttrank herbeiführt; nur aus Liebe stirbt man eben doch nicht. Ihrem durch und durch lyrischen Sopran mag es im ersten Akt etwas an hochdramatischem Fundament fehlen, was vor allem neben dem brünstig lauten Andreas Schager auffällt, doch im zweiten Akt ist besticht sie durch einen ruhigen und sicheren Strahl und ein feines Piano bei verinnerlichtem Ausdruck und Gestaltung. Schagers Tristan ist bis zu den letzten „Isolde“-Rufen ein kämpfender, mit voller Kraft und ungeniertem Ausdruck singender und sich verausgabender Held, der sich nur selten leisere, dann ins Sprechen abgleitende Töne gestattet und sich lieber auf die pure Kraft seines robusten und metallisch schwingenden Tenors verlässt. Wirklich zusammen passen die beiden Stimmen nicht. Ekaterina Gubanova macht als Brangäne durch ihre gute Höhe bei merklich blassem Mezzosopran auf sich aufmerksam, Jordan Shanahan ist ein sympathischer Diener seines Herrn, Günther Groissböck gibt den Marke mit überzeugender Gestaltung und Ausdruck und einem bedenklich festgefahrenen Bass. Festspielwürdig der feinstimmige junge Seemann von Matthew Newlin und der Hirte des Daniel Jens, weniger der Melot des Alexander Grassauer. Rolf Fath
.
.
Bad Wildbad: Otello mit Happy End beim 36. Rossini in Wildbad-Festival. Geballtes Programm. In zehn Tage hat Rossini in Wildbad diesmal alle Aufführungen und Konzerte gepackt. Das hat durchaus Reiz für anreisende Liebhaber, die nach der Eröffnung mit der Petite Messe Solennelle auf dem Baumwipfelpfad an verlängerten Wochenenden vormittags und abends La Cenerentola, die einzige aktuelle szenische Neuinszenierung, oder den Einakter L’inganno felice genießen können. Oder die Klavieroper Un avvertimento ai gelosi des legendären Rossini-Tenors und Gesangslehrers Manuel Garcia, von dessen Gelegenheitsstücken für seine Gesangsschüler das Festival bereits einige aufgeführt hat. Alle drei im Königlichen Kurtheater. Dennoch wirkt das diesjährige Angebot sparsam und ausgedünnt. Die große Rarität, die Grand opéra Pierre de Médicis des Józef Michał Ksawery Poniatowski (1816–1873), fand als einmalige konzertante Aufführung statt. Der in Rom geborene Großneffe des letzten polnischen Königs war als Sänger, Komponist und Diplomat ein Kosmopolit. Er lernte Rossini in Paris kennen, wo er sich 1853 niederließ, ab 1873 das Théâtre Italien leitet und seine Oper Pierre de Médicis (1860) in der Opéra Le Peletier zur Uraufführung brachte.

„Baritenor“ Manuel Garcia Vater als Rossinis Otello von 1816/Wikipedia
Auch die die zweite Rarität, Rossinis Otello in einer bislang in modernen Zeit nicht aufgeführten Fassung aus Rom von 1820 mit Happy End, erlebte nur eine konzertante Aufführung. Unvergessen die Aufführung des Otello beim 20. Rossini in Wildbad-Festival im Juli 2008 mit Jessica Pratt und Michael Spyres (Naxos 8.660275-76), die beide vom Enztal aus ihre Karriere starteten. Nun übernahm Francesco Meli, der sich Ende 2024 in Venedig erstmals an Verdis Otello getraut hatte, die Titelrolle; versierte Rossini-Tenöre würden den Weg andersrum wählen. Meli leitet übrigens das Opernstudio des Teatro San Carlo in seiner Geburtsstadt Genua, von dem die Produktion von Un avvertimento ai gelosi stammt. Diana Haller, die hier schon von Tancredi bis Isolier vielfach reüssiert hat und mittlerweile auch Sopran-Partien (Elettra) singt, ist erstmals die Desdemona. Die verbindende Konstante wäre Antonino Fogliani gewesen, der offenbar in vorletzter Minute durch Nicola Pascoli ersetzt werden musste, der sich im Vorjahr bei Michele Carafas Masaniello mit der heiklen Akustik der schmalen und langgestreckten Trinkhalle vertraut gemacht hatte.
Otello war nach Elisabetta, regina d’Inghilterra die zweite der neun ernsten Opern, die Rossini für das Teatro San Carlo in Neapel schrieb. Er war 23 Jahre alt, als ihn Domenico Barbaja 1815 zum musikalischen Leiter der beiden Königlichen Theater Neapels, des Teatro San Carlo und des Teatro des Fondo, ernannte mit der Auflage jedes Jahr zwei Opern zu schreiben. Für das San Carlo, das am prächtigsten ausgestattete Theater Italiens, schuf er fortan seine experimentierfreudigsten Seria-Opern. Der Vertrag erlaubte Rossini auch umfangreich für andere Theater zu arbeiten. Als er nach Il Barbiere di Siviglia in Rom nach Neapel zurückkehrte, hatte ein Feuer das Teatro San Carlo Opfer zerstört, weshalb der unliebsame – „Ich erinnere mich nicht, mich jemals so abgemüht zu haben“, schrieb er nach Hause –und vielfach verschobene Otello am 4. Dezember 1816 im kleineren Teatro del Fondo uraufgeführt wurde. Das Libretto des Francesco Berio di Salsa wurde so lange belächelt, bis man feststellte, dass sich der literarisch gebildete Marchese nicht direkt auf Shakespeare bezogen hatte und in den 1970 Jahren zeitgenössische Shakespeare-Adaptionen von Jean-François Ducis (1792) und Giovanni Carlo Baron Cosenza (1813) als Quellen ausgemacht wurden. Der dritte Akt mit dem Lied des Gondoliere, der Canzone des Desdemona und dem gegen den Sturm ankämpfenden einzigen Duett, das Desdemona und Otello haben, entspricht dagegen Shakespeares Drama.
Davon entfernte sich Rossini in seiner für die Karnevalssaison 1819/20 bestimmten Fassung mit Lieto fine, also einem Happy End, für das Teatro Argentina in Rom, die am 26. Dezember 1819 ihre erste Aufführung erlebte. In dieser Fassung versucht Desdemona Otello von Jagos Intrige zu überzeugen, der aus Rache für ihre Zurückweisung Otellos Eifersucht angefeuert habe. Zögernd lässt Otello seinen Dolch fallen. Der Doge kommt. Otello erfährt, dass der Nebenbuhler Rodrigo das gemeinsame Duell, mit dem der zweite Akt geendet hatte, überlebt hat und Jago seine Intrige zugegeben hat. Der Bösewicht wird zum Tod verdammt. Elmiro akzeptiert Otello als Schwiegersohn.

Rossinis römischer „Otello“ von 1819 in Bad Wildbad 2025/Foto Magdalena Kiwior
Das Festival nennt es eine moderne Premiere. Das Label Opera Rara hat bei seiner Otello-Einspielung 1998 diese Fassung als Anhang berücksichtigt, beim Festival della Valle d’Itria in Martina Franca war im Jahr darauf eine seltsame Mischfassung mit diesem Finale zu hören. Doch Rossini in Wildbad kann tatsächlich die Moderne Erstaufführung der vollständigen Fassung für Rom für sich beanspruchen. Die Änderungen, für die Rossini bereits vorhandene Stücke anpasste, sind umfangreicher als es zunächst den Anschein haben mag und rücken das Paar Desdemona und Otello stärker in den Mittelpunkt: Statt ihres Duetts mit Emilia, mit dem Desdemona im ersten Akt quasi als scheues Mädchen eingeführt wird, erhält sie nun eine Kavatine mit Chor (Quanto è grato all’alma mia), die aus der Elisabetta stammt und einer ersten Sopranistin würdig ist. Für das entfallene Duett wird Emilia zu Beginn des zweiten Aktes durch die Arie entschädigt, welche die Vertraute Isaura in Tancredi gesungen hatte (Tu che i miseri conforti).
Die junge Mezzosopranistin Verena Kronbichler polierte das lähmende Füllsel zum vokalem Juwel auf. Rodrigos hochvirtuoses, brillantes Showstück fällt dagegen weg. Neu ist vor seiner Begegnung mit Jago eine Szene des Otello, die aus Cimarosas Penelope stammt (Smarrita quest’alma). Im dritten Akt verzichtet Rossini auf das hübsche Lied des Gondoliere mit seinen Dante-Versen und lässt die Liebenden nach Desdemonas Weidenlied und ihrem Gebet im Duett aus Armida (Amor! Possente nome) mit dem hymnischen Schlussteil Cara per te quest’anima wieder zueinanderfinden. Ein kurzer Rundgesang aus Ricciardo e Zoraide besiegelt das glückliche Ende (Or più dolci intorno al core). Die kleinen Partien des Lucio und Gondoliere entfallen, der Chor ist ein reiner Männerchor. Gianmarco Rossini, hat, wie er in seinem Revisionsbericht darlegt, weit mehr Quellen aufgetan als sie bei der Herausgabe der Kritischen Edition der Fondazione Rossini berücksichtigt wurden.
Dieser Otello ist nicht den umfassenden Mosè in Egitto und Maometto-Überarbeitungen für Paris vergleichbar, dennoch ist er ein neues Stück, das Nicola Pascoli mit Begeisterung und Temperament in die Trinkhalle stemmte, wobei ihm das ungestüm aufspielende Orchester der Krakauer Szymanowski-Philharmonie mit Leidenschaft folgte. Auch wenn manche Feinheiten der Lautstärke zum Opfer fielen, gelang es dem Orchester auf die zahlreichen instrumentalen Solomomente hinzuweisen, gelegentlich fehlende Innenspannung und Dichte ersetzte Pascoli durch effektvoll gesteigerte Finali, in denen der Chor der Szymanowski-Philharmonie durch fabelhafte Tenöre auffiel. Die Besetzung war gediegen. Francesco Meli, der Otellos Sieg Vincemmo, o prodi gleich mit der Kraft und dem bronzenen Edelmetall eines Verdischen Esultate verkündete, tat sich nicht leicht, seinem schweren und etwas angedickten Ton die nötige Geschmeidigkeit und Eleganz zu geben oder ein schönes Piano zu singen und setzte durchgehend auf einen massiven und einförmigen Ausdruck. Meli, den man kaum noch mit dem Belcanto-Repertoire und den Rossini-Partien der Anfängerjahre, die er vor rund 15 Jahren langsam hinter sich gelassen hat, in Verbindung bringt, wird diesen neuerlichen Versuch mit Rossini vermutlich so schnell nicht wiederholen, doch Respekt, wie er sich die Partie, mit der er gegen Ende merklich zu kämpfen hatte, zu eigen machte und aus den Rezitativen alles rausholt.
Souverän und triumphierend, wie eine Königin der Trinkhalle, sang Diana Haller mit einer von den runden Tiefen bis zu den aufblitzenden Höhen durchgehend schön verblendeten Stimme eine leidenschaftlich glühende Desdemona, die heftig und selbstbewusst mit manchmal etwas harschem Tonsatz für ihre Liebe kämpft und dabei seelenvolle Töne für das Weidenlied und das Gebet findet. Juan de Dios Mateos war mit seinem leichten hohen, doch auch etwas unruhigen Tenor ein eher larmoyanter denn kämpferischer Rodrigo, der chinesische Tenor Anle Gou gab dem Jago hell durchdringende Spitzentöne, als Elmiro bestach der souveräne Nathanaël Tavernier durch wohltuende Bassautorität in den Ensembles. Rolf Fath
.
Österreich – Graz: Die 40. Styriarte mit dem Motto Raum & Klang. Die steirischen Festspiele feierten in diesem Jahr ein stattliches Jubiläum, wenn auch überschattet durch die jüngsten erschreckenden Ereignisse in der Stadt. Im Eröffnungskonzert am 20. 6. 2025 in der Helmut List Halle gedachte man dann auch mit einer Schweigeminute der Opfer. In einer Fotoausstellung im Foyer wurden 40 Bilder gezeigt, welche an die beteiligten Künstler erinnerten, vor allem natürlich an Nikolaus Harnoncourt, den Pionier des Unternehmens. Es war eine treffliche Idee, das Programm mit Johann Sebastian Bachs Partita in d, BWV 1004 für Violine solo zu beginnen – mit Thomas Zehetmair als Interpret, der dieses Werk schon beim 1. Konzert der Styriarte 1985 im Schloss Eggenberg gespielt hatte. Er fungierte dann auch als inspirierender Dirigent des Styriarte Festspiel-Orchesters bei Mozarts Sinfonia concertante in Es, KV 364 und der Sinfonie Nr. 41 in C. KV 551 „Jupiter“.
.
 Schloss Eggenberg war am nächsten Abend auch der Schauplatz für die diesjährige Opernproduktion – Antonio Draghis Ballettoper Gl´incantesimi disciolti, die 1673 im Schloss Eggenberg anlässlich der Hochzeit von Kaiser Leopold I. mit Erzherzogin Claudia Felizitas von Tirol aufgeführt wurde. Draghi war Hofkomponist des Kaisers und verarbeitete im Stück auch die Intrigen, welche sich im Vorfeld der Vermählung am Wiener Hof ereignet hatten und den Bund fast verhindert hätten. In der von ihm erdachten Geschichte verlieben sich das Glück und der Gute Wille, werden aber durch den missgünstigen Neid sowie Selbstsucht und Lüge verhext und kommen erst durch die Zuneigung und den zur Vernunft geläuterten Neid zum glücklichen Ende.
Schloss Eggenberg war am nächsten Abend auch der Schauplatz für die diesjährige Opernproduktion – Antonio Draghis Ballettoper Gl´incantesimi disciolti, die 1673 im Schloss Eggenberg anlässlich der Hochzeit von Kaiser Leopold I. mit Erzherzogin Claudia Felizitas von Tirol aufgeführt wurde. Draghi war Hofkomponist des Kaisers und verarbeitete im Stück auch die Intrigen, welche sich im Vorfeld der Vermählung am Wiener Hof ereignet hatten und den Bund fast verhindert hätten. In der von ihm erdachten Geschichte verlieben sich das Glück und der Gute Wille, werden aber durch den missgünstigen Neid sowie Selbstsucht und Lüge verhext und kommen erst durch die Zuneigung und den zur Vernunft geläuterten Neid zum glücklichen Ende.
Im prachtvollen Planetensaal des Schlosses hatte Dramaturg Thomas Höft eine deutsche Fassung unter dem Titel Das verwunschene Glück erstellt – eine freie Übersetzung des originalen Aufgelöste Zaubereien. Sein szenisches Arrangement wurde dominiert durch Lilli Hartmanns fast lebensgroße Handpuppen, die den allegorischen Figuren zugeordnet waren und entfernt am Arcimboldos Gemälde mit den Köpfen aus Früchten und Gemüse erinnerten. Geführt wurden sie von den Sängern und vier Tänzerinnen, die in der Choreografie von Mareike Franz pantomimische Episoden ausführten, zuweilen an den Ausdruckstanz der 1930er Jahre erinnerten und mit hüpfenden, zappelnden, hopsenden Figuren auch banales Vokabular auszuführen hatten. Die Optik war durch diese verschiedenen Elemente etwas überladen, zumal in diesem mit Gemälden reich dekorierten Saal – hier wäre eine Reduzierung vorteilhafter gewesen.
Die Aufführung hatte ihre Meriten durch das farbenreiche musikalische Klangbild, welches Michael Hell als Dirigent am Cembalo mit dem Ensemble Ärt House 17 verantwortete. Da die originale Partitur nur in Teilen erhalten ist und die bei der Uraufführung gespielten Ballettmusiken gänzlich verloren sind, hat Hell Instrumentalmusiken von zeitgenössischen Komponisten eingefügt. Diese Intermezzi von Biber (eine Sinfonia), Schmelzer (eine Gigue) und Rittler (eine Ciaconna) bringen rhythmisch prägnante Momente, Trompetengeschmetter und festlichen Fanfarenglanz ein, bedeuten zweifellos eine Bereicherung des musikalischen Kosmos.

Styriarte 2025: Antonio Draghis Oper “ Gl´incantesimi disciolti“/Szene/Foto Nicola Milatovic
Auf recht unterschiedlichem Niveau singt die Besetzung. Dominiert wird sie von den beiden Sopranen. Die junge Johanna Rosa Falkinger erfreut als Glück mit klangvoller, leuchtender Stimme, während die gestandene Sophie Daneman als Lüge noch immer mit souveränem Vortrag und makellosen Koloraturen besticht. Reizvoll dunkel timbriert ist der Mezzo von Anna Manske als Neid, der sich später in die Vernunft wandelt. Kraftvoll-energisch trumpft Julian Habermann als Zuneigung auf, während die beiden Veteranen der Gesangsszene – Markus Schäfer als Selbstsucht und Dietrich Henschel als Guter Rat – mit überreifen, teils verquollenen oder matten Stimmen Wünsche offen lassen. Das Publikum applaudierte begeistert, dankbar für diese Wiederentdeckung einer barocken Preziose. Bernd Hoppe
.
.
Potsdam-Sanssouci: Grand Tour bei den Musikfestspielen. Alljährlich bieten die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci ein attraktives Programm unter einem originellen Motto. Diesmal lautet es vom 13. bis 29. Juni Grand Tour und widmet sich dem Reisen in die Musikmetropolen von London über Paris und Wien bis Venedig. Gleich das Eröffnungskonzert am 13. 6. in der Friedenskirche mit dem Thema Dr. Burneys Reiseführer erinnerte an den britischen Organisten und Komponisten Charles Burney, der zwei ausgedehnte Reisen auf den Kontinent unternahm, um das Musikleben der einzelnen Länder kennenzulernen. Der zweite Ausflug 1772 führte ihn auch nach Berlin und Potsdam.
Das Konzert mit dem polnischen, auf Alte Musik spezialisierten Ensemble (oh!) ORKIESTRA unter Leitung seiner Gründerin Martyna Pastuszka offerierte ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm, das die einzelnen Reise-Etappen nachzeichnete. Der Auftakt mit der Ouvertüre zu Carl Heinrich Grauns Oper Catone in Utica führte nach Berlin, wo dieser Komponist das Musikleben. der deutschen Hauptstadt maßstäblich bestimmte. Mit seiner Oper Cleopatra e Cesare wurde das Opernhaus Unter den Linden, das Friedrich II. hatte erbauen lassen, 1742 festlich eröffnet. Die Ouvertüre dazu erklang im 2. Teil und weckte lebendige Erinnerungen an die Aufführung unter René Jacobs in der Staatsoper 1992, welche die beliebten Barocktage des Hauses eröffnete. Beide Titel Grauns demonstrierten den musikantischen Schwung des Orchesters und dessen exzellentes spielerisches Niveau. Auch das Flötenkonzert G-Dur von Johann Joachim Quantz, den Burney in Berlin getroffen hatte, war ein Verweis auf die preußische Metropole. Die namhafte Flötistin Laura Quesada brillierte mit ihrem virtuosen Vortrag – heiter-beschwingt im Allegro assai, träumerisch-empfindsam im Arioso e mesto und brillant im Presto.
 Vokalsolist des Abends war der renommierte Countertenor Max Emanuel Cencic, der eine reich gefüllte Pralinenschachtel öffnete und eine Preziose nach der anderen servierte. Der Beginn mit der Arie „Sol da te“ aus Antonio Vivaldis Orlando furioso führte nach Venedig, wo das Werk 1727 uraufgeführt wurde. Die Nummer ist ein Dialog zwischen Instrument und Stimme. Laura Quesada an der Traversflöte war dem Sänger eine inspirierende Partnerin. Der Counter ließ eine runde und warme Stimme von hoher Kultur hören. Imponierend waren die großen Atemreserven, die ihm lange Bögen ermöglichten. Noch eindrucksvoller war sein zweiter Beitrag – die berühmte Arie „Va tacito“ des Giulio Cesare aus Händels gleichnamiger Oper, womit die Reise zurück nach London führte. Hier war der Hornist Bart Aerbeydt der kompetente Partner im musikalischen Dialog. Cencic fühlte sich in diesem höher notierten Stück hörbar heimisch, sang mit Aplomb und Verve und variierte das Da capo spannungsreich. Ein Werk Händels, Flavio. Re de´Langobardi, 1723 in London uraufgeführt, markierte auch den virtuosen Schlusspunkt des offiziellen Programms. Cencic hatte es 2023 bei seinem Festival Bayreuth Baroque inszeniert und selbst die Partie des Guido, von Senesino kreiert, gesungen. In dessen Arie „Rompo i lacci“ setzte Cencic energische Akzente, imponierte mit stupenden Koloraturgirlanden und schoss im Da capo effektvolle Raketentöne ab. Das Orchester sorgte mit seiner Affekt betonten Begleitung für große Wirkung, hatte darüber hinaus in zwei Stücken Gelegenheit, Abstecher nach Wien und Prag zu unternehmen. Für ersteren diente die Sinfonia G-Dur von Karl (oder Joseph?) Kohaut – beschwingt im Allegro assai, elegisch-sanft im Andante und hurtig eilend im Presto. In Böhmen war Josef Myslivecek einst gefeiert, bis der Erfolg ausblieb und er in Italien Karriere machte. Seine Sinfonie G-Dur ist anfangs von pastoraler Stimmung, findet aber im Prestissimo zu einem ausgelassenen Finale.
Vokalsolist des Abends war der renommierte Countertenor Max Emanuel Cencic, der eine reich gefüllte Pralinenschachtel öffnete und eine Preziose nach der anderen servierte. Der Beginn mit der Arie „Sol da te“ aus Antonio Vivaldis Orlando furioso führte nach Venedig, wo das Werk 1727 uraufgeführt wurde. Die Nummer ist ein Dialog zwischen Instrument und Stimme. Laura Quesada an der Traversflöte war dem Sänger eine inspirierende Partnerin. Der Counter ließ eine runde und warme Stimme von hoher Kultur hören. Imponierend waren die großen Atemreserven, die ihm lange Bögen ermöglichten. Noch eindrucksvoller war sein zweiter Beitrag – die berühmte Arie „Va tacito“ des Giulio Cesare aus Händels gleichnamiger Oper, womit die Reise zurück nach London führte. Hier war der Hornist Bart Aerbeydt der kompetente Partner im musikalischen Dialog. Cencic fühlte sich in diesem höher notierten Stück hörbar heimisch, sang mit Aplomb und Verve und variierte das Da capo spannungsreich. Ein Werk Händels, Flavio. Re de´Langobardi, 1723 in London uraufgeführt, markierte auch den virtuosen Schlusspunkt des offiziellen Programms. Cencic hatte es 2023 bei seinem Festival Bayreuth Baroque inszeniert und selbst die Partie des Guido, von Senesino kreiert, gesungen. In dessen Arie „Rompo i lacci“ setzte Cencic energische Akzente, imponierte mit stupenden Koloraturgirlanden und schoss im Da capo effektvolle Raketentöne ab. Das Orchester sorgte mit seiner Affekt betonten Begleitung für große Wirkung, hatte darüber hinaus in zwei Stücken Gelegenheit, Abstecher nach Wien und Prag zu unternehmen. Für ersteren diente die Sinfonia G-Dur von Karl (oder Joseph?) Kohaut – beschwingt im Allegro assai, elegisch-sanft im Andante und hurtig eilend im Presto. In Böhmen war Josef Myslivecek einst gefeiert, bis der Erfolg ausblieb und er in Italien Karriere machte. Seine Sinfonie G-Dur ist anfangs von pastoraler Stimmung, findet aber im Prestissimo zu einem ausgelassenen Finale.
Zwei Arien von Johann Adolf Hasse, mit dessen Werk sich der Sänger seit langem beschäftigt, hatten nach Neapel und Dresden geführt. Tigrane wurde 1729 am Teatro San Bartolomeo von Napoli uraufgeführt. „Solca il mar“ des Titelhelden ist eine Gleichnis-Arie, welche die Gefahren des tobenden Meeres beschreibt. Entsprechend stürmisch ist der Gesangsduktus, entsprechend halsbrecherisch sind die Koloraturen. Nicht weniger glanzvoll meisterte der Solist die Arie des Aminta „Siam navi all´onde algenti“ aus L´Olimpiade, die 1756 am Dresdner Hoftheater zur Premiere kam. Nicht fehlen in der Auswahl durfte Nicola Antonio Porpora. Der große Konkurrent Händels in London brachte 1733 seine Arianna in Nasso heraus – vier Wochen vor der Arianna in Creta seines Rivalen. Cencic beeindruckte mit der getragenen Arie des Teseo „Nume che reggi il mare“. Effektvoller waren freilich die beiden Zugaben aus Händels Poro – „Vedrai con tuo periglio“ und „Senza procelle ancora si perde“. Den Titelhelden der Oper hatte bei der Uraufführung in London 1731 der berühmte Kastrat Senesino gesungen. Entsprechend hoch sind die virtuosen Ansprüche der beiden Arien und Cencic konnte damit seinen Auftritt glanzvoll krönen.
Das Eröffnungskonzert, dessen Mitwirkenden vom Publikum in der ausverkauften Friedenskirche begeistert gefeiert wurden, war ein stimmungsvoller Auftakt auf zwei Wochen Festspiele, die noch manche Rarität offerieren.
.

Prinzipalin und Dirigentin Dortothée Oberlinger in Potsdam 2025/Foto Stefan Gloede
Liebeswahnsinn: Immer wieder bewundert man den Spürsinn und die Entdeckerfreude der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci mit ihrer Künstlerischen Leiterin Dorothee Oberlinger. In diesem Sommer wartete man mit einer besonderen Rarität auf – einem Werk des 1654 geborenen Komponisten Agostino Steffani, der in Hannover als Hofkapellmeister wirkte. Im Schlossopernhaus der Stadt wurde 1691 sein Orlando generoso uraufgeführt, der nun in der Pflanzenhalle der Orangerie als die diesjährige szenische Produktion der Festspiele erklang. Das Libretto von Ortensio Mauro fußt auf Ariostos Epos Orlando furioso und erzählt von Paaren, die sich nicht finden können. Da sind Ruggiero und Bradamante, deren Heirat der mächtige Magier Atlante verhindern will, sowie die chinesische Prinzessin Angelica, Tochter des Galafro, und ihr heimlicher Geliebter Medoro. In sie ist hoffnungslos auch Orlando verliebt, was den Titelhelden zunehmend in den Wahnsinn treibt. Das Stück ist voll von den in Barock-Opern üblichen Verwirrungen und Verstrickungen, was das Verständnis der Handlung nicht eben erleichtert.
Die deutsch-britische Regisseurin Jean Renshaw hat das Geschehen in die Gegenwart verlegt, jedes historische Kolorit und jeden exotischen Zauber vermieden. Dafür sind Smartphones und moderne Schusswaffen im Einsatz. Die spartanische, stimmungsarme Bühne des Ausstatters Alfred Peter zeigt zwischen zwei weißen Wänden mit je einer Tür, welche mit In und Out gekennzeichnet sind, einen Tisch, der zum Schauplatz brutaler Attacken wird. Dafür ist neben Galafro vor allem Brunello (Martin Dvorák) zuständig – ein Tänzer, der mit seiner Partnerin Melissa (Katharina Weidenhofer) auch für die Choreografie voller bizarrer Körperverrenkungen zuständig war. Für diese tänzerischen Intermezzi dienten andere Kompositionen Steffanis – die Sonate da camera à 3 und Auszüge aus seiner Oper Niobe, regina di Tebe, welche 2010 an der Covent Garden Opera London eine glanzvolle Aufführung erlebte.

Steffanis „Orlando generoso“ in Potsdam 2025/Szene/Foto Stefan Gloede
Dorothee Oberlinger hat mit ihrer musikalischen Assistentin Olga Watts und der Regisseurin das Aufführungsmaterial für die gespielte Fassung erstellt. Sie dirigiert ihr ENSEMBLE 1700, das hinter der Spielfläche postiert ist und Steffanis vielfarbige Musik mit ihren herrlichen Duetten, den klagenden Arien und der reizvollen Instrumentation zum Klingen bringt. Tänzerisch beschwingt und mit federndem Rhythmus sind die Intermezzi besondere Höhepunkte der Aufführung.
Die exemplarische Besetzung verleiht der Produktion einen Ausnahmerang. Die Sänger in Uniformen, Business-Anzügen oder Abendkleidern, zunehmend verschmutzt oder blutverschmiert, agieren mit gespannter Intensität und bis an die Grenze gehender körperlicher Verausgabung. Mehr als die Regie tragen sie den über dreistündigen Abend mit ihrem darstellerischen Einsatz und dem expressiven Gesang. Der renommierte Countertenor Terry Wey als Titelheld konnte schon in dessen Auftrittsarie „In quest´alma“ den seelischen Konflikt der Figur plastisch umreißen und zudem mit bravourösen Koloraturgirlanden brillieren. Furios seine „Furien“-Arie, die vom Orchester mit spannenden Affekten begleitet wird, von starker Wirkung sein letztes, auftrumpfendes Duett mit Angelica, welches das Orchester mit stampfendem Rhythmus untermalt. Kontrastreich dazu gab er den zahlreichen Lamenti der Partie innige Empfindung und eine wunderbar schwebende Gesangslinie. In der Parade der Counter hinterließ auch der Däne Morten Grove Frandsen als Ruggiero einen glänzenden Eindruck. Die klangvolle Stimme harmonierte perfekt in den Duetten mit Bradamante und Angelica, bewältigte auch die vehemente „Gelosia“-Arie souverän. Der spanische Counter Gabriel Díaz als Galafro sang den Tyrannen mit gebührend reifer Stimme. Am Ende, wenn Bradamante und Ruggiero sich getrennt haben und seine Tochter mit Medoro fortgegangen ist, bleibt er verwirrt und allein zurück – eine zeitgemäße Deutung des lieto fine, die auch nicht der festlichen Musik mit dem Schlusschor „Amanti fortunati“ und der beschwingten Chaconne en rondeau entspricht.

Agostino Steffani/Gemälde von Ludovico Kapper/Wikipedia
Die exzellente Sopran-Riege wurde angeführt von der Französin Hélène Walter als Angelica, deren obertonreiche, innige Stimme die Figur eindrücklich profilierte. Ihr dramatisches Vermögen gestattete ihr auch beeindruckend extrovertierte Momente. Nicht nach stand ihr Shira Patchornik aus Israel als Bradamante mit exzessivem Engagement und totalem stimmlichem Einsatz. Fulminant ihre Attacke in der Arie „Troppo rapido“, berührend die Empfindsamkeit in „S´hò perduto ogni mio bene“. Von androgyner Erscheinung und ebensolchem Mezzo-Timbre war Natalia Kowalek eine ideale Interpretin für die Partie en travestie des Medoro. Auch ihre Arien bewegten sich in extremen Gefühlszuständen und wurden mit entsprechend leidenschaftlichem, erregtem, rasendem Ausdruck sowie reicher Farbpalette interpretiert. Imponierende bassprofunde Töne brachte Sreten Manojlovic als zynischer Atlante ein. Sein gewaltiges stimmliches Potential gab den Arien „Non voglio cedere“ und „Ombre del cieco abisso“ grandiose Wirkung. Am Ende der 2. Vorstellung am 24. 6. 2025 (nach der Premiere am Vorabend) feierte das Publikum das Ensemble anhaltend – dankbar für die Wiederentdeckung einer Rarität und beglückt über das musikalische Niveau.
.
Noch eine Sternstunde: Auch die zweite Opernproduktion im diesjährigen Festspielprogramm widmete sich mit Baldassare Galuppis Didone abbandonata einer Rarität. Der Stoff um das Liebespaar Dido und Aeneas ist mit dem Libretto von Metastasio (nach Vergils Aeneis) viele Male vertont worden, darunter von Porpora, Vinci, Hasse und Jomelli. Die bekanntester Version ist jene von Henry Purcell, die allerdings auf einem Libretto von Nahum Tate fußt. Metastasio schrieb seinen Text 1724 und bearbeitete ihn für den spanischen Hof in Madrid 1752 auf Bitten des Kastratenstars Farinelli neu. Auch Galuppi, dessen Urfassung 1740 in Modena ihre Premiere erlebte, stellte eine Neuvertonung vor, die am 28. 6. 2025 im Nikolaisaal in konzertanter Form als Version Madrid 1752 erklang.

Baldassare Galuppi/Wikipedia
Das Ensemble NEREYDAS musizierte unter seinem Gründer Ulises Illàn mit hinreißendem Elan, hoher musikantischer Kultur und reichem Farbspektrum. Markante orchestrale Höhepunkte waren die einleitende dreiteilige Sinfonia mit dem lebhaften Presto, dem kantablen Andante und dem beschwingten Non tanto allegro, die pompöse Marcia und die stürmische Sinfonia im 3. Akt, die gleich einer battaglia vorüber fegt sowie die stürmische Sinfonia per l´incendio mit dem effektvollen Einsatz von Donnerblech und Windmaschine.
Wieder war eine exemplarische Besetzung zu erleben, die keine Schwachstelle aufwies und einige spektakuläre Interpreten offerierte. Deren Sensation war für mich der amerikanischen Tenor Joshua Sanders als maurischer König Iarba – eine veritable Idomeneo-Stimme mit kultiviertem Vortrag und vielfarbiger Klangpalette. Die furiose, vom Orchester vehement begleitete Arie im 1. Akt „Non ho pace“ zeigte seine auftrumpfende Attacke, wie auch die Arie „Fosca nube“ im 2. Akt einen fulminanten Schwung. Höhepunkt seiner Interpretation war die triumphale, von Trompeten begleitete Arie „Cadrà fra poco in cenere“ am Schluss, welche brausende Meereswogen. und tobende Stürme suggeriert. Und der Sänger erschien sogar ganz am Ende noch einmal als Meeresgott Nettuno, der mit seiner Arie „Tacete, o mie procelle“ die Oper feierlich beschließt.
Den bravourösesten Auftritt hatte der Sopranist Federico Fiorio als Enea zu absolvieren. Er ist kein Unbekannter in Potsdam, hatte er doch schon im Vorjahr in der Aufführung von Grauns Adriano (der gerade als CD erschienen ist) mitgewirkt. Bei Purcell ist die Rolle einem Bariton anvertraut, was eine männlichere Wirkung evoziert, als das einer hohen, hellen Sopranstimme möglich ist. Aber die technischen Fertigkeiten des Sängers und sein bis in die Extremhöhe gerundeter Klang nötigten Bewunderung ab. Auf das Schönste entfaltete sich die Stimme in der klagenden Arie „Tormento il più crudele“ und Atem beraubend in der Aria di bravura „A trionfar mi chiama“. Pompös eingeleitet mit Pauken und wirbelnden Streicherfiguren, konnte der Sänger hier mit Koloraturen, staccati und Extremtönen in der Höhe ein Feuerwerk an Virtuosität entfachen. Prominentester Vertreter in der Solistenriege war der italienische Counter Filippo Mineccia als Osmida, Vertrauter der Königin Didone. Auch er kein Unbekannter in Potsdam wie bei vielen anderen internationalen Festivals, bedauerte man bei ihm am meisten die fehlende Szene, ist er doch ein engagierter Darsteller mit starker Aura und expressiver Gestik. Die klangvolle Stimme war schon in seiner Auftrittsarie „Tu mi scorgi“ zu vernehmen, und auch „Quando l´onda“ im 3. Akt imponierte durch den virilen Zugriff.

View of a scene from the opera „Didone abbandonata“ (Act I, Scene 9) by Metastasio and Galuppi, organised by Farinelli at the Coliseo del Buen Retiro Between 1754 and 1759, 1754 and 1759/ Ricordi Archivio Storica
In der Titelrolle ließ die französische Mezzosopranistin Natalie Pérez eine noble Stimme von hoher Kultur und schlankem Volumen hören. Die untere Lage wirkte gelegentlich etwas verhalten, aber der Vortrag war energisch und passioniert, was ihrer großen Arie „Son regina“ einen selbstbewussten Zuschnitt verlieh. Das wiegende Melos der Arie „Ah! non lasciarmi“ lag ihr besonders und beklemmende Wirkung erreichte sie mit ihrer finalen Arie „Vado… Ma dove?“, welche nach einem aufgewühlten Recitativo accompagnato den verwirrten Zustand der Königin aufzeigt.
Nicht weniger edel klang der Sopran von Alexandra Tarniceru als Didones Schwester Selene. Die Rumänin imponierte schon durch ihre hoheitsvolle Aura, was die edle Stimme von hoher Musikalität und feinem Gespür noch unterstrich. „Ardi per me“ im 2. Akt zeichnete sich durch den inbrünstigen Vortrag aus, „Io d´amore“ im 3. durch die schmerzliche Empfindung. Einem weiteren Sopran war die Partie (en travestie) des Araspe, Vertrauter Iarbas und verliebt in Selene, anvertraut. Die Italienerin Carlotta Colombo sang sie beherzt und mit frischem Ton. Die Aufführung, die dem Festspiel-Almanach dieses Jahres ein weiteres Ruhmesblatt hinzufügte, wurde vom Publikum enthusiastisch gefeiert (Foto oben Stefan Gloede). Bernd Hoppe
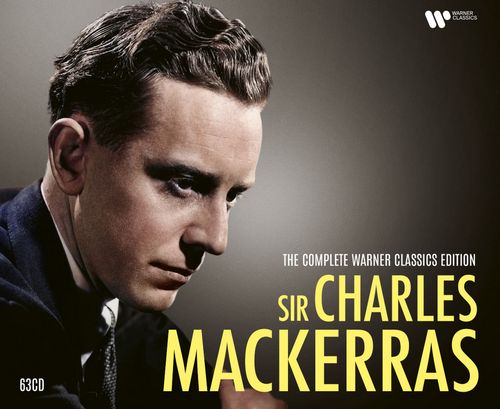 Mozarts Werke bildeten einen Schwerpunkt in Mackerras´ Arbeit. Hier imponieren weniger die Symphonien Nr. 36 „Linz“ und Nr. 38 „Prag“ oder die Nr. 40 und Nr. 41 (klassisch, ausgewogen, aber doch etwas nüchtern und mulmig im Klang) als das Flötenkonzert, die Bläser-Concertante Es-Dur sowie die Klavierkonzerte Nr. 21 und Nr. 23 mit dem hierzulande kaum bekannten Pianisten Alan Schiller (jeweils mit dem London Philharmonic Orchestra). – Zügig genommene Allegri, viel „brio“, Energie, ausgehörte Klanglichkeit und Transparenz zeichnen die Aufnahmen der Symphonien Beethovens mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra aus den 1990er Jahren aus, bei denen das Orchester freilich gelegentlich an seine Grenzen kommt.
Mozarts Werke bildeten einen Schwerpunkt in Mackerras´ Arbeit. Hier imponieren weniger die Symphonien Nr. 36 „Linz“ und Nr. 38 „Prag“ oder die Nr. 40 und Nr. 41 (klassisch, ausgewogen, aber doch etwas nüchtern und mulmig im Klang) als das Flötenkonzert, die Bläser-Concertante Es-Dur sowie die Klavierkonzerte Nr. 21 und Nr. 23 mit dem hierzulande kaum bekannten Pianisten Alan Schiller (jeweils mit dem London Philharmonic Orchestra). – Zügig genommene Allegri, viel „brio“, Energie, ausgehörte Klanglichkeit und Transparenz zeichnen die Aufnahmen der Symphonien Beethovens mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra aus den 1990er Jahren aus, bei denen das Orchester freilich gelegentlich an seine Grenzen kommt.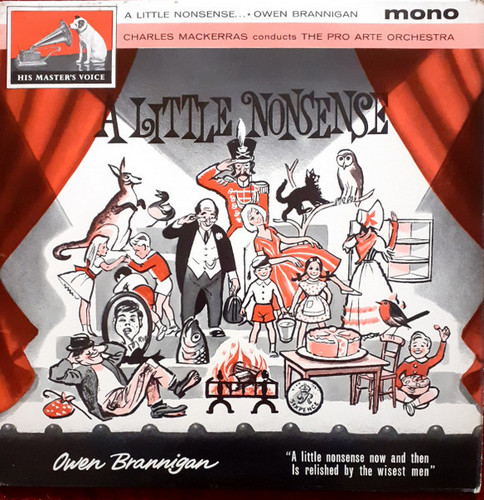 Mackerras hatte auch ein Gespür für das Ballett und dessen Dramaturgie, wie die Aufnahmen von Ballettmusiken – von Chopin und Delibes bis zu Offenbach zeigen. Die sind immer unterhaltend und lassen sich auch ohne die dazugehörende Handlung gut anhören. Überhaupt hatte der Dirigent ein Händchen für das Tänzerische. So inspiriert er das Philharmonia Orchestra zu Höhenflügen mit Tänzen von Dvořák, Smetana, Brahms, Bartók oder Enescu. Nicht zu vergessen eine hochamüsante CD mit Mackerras´eigener Bearbeitung von Themen aus Verdis Opern als abendfüllendes Ballett.
Mackerras hatte auch ein Gespür für das Ballett und dessen Dramaturgie, wie die Aufnahmen von Ballettmusiken – von Chopin und Delibes bis zu Offenbach zeigen. Die sind immer unterhaltend und lassen sich auch ohne die dazugehörende Handlung gut anhören. Überhaupt hatte der Dirigent ein Händchen für das Tänzerische. So inspiriert er das Philharmonia Orchestra zu Höhenflügen mit Tänzen von Dvořák, Smetana, Brahms, Bartók oder Enescu. Nicht zu vergessen eine hochamüsante CD mit Mackerras´eigener Bearbeitung von Themen aus Verdis Opern als abendfüllendes Ballett.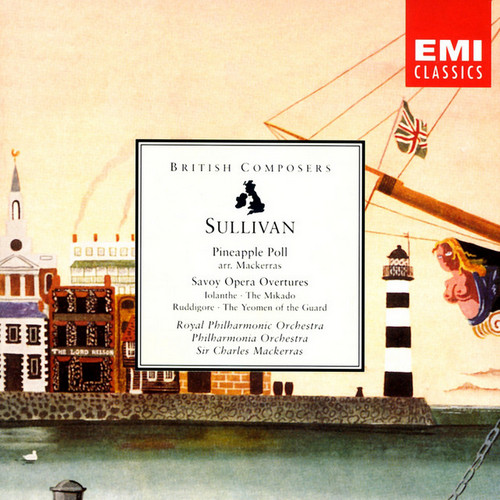 In den 1980er- und 1990er-Jahren arbeitete Charles Mackerras mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment zusammen. Das 1986 gegründete Ensemble führt vor allem Musik aus der Zeit der Aufklärung (englisch „Enlightenment“) auf historischen Instrumenten auf. Es hat sein Repertoire nach und nach erweitert hin zu Werken des 19. und 20. Jahrhunderts. Sehr gelungene Zeugnisse der der künstlerischen Arbeit mit Mackerras sind die Einspielungen von Mendelssohns Vierter Symphonie und Sommernachtstraum-Musik (animiert, klar, akzentuiert) sowie der Schubertschen Symphonien Nr. 5, Nr. 7 h-Moll (in der komplettierten Fassung) und Nr. 8 C-Dur. Mit Monica Huggett entstanden die Violinkonzerte von Beethoven und Mendelssohn.
In den 1980er- und 1990er-Jahren arbeitete Charles Mackerras mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment zusammen. Das 1986 gegründete Ensemble führt vor allem Musik aus der Zeit der Aufklärung (englisch „Enlightenment“) auf historischen Instrumenten auf. Es hat sein Repertoire nach und nach erweitert hin zu Werken des 19. und 20. Jahrhunderts. Sehr gelungene Zeugnisse der der künstlerischen Arbeit mit Mackerras sind die Einspielungen von Mendelssohns Vierter Symphonie und Sommernachtstraum-Musik (animiert, klar, akzentuiert) sowie der Schubertschen Symphonien Nr. 5, Nr. 7 h-Moll (in der komplettierten Fassung) und Nr. 8 C-Dur. Mit Monica Huggett entstanden die Violinkonzerte von Beethoven und Mendelssohn.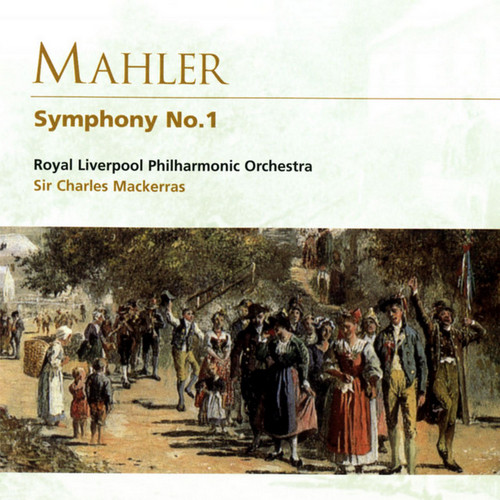 underhorn“-Liedern mit Ann Murray und Thomas Allen sowie der Ersten und Fünften Symphonie (jeweils mit dem London Philharmonic Orchestra) kennen. Den Aufführungen kommt zugute, dass es Mackerras auch darum geht, die Struktur eines Werkes offen zu legen – freilich nicht mit kühlem analytischem Blick, sondern mit großer Aufmerksamkeit für den jeweils eigenen Ton, die Stimmung und das Melos der Musik.
underhorn“-Liedern mit Ann Murray und Thomas Allen sowie der Ersten und Fünften Symphonie (jeweils mit dem London Philharmonic Orchestra) kennen. Den Aufführungen kommt zugute, dass es Mackerras auch darum geht, die Struktur eines Werkes offen zu legen – freilich nicht mit kühlem analytischem Blick, sondern mit großer Aufmerksamkeit für den jeweils eigenen Ton, die Stimmung und das Melos der Musik. Die Einspielungen Aufnahmen ganz unterschiedlicher Musik demonstrieren die Vielseitigkeit des Musikers, Musikgelehrten und Opernpraktikers Charles Mackerras gut, ebenso seine Universalität und Entdeckerfreude – und das ein ganzes Künstlerleben lang. Leider ist die Nutzung der Edition nicht einfach. Man muss manchmal umständlich suchen, ehe man ein bestimmtes Werk findet. Das Booklet ist recht lieblos. Zwar enthält es einen informativen, sehr lesenswerten Aufsatz von Nigel Simeone über Mackerras und einige charakteristische Fotos. Indes fehlt eine detaillierte Auflistung des Inhalts der Box mit Werken, einzelnen Tracks und Interpreten, die einen schnellen Zugriff auf Gesuchtes ermöglicht. Stattdessen ist nur eine Liste der Werke, geordnet nach Komponisten, abgedruckt.
Die Einspielungen Aufnahmen ganz unterschiedlicher Musik demonstrieren die Vielseitigkeit des Musikers, Musikgelehrten und Opernpraktikers Charles Mackerras gut, ebenso seine Universalität und Entdeckerfreude – und das ein ganzes Künstlerleben lang. Leider ist die Nutzung der Edition nicht einfach. Man muss manchmal umständlich suchen, ehe man ein bestimmtes Werk findet. Das Booklet ist recht lieblos. Zwar enthält es einen informativen, sehr lesenswerten Aufsatz von Nigel Simeone über Mackerras und einige charakteristische Fotos. Indes fehlt eine detaillierte Auflistung des Inhalts der Box mit Werken, einzelnen Tracks und Interpreten, die einen schnellen Zugriff auf Gesuchtes ermöglicht. Stattdessen ist nur eine Liste der Werke, geordnet nach Komponisten, abgedruckt.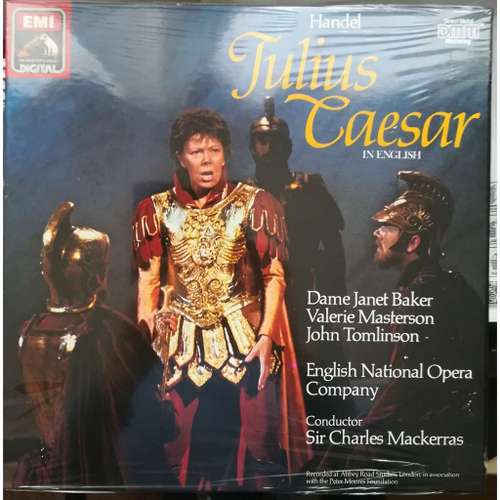 Mit Werken von: Tomaso Albinoni (1671-1751) , Albert Arlen (1905-1993) , Thomas Arne (1710-1778) , Bela Bartok (1881-1945) , Ludwig van Beethoven (1770-1827) , Alban Berg (1885-1935) , Hector Berlioz (1803-1869) , Ronald Binge (1910-1979) , Alexander Borodin (1833-1887) , William Boyce (1711-1779) , Johannes Brahms (1833-1897) , Havergal Brian (1876-1972) und weitere
Mit Werken von: Tomaso Albinoni (1671-1751) , Albert Arlen (1905-1993) , Thomas Arne (1710-1778) , Bela Bartok (1881-1945) , Ludwig van Beethoven (1770-1827) , Alban Berg (1885-1935) , Hector Berlioz (1803-1869) , Ronald Binge (1910-1979) , Alexander Borodin (1833-1887) , William Boyce (1711-1779) , Johannes Brahms (1833-1897) , Havergal Brian (1876-1972) und weitere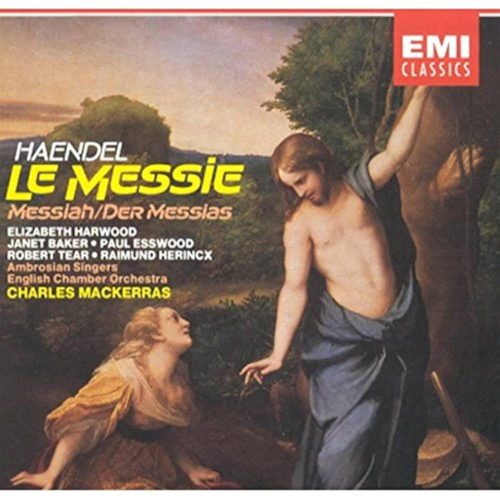 +Gustav Holst: The Perfect Fool-Ballettmusik; The Planets op. 32
+Gustav Holst: The Perfect Fool-Ballettmusik; The Planets op. 32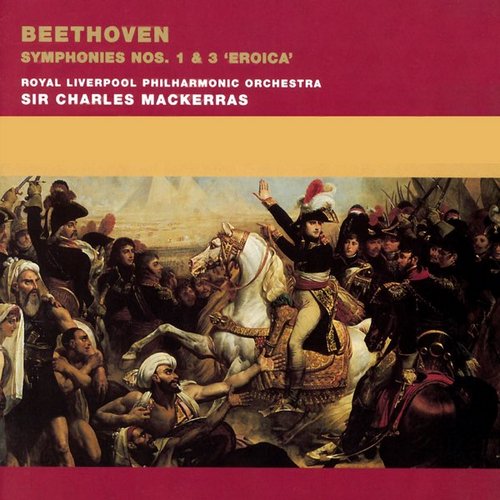
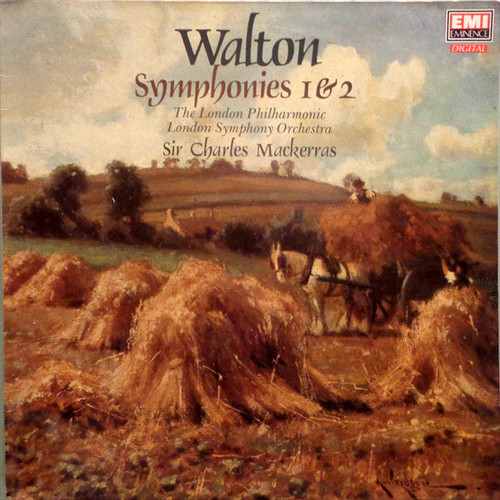 +“Richard Lewis – Folk Songs of the British Isles“ – Bingo; All through the Night; The Briery Bush; Buy broom buzzems; Dafydd y garreg wen; Fine Flow’rs in the Valley; The Foggy, Foggy Dew; Grand geal mo chridh; The Helston Furry DanceI will give my love an apple; King Arthur’s Servants; Leezie Lindsay; O Love, it is a killing Thing; O Waly, Waly; She moved thro‘ the Fair; The shuttering Lovers; There’s non to soothe
+“Richard Lewis – Folk Songs of the British Isles“ – Bingo; All through the Night; The Briery Bush; Buy broom buzzems; Dafydd y garreg wen; Fine Flow’rs in the Valley; The Foggy, Foggy Dew; Grand geal mo chridh; The Helston Furry DanceI will give my love an apple; King Arthur’s Servants; Leezie Lindsay; O Love, it is a killing Thing; O Waly, Waly; She moved thro‘ the Fair; The shuttering Lovers; There’s non to soothe
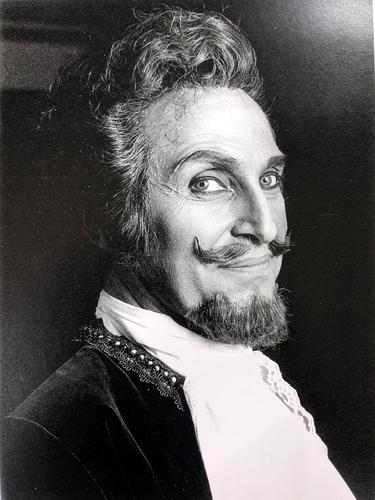






 Ich wurde für ein Jahr an der Pariser Oper eingestellt. Doch sehr schnell entstand ein Problem. Nach M. Lehmann, der das Châtelet geleitet hatte, kam M. Hirsch. Der mochte besonders die Operette, berücksichtigte die verfügbaren Stimmen nicht und interessierte sich eher nur für Künstler, die wussten, wie man sich auf der Bühne bewegt. Da ich ein Anfänger war, der von nichts eine Ahnung hatte, kam ich ihm gerade richtig. Am Tag meiner Ankunft, dem 1. Oktober 1951, erfuhr ich vom Bühnenmanager, dass ich vor dem 1. Januar nichts zu singen hatte. Und während der vier Jahre seiner Amtszeit hatte M. Lehmann nur eine Idee: meinen Vertrag zu kündigen. Er gab mir anfangs Urlaub, in Genf zu singen, Figaro im Barbier, mit dieser Vorhersage: „Das wird ihm das Genick brechen.“
Ich wurde für ein Jahr an der Pariser Oper eingestellt. Doch sehr schnell entstand ein Problem. Nach M. Lehmann, der das Châtelet geleitet hatte, kam M. Hirsch. Der mochte besonders die Operette, berücksichtigte die verfügbaren Stimmen nicht und interessierte sich eher nur für Künstler, die wussten, wie man sich auf der Bühne bewegt. Da ich ein Anfänger war, der von nichts eine Ahnung hatte, kam ich ihm gerade richtig. Am Tag meiner Ankunft, dem 1. Oktober 1951, erfuhr ich vom Bühnenmanager, dass ich vor dem 1. Januar nichts zu singen hatte. Und während der vier Jahre seiner Amtszeit hatte M. Lehmann nur eine Idee: meinen Vertrag zu kündigen. Er gab mir anfangs Urlaub, in Genf zu singen, Figaro im Barbier, mit dieser Vorhersage: „Das wird ihm das Genick brechen.“ 
 Drei Treffen waren daher entscheidend für Ihren Beginn, Hirsch, Dussurget und auchMadeleine Milhaud hinzugefügt. Ist das richtig?
Drei Treffen waren daher entscheidend für Ihren Beginn, Hirsch, Dussurget und auchMadeleine Milhaud hinzugefügt. Ist das richtig? Ein paar Worte zu ihrer Stimme …
Ein paar Worte zu ihrer Stimme … Die Opéra war damals ein „Korb von Krabben“ (vielleicht: Nest von Vipern). Es gab viel Druck, viel Bevorzugung, zum Beispiel von Politikern, diese oder jene Person sehr gut zu protegieren. Die Opéra war ein Haus, in das die Hälfte der Künstler nicht hineingehörte. Besonders unter Rolf Liebermann. Herr Liebermann mochte die Franzosen nicht. Nicht, dass er mich nicht eingestellt hätte. Er hat mich eingestellt. Liebermann machte oft großartiges, schönes Theater, aber mit Befangenheit. Zum Beispiel durch eine deutliche Erhöhung von Domingos Gehaltszahlungen im Vergleich zur MET. Das Gleiche galt für die Caballé, Freni, Gedda. Liebermann fand die Opéra in einem schlechten Zustand vor. Aber sie war noch maroder, als er ging. Wie sich herausgestellt hat. In früheren Intendanzen hatten die Direktoren junge französische Sänger eingestellt und ihnen so ihre Chancen gegeben. Liebermann hat das absolut nicht eingehalten. Er hatte zu sehr seine Vorlieben und Abneigungen. Im aktuellen System hätte mir heute niemand eine Chance gegeben
Die Opéra war damals ein „Korb von Krabben“ (vielleicht: Nest von Vipern). Es gab viel Druck, viel Bevorzugung, zum Beispiel von Politikern, diese oder jene Person sehr gut zu protegieren. Die Opéra war ein Haus, in das die Hälfte der Künstler nicht hineingehörte. Besonders unter Rolf Liebermann. Herr Liebermann mochte die Franzosen nicht. Nicht, dass er mich nicht eingestellt hätte. Er hat mich eingestellt. Liebermann machte oft großartiges, schönes Theater, aber mit Befangenheit. Zum Beispiel durch eine deutliche Erhöhung von Domingos Gehaltszahlungen im Vergleich zur MET. Das Gleiche galt für die Caballé, Freni, Gedda. Liebermann fand die Opéra in einem schlechten Zustand vor. Aber sie war noch maroder, als er ging. Wie sich herausgestellt hat. In früheren Intendanzen hatten die Direktoren junge französische Sänger eingestellt und ihnen so ihre Chancen gegeben. Liebermann hat das absolut nicht eingehalten. Er hatte zu sehr seine Vorlieben und Abneigungen. Im aktuellen System hätte mir heute niemand eine Chance gegeben





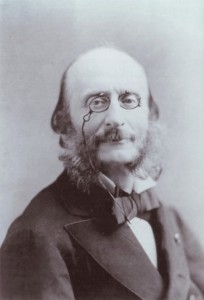
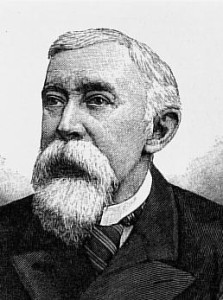

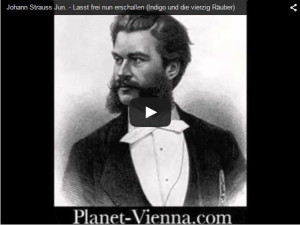
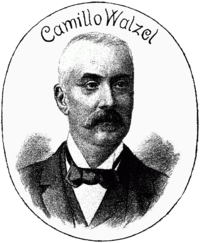
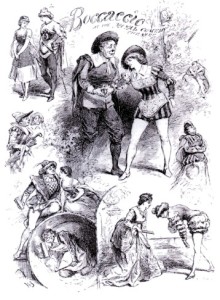
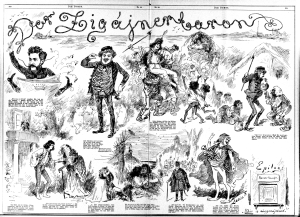
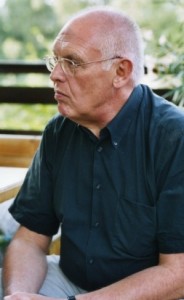

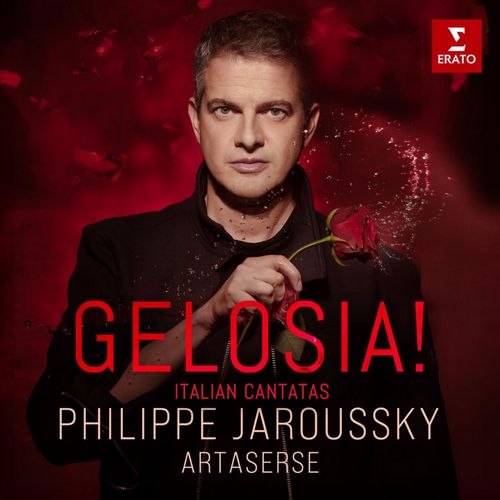






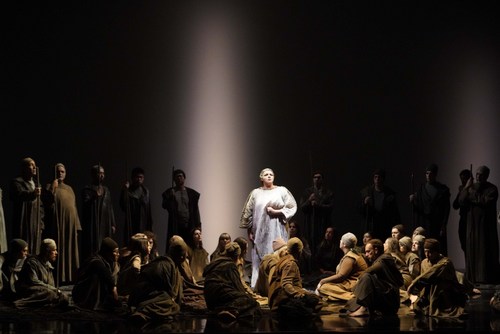

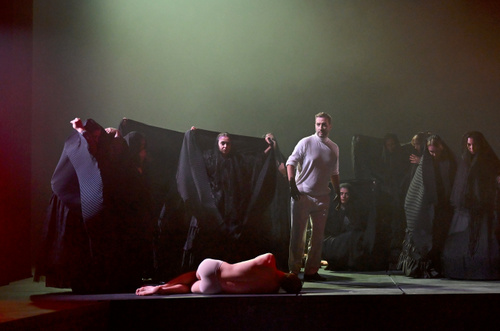


 Das Orchester mit seinem argentinischen Dirigenten begleitete auch mehrere Solisten bei ihren
Das Orchester mit seinem argentinischen Dirigenten begleitete auch mehrere Solisten bei ihren 








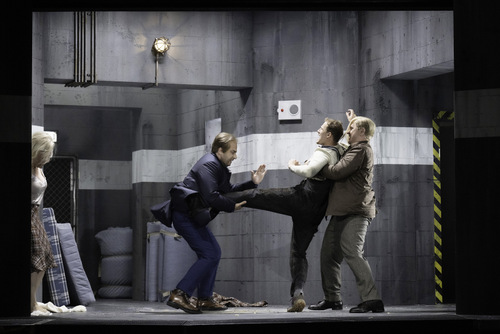





 Schloss Eggenberg
Schloss Eggenberg
 Vokalsolist des Abends war der renommierte Countertenor Max Emanuel Cencic,
Vokalsolist des Abends war der renommierte Countertenor Max Emanuel Cencic,




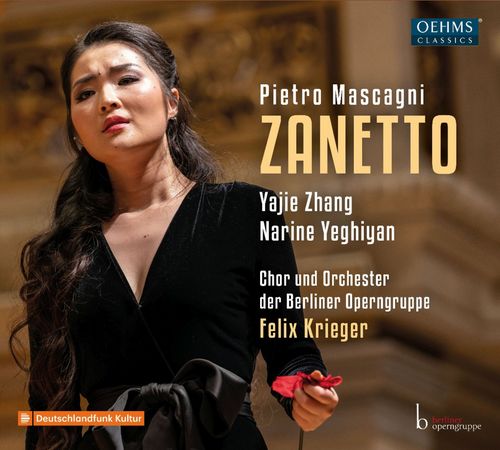

 d macht das Stück für lange Zeit für den erschrockenen Hörer ungenießbar. Das hört sich schon beinahe wie ein Racheakt an allen bisher sich in der musikalischen Sonne Italiens sich aalenden.Tenöre an.
d macht das Stück für lange Zeit für den erschrockenen Hörer ungenießbar. Das hört sich schon beinahe wie ein Racheakt an allen bisher sich in der musikalischen Sonne Italiens sich aalenden.Tenöre an.
 Vierzig Jahre später kehrte der Tenor, nun ein Weltstar, ins walisische Llangollen zurück und gab ein sensationelles Konzert. Lange galt die Aufzeichnung der Gala als verschollen, wurde aber wiederentdeckt und bietet dem Hörer unter dem Titel
Vierzig Jahre später kehrte der Tenor, nun ein Weltstar, ins walisische Llangollen zurück und gab ein sensationelles Konzert. Lange galt die Aufzeichnung der Gala als verschollen, wurde aber wiederentdeckt und bietet dem Hörer unter dem Titel  Spätestens mit dem Erscheinen des Schubers dürfte Llangollen zumindest in der gesamten musikalischen Welt bekannt werden, denn es gibt auch viele Fotos von Städtchen und Landschaft, der typisch walisischen mit grünen Weiden und sanften Hügeln. Man findet viele historische Aufnahmen, so vom Chor, der den Namen Rossinis trägt, aus Modena mit dem jungen Pavarotti genau neben dem Träger der Trophäe, die man gerade errungen hatte. T-Shirts mit dem Portrait des Gefeierten wurden damals verkauft, und eine Unmenge von Zeitungsausschnitten bezeugt noch heute, welch immense Bedeutung man der Wiederkehr des Tenors, der vom Chormitglied zum Superstar wurde, beimaß.
Spätestens mit dem Erscheinen des Schubers dürfte Llangollen zumindest in der gesamten musikalischen Welt bekannt werden, denn es gibt auch viele Fotos von Städtchen und Landschaft, der typisch walisischen mit grünen Weiden und sanften Hügeln. Man findet viele historische Aufnahmen, so vom Chor, der den Namen Rossinis trägt, aus Modena mit dem jungen Pavarotti genau neben dem Träger der Trophäe, die man gerade errungen hatte. T-Shirts mit dem Portrait des Gefeierten wurden damals verkauft, und eine Unmenge von Zeitungsausschnitten bezeugt noch heute, welch immense Bedeutung man der Wiederkehr des Tenors, der vom Chormitglied zum Superstar wurde, beimaß. Obschon das Programm des Konzerts allseits bekannte Stücke beinhaltet, sind alle Texte abgedruckt, dazu gibt es zahlreiche Hinweise auf digital erreichbare Quellen. Zu schätzen weiß der Opernfreund, dass das Konzert so zu hören ist, wie es 1995 die unmittelbaren Zuhörer wahrnahmen, einschließlich kleiner Unebenheiten, die man bei einer Studioaufnahme nicht dulden würde. Die Authentizität macht einen nicht vernachlässigbaren Vorteil der Aufnahme aus, da sie die allgemeine Freude und Festlichkeit hörbar macht, die damals in Llangollen herrschten.
Obschon das Programm des Konzerts allseits bekannte Stücke beinhaltet, sind alle Texte abgedruckt, dazu gibt es zahlreiche Hinweise auf digital erreichbare Quellen. Zu schätzen weiß der Opernfreund, dass das Konzert so zu hören ist, wie es 1995 die unmittelbaren Zuhörer wahrnahmen, einschließlich kleiner Unebenheiten, die man bei einer Studioaufnahme nicht dulden würde. Die Authentizität macht einen nicht vernachlässigbaren Vorteil der Aufnahme aus, da sie die allgemeine Freude und Festlichkeit hörbar macht, die damals in Llangollen herrschten. Luciano Pavarotti äußerste beim Abschied vom
Luciano Pavarotti äußerste beim Abschied vom 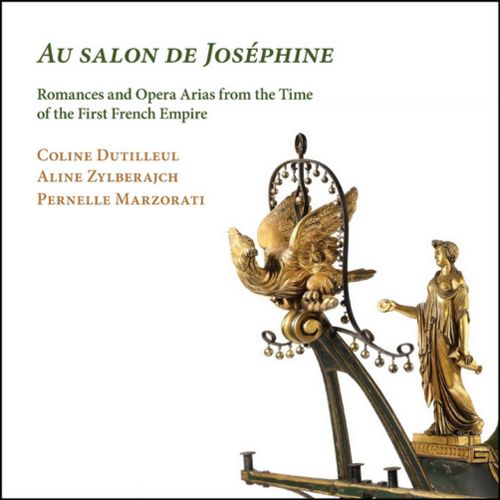


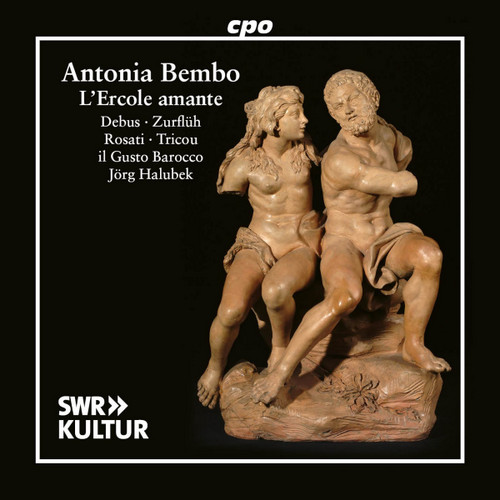
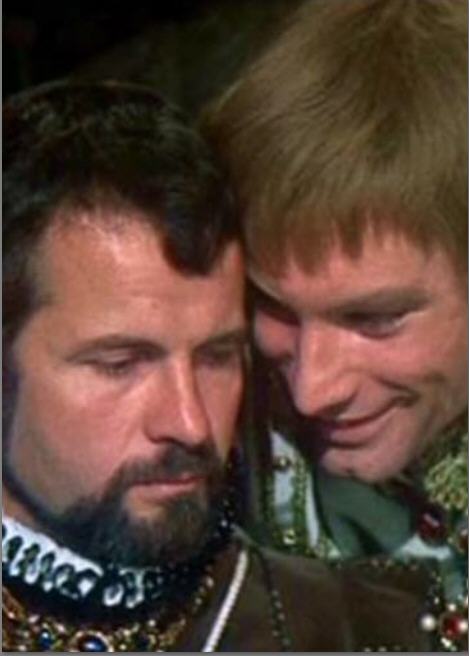


 Denn da saßen die Journalistin und Autorin Martha Wertheimer, der Musikverlags-Chef Hans André und er an einem Tisch im Verlagshaus in der Frankfurter Straße 28 und unterschrieben zu dritt den Verlagsvertrag zu ‚Riccio‘. Der Verlag André würde
Denn da saßen die Journalistin und Autorin Martha Wertheimer, der Musikverlags-Chef Hans André und er an einem Tisch im Verlagshaus in der Frankfurter Straße 28 und unterschrieben zu dritt den Verlagsvertrag zu ‚Riccio‘. Der Verlag André würde 
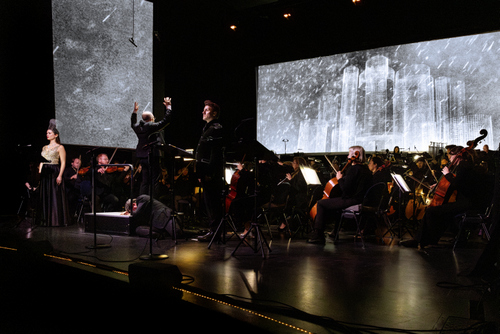




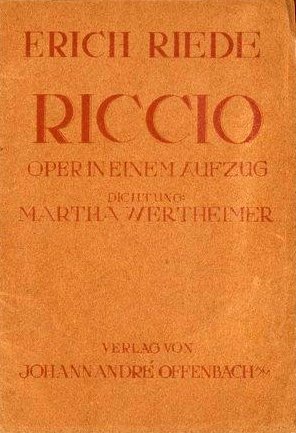




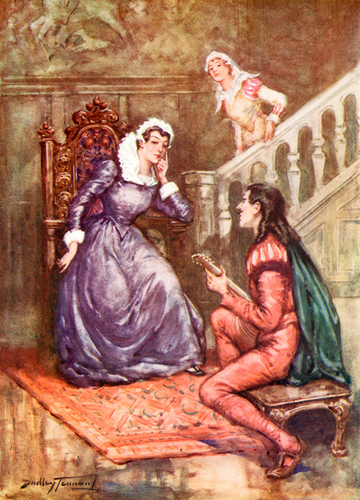
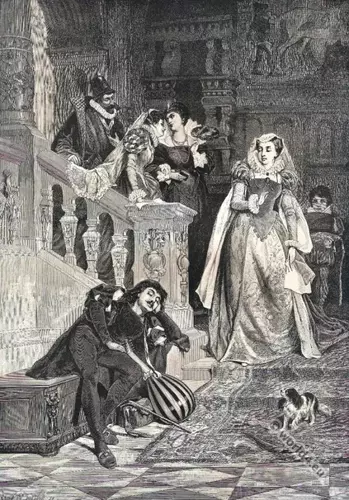
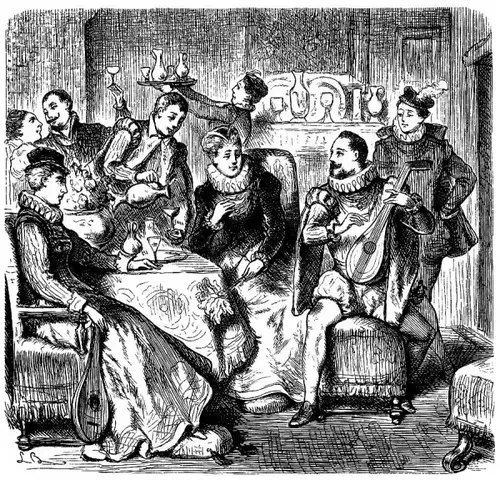


 2017 trat sie damit am Royal Opera House Covent Garden London auf, ein Jahr später am Teatro Real in Madrid, 2022 an der Wiener Staatsoper und 2023 an der Mailänder Scala. Es war also an der Zeit, ihre Interpretation zu dokumentieren, wofür die Mikrofone im sizilianischen Catania, der Geburtsstadt Bellinis, installiert wurden. Und natürlich kam es auch zur Verpflichtung von Chor und Orchester des
2017 trat sie damit am Royal Opera House Covent Garden London auf, ein Jahr später am Teatro Real in Madrid, 2022 an der Wiener Staatsoper und 2023 an der Mailänder Scala. Es war also an der Zeit, ihre Interpretation zu dokumentieren, wofür die Mikrofone im sizilianischen Catania, der Geburtsstadt Bellinis, installiert wurden. Und natürlich kam es auch zur Verpflichtung von Chor und Orchester des 



 Ich hatte ein sehr seltsames Schicksal. Ich habe sehr jung angefangen, ich habe sehr hart studiert und ich habe nie etwas mehr geliebt als das Singen. Ich glaube, das ist etwas, das einem in die Wiege gelegt werden muss. Man weiß nie, was als Nächstes passiert, aber irgendetwas oder irgendjemand führt dich zu dem, was du liebst, aber nicht unbedingt verstehst, und das gibt dir die Kraft, Zeit und Energie zu investieren, um zu entdecken, was deine Berufung im Leben ist. Die Tatsache, dass man diesen Ehrgeiz hat, etwas zu lernen, ist ein Mysterium, aber gleichzeitig ist es eine Freude, etwas zu verfolgen, das man liebt und das letztendlich nicht wirklich erreichbar ist. Wie kann man Musik „erreichen“?
Ich hatte ein sehr seltsames Schicksal. Ich habe sehr jung angefangen, ich habe sehr hart studiert und ich habe nie etwas mehr geliebt als das Singen. Ich glaube, das ist etwas, das einem in die Wiege gelegt werden muss. Man weiß nie, was als Nächstes passiert, aber irgendetwas oder irgendjemand führt dich zu dem, was du liebst, aber nicht unbedingt verstehst, und das gibt dir die Kraft, Zeit und Energie zu investieren, um zu entdecken, was deine Berufung im Leben ist. Die Tatsache, dass man diesen Ehrgeiz hat, etwas zu lernen, ist ein Mysterium, aber gleichzeitig ist es eine Freude, etwas zu verfolgen, das man liebt und das letztendlich nicht wirklich erreichbar ist. Wie kann man Musik „erreichen“?

