In meiner Jugend hatte ich keinen Zugang zu Elfride Trötschel. Zu leise, zu viel Gestaltung, zu viel Kunst. Die expressiven Stimmen lagen mir mehr, Sänger, die zubeißen, die die Töne herausschleudern, damit um sich werfen. Alles das ist die Trötschel nicht. Sie will, dass man genau hinhört, dass man sich einlässt. Sie kann auf ihre Weise streng und fordernd sein. Und dennoch nicht humorlos, wie ihre Ausflüge ins leichte Fach belegen. Walter Felsenstein, der Gründer der Komischen Oper Berlin, spricht in seinem bewegenden Nachruf sinngemäß gar davon, dass man in ihr die kommende Operettendiva sah. Ein Kompliment der Sonderklasse, denn dieser instinktsichere Theatermann dachte in der Musik immer grenzüberschreitend. Damit erfasste er auch das besondere Talent dieser Sängerin, die ihren Einstand an seinem Haus mit der Eurydike in Offenbachs Orpheus in der Unterwelt gegeben hatte. Er muss eine genaue Vorstellung von ihren ungeahnten Möglichkeiten gehabt haben. Die Trötschel als Erfinderin der Leichtigkeit? Sie kann also immer noch überraschen – mehr als fünfzig Jahre nach ihrem frühen Tod. Wen die Götter lieben, der stirbt jung, heiß es beim griechischen Dichter Menander. Nein, dieser Spruch bietet keine Erklärung. Ihr Leben blieb unvollendet. Was hätte sie noch alles singen können? Immerhin stand die erst am Beginn einer Weltkarriere. Es hat nicht sollen sein. Wir müssen uns an das halten was ist. Und das ist immerhin sehr viel.

Elfride Trötschel/OBA
Ihr Erbe ist reich und es macht reich. Die Plattenaufnahmen waren immer präsent, das meiste ist inzwischen auf CD übernommen worden. Neuzugänge tauchen gelegentlich auf. In privaten Sammlungen kursieren weitere Dokumente, darunter die Berliner Meistersinger unter Karl Böhm. Diese Sängerin hatte immer ihre Gemeinde, die sich mit den Jahren auch verjüngt hat. Jetzt ist noch etwas hinzugekommen, was Elfride Trötschel von einer bisher fast unbemerkt geblieben Seite zeigt – nämlich als Liedsängerin. Mit Vol. 6 der Semperoper Edition aus Dresden widmet sich das Label Profil Edition Günter Hänssler ausschließlich diesem Thema (PH 13050 – 2 CD). Sage und schreibe 38 Titel sind zusammengekommen, Schumanns „Mondnacht“ gar zweifach. Der Spiritus Rektor dieses einzigartigen Unternehmens ist Steffen Lieberwirth. Wie bereits bei ähnlichen historischen Ausgaben im Rahmen der Edition – viele davon mit der Trötschel – hat der MDR-Chefproduzent wieder einen Kreis kompetenter Mitstreiter um sich geschart. So wird das ehrgeizige Dresdner Projekt mit immer neuen Facetten vorangebracht. Mit im Boot sind neben dem MDR auch die Semperoper selbst sowie Deutschlandradio Kultur und das Deutsche Rundfunkarchiv. Es ist ermutigend, dass sich Archive öffnen, wo tatsächliche Schätze zu heben sind. Die müssen ans Licht.

1956 beim letzten Liederabend in Dresden
Die enorme Vielseitigkeit der Trötschel auf der Opernbühne und auf dem Konzertpodium findet sich auch bei der Auswahl der Lieder. Reger, Strauss, Mahler, Hindemith, Schubert, Schumann, Brahms, Wolf. Das sind die Namen der Komponisten dieser Edition, in Wirklichkeit dürften es mehr gewesen sein. Unterschiedlicher kann sich die Quellenlage nicht darstellen, was für den Spürsinn der Macher spricht. Es wurden Rundfunkaufnahmen des RIAS von 1949 mit der berühmten, Authentizität stiftenden Erkennungsmelodie aufgetan. Eine der beiden „Mondnacht“-Einspielungen entstand gar schon 1944 mir Michael Raucheisen am Klavier. Sie fehlt in seiner berühmten Liedersammlung, die in Schallplattenkassetten vorliegt und technisch teilweise sehr unzureichend auf CD übertragen wurde. Privatmitschnitte von Hermann Lauer bilden eine große eigene Abteilung. Strauss-Lieder mit Hubert Giesen entstanden bei einer Probe in der Privatwohnung. Offenbar hat sie der Sohn der Sängerin Andreas Trötschel großzügig zur Verfügung gestellt. Nicht nur das, er steuert im Booklet auch persönliche Erinnerungen an seine Mutter bei. Krönender Abschluss und platzgreifend auf der zweiten CD ist der Mitschnitt des letzten Liederabends 1956 im Dresdner Kurhaus Bühlau, bei dem sich das Publikum neben weiteren Liedern auch Arien erklatscht. Insgesamt sind es acht Zugaben, die Elfride Trötschel selbst ansagt. So wird auch ihre Sprechstimme überliefert, die mit der Gesangstimme völlig übereinstimmt. Unter den Zugaben ist das „Lied an den Mond“ aus Rusalka, mit dem man die Trötschel am häufigsten verbindet. Kaum sind die ersten Töne angespielt, braust im Saal Wiedererkennungsbeifall auf. Das ist es, was die Leute hören wollen. Hans Löwlein am Klavier muss noch einmal von vorn anfangen. Auch ich habe sie als Rusalka zum ersten Mal bewusst wahrgenommen auf einer alten LP, die bei Eterna in der DDR erschienen war.

Rolle ihres Lebens: Elfride Trötschel 1948 als Rusalka in Dresden
In dieser Arie, die zumindest in Teilen auch ein Kunstlied sein könnte, tut sich eine direkte Verbindung zu ihrem Interpretationsstil der klassischen Lieder auf. Immer bildet die Melodie, die sie bis ins letzte Detail aufspürt, das Fundament für den Ausdruck. Nie ist es umgekehrt. Der Musik gehört das Primat, der musikalischen Linie ist alles untergeordnet. Das geht natürlich nur, wenn einer Sängerin dafür die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. Bei der Trötschel macht sich Technik nie selbstständig. Ihre Stimme ist wunderbar gebildet. Sie hat gute Lehrer gehabt, darunter den Bariton Paul Schöffler und die Altistin Helene Jung. Es scheint, als mache ihr Singen nicht die geringste Mühe. Der Ton ist leicht, natürlich, die Noten vollkommen verblendet. Da passt nichts dazwischen, nicht einmal die Luft zum Atmen. Sie gebietet über ein Farbenspektrum wie die französischen Impressionisten in der Malerei. Farben, die sich nicht beschreiben lassen, die man in ihrem Falle nur hören kann. Damit gewinnt sie vor allem Strauss („Ophelia-Lieder“) und Mahler („Des Knaben Wunderhorn“) ins Flirrende gehende Wirkungen ab. „Keine Sopranistin gestaltet den Wunderhorn-Text so innig, schlicht und mädchenhaft wie die Trötschel“, sagte der Dirigent Otto Klemperer, der mit ihr 1954 die 4. Sinfonie von Mahler aufgenommen hat.

Spiritus Rektor der Edition: MDR-Chefproduzent Steffen Lieberwirth
Auffallend stark hat sich die Trötschel der neuen Musik zugewandt, ein Markenzeichen, das sie mit den wenigsten prominenten Kolleginnen ihrer Zeit teilt. Sie hat – belegt durch Plattenaufnahmen – Honneger, Orff, Henze gesungen, in der Edition finden sich Ausschnitte aus den „Marien-Liedern“ von Hindemith. Schade, dass es nicht den kompletten Zyklus gibt. Sie wendet sich Hindemith mit der gleichen Hingabe, Schönheit und Wahrhaftigkeit zu wie Schubert oder Mahler. Sie interpretiert neue Musik aus der Tradition heraus und nicht als Bruch mit der Tradition. Die Neutöner werden dadurch vielleicht nicht revolutionärer – dafür aber gnädiger. Leider sagt das in Wort und Bild sehr aussagekräftige Booklet nichts über die kurzen Gesprächseinwürfe im Anschluss an die Hindemith-Lieder. Verglichen mit den Ansagen im Liederabend dürfte die Sängerin dabei selbst zu Wort kommen mit einem Aufruf der Bewunderung und des Staunens über ihre soeben voll brachte Leistung. Das rührt sehr an. Und auch der anwesende Herr – ist es der Pianist und Dirigent Richard Kraus? – bemüht das Wort „wunderbar“ nicht nur einmal. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen.
Wer das Haar in der Suppe sucht, wird keines finden. Nun gut, es ließe sich diskutieren, welche Lieder ihr besser gelingen als andere. So fand ich zunächst den Einstieg in das Programm mit Regers „Flieder“ etwas zu mächtig, musste diesen Eindruck aber verwerfen, noch bevor sie zum verhauchten Schluss des Liedes gekommen ist. Bei Reger sind derlei dramatische Kontraste nicht selten. Nicht nur das Timbre, sondern die künstlerische Gesamterscheinung von Elfride Trötschel mögen im Einzelnen etwas altmodisch wirken. Aber nur, weil diese genaue Art des Singens aus der Mode gekommen ist. Der Edition ist eine weite Verbreitung zu wünschen. Ich bin sehr dankbar dafür, weil ich eine neue bedeutende Liedsängerin entdeckt habe, die es locker aufnehmen kann mit dem ganz Großen dieses Fachs. Auch wenn sie schon so lange nicht mehr unter uns ist.

Andreas Trötschel, der Sohn der Sängerin im Hörfunkstudio
Ein Leben für die Oper. Andreas Trötschel erinnert sich an seine Mutter: Elfride Trötschel – in Dresden geboren, in Dresden berühmt geworden, um Dresden getrauert und in Dresden die letzte Ruhestätte gefunden. Und mitten in diesem Leben ist Krieg, versinkt die Oper in Schutt und Asche und es sind nur die wenigen Nachkriegsjahre, die ihr zur Entfaltung ihrer künstlerischen Meisterschaft bleiben sollten. Der künstlerische Werdegang von Elfride Trötschel ist ohne ihre Heimat- und Geburtsstadt Dresden nicht zu denken. Karl Böhm entdeckt ihre Begabung und holt sie aus dem Opernchor. Beim ersten Vorsingen nimmt sie all ihren Mut zusammen und schleudert in vollem Fortissimo dem Maestro die Arie der Pamina „Ach, ich fühl´s, es ist verschwunden“ entgegen. Böhm ist nicht entsetzt, sondern – Gott sei Dank – amüsiert und verlangt eine Wiederholung, diesmal aber ganz im Piano. Im zweiten Anlauf gibt sie dieser Arie nun die notwendige dramatische Intensität, und das ist der Beginn ihrer solistischen Laufbahn als lyrischer Sopran. Im Anschluss an das Vorsingen läuft sie wie auf Wolken durch den Zwinger und schickt ein Dankesgebet zum Himmel.
Sie spürte: Ihre Stimme war ein Geschenk Gottes, das es zu ehren und vor allem zu hüten und weiterzuentwickeln galt. Auf die kleinen Rollen folgen bald größere Aufgaben. Unter Böhms Nachfolger Karl Elmendorff singt sie mit außergewöhnlichem Erfolg das Ännchen im Freischütz – und erwirbt sich so beim Dresdner Opernpublikum den Namen „Die kleine Trötschel“. Sie heiratet den Opernmäzen und Fabrikbesitzer Friedrich Hildsberg, der sie bei einem seiner hobbymäßigen Dirigate der Staatskapelle kennengelernt hatte. So hätte es gut weitergehen können, wenn nicht Krieg gewesen und Dresden samt Semperoper zerstört worden wäre. Dieses Inferno hat auch Auswirkungen auf die Seelen der Musiker – bei meiner Mutter führt das zu einer Veränderung ihres stimmlichen Timbres: Das Jungmädchenhafte ist einer bewegenden lyrischen Intensität gewichen – wie es deutlich in schwereren dramatischen Partien wie der Rusalka zu hören ist. Wenn man die Zeit nach der Zerstörung Dresdens im Hinblick auf das Musikleben in der Stadt Dresden würdigen will, so ist das eine kurze Zeitspanne der künstlerischen Freiheit, nicht mehr durch die Hitlerdiktatur missbraucht und noch nicht durch die „Diktatur der Arbeiterklasse“ eingeschränkt.

Am Flügel in ihrer Berliner Wohnung
Tonhalle, das Große Haus und das Kurhaus Bühlau sind die unvergesslichen Spielstätten in denen unter dem Triumvirat Josef Keilberth (als Dirigent), Heinz Arnold (als Regisseur) und Karl von Appen (als Bühnenbildner) beeindruckende Opernaufführungen stattfinden. Ihre besondere Neigung zu slawischen Opern und die Gestaltung der „Großen Liebenden“ wie der Jenufa, der Katja Kabanowa von Janácek oder der Tatjana in Tschaikowskys Eugen Onegin verschaffen ihr ein besonderes Image. Zu dem Dirigenten Josef Keilberth entwickelt sich eine besondere künstlerische Verbundenheit, die in der gerade eben veröffentlichten Biographie von Thomas Keilberth in zahlreichen Ausrufungszeichen hinter ihrem Namen ihren Ausdruck findet. Aber nicht nur Keilberth ist dieser Stimme, dieser Persönlichkeit in Verehrung zugetan, sondern auch ein Regisseur der neuen Generation: Walter Felsenstein, der sie an die von ihm gegründete Komische Oper nach Berlin lockt – an jenes Haus, das der DDR künstlerische Emanzipation erringen sollte. Ihre frappante schauspielerische Ausdruckskraft hat sie diesem großen Regisseur zu verdanken. Die Berliner Zeitung berichtet: „Seit Jahren ist Elfride Trötschel Liebling der Dresdener und da die Fachpresse ihre Stimme als eine der schönsten rühmt, ist es verständlich, dass die Künstlerin von der dortigen Staatsoper bestens behütet wird – aber wozu heißt ein tüchtiger Intendant Felsenstein, wenn er nicht imstande wäre, auch eine felsenfeste Bindung ein wenig zu lockern? Für die Rolle der Eurydike in Offenbachs Orpheus in der Unterwelt gelang es ihm, die Trötschel nach Berlin zu holen.“
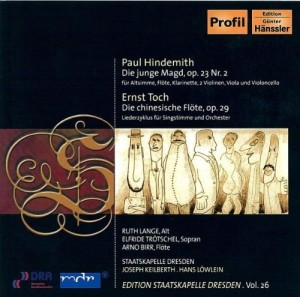
Zeitgenössisches: Ein weiteren Titel mit Elfride Trötschel im Katalog von Hänssler
Da ab den frühen 50er Jahren in der DDR zunehmend die Politik den Spielplan bestimmt und der Name großer Musiker und Dirigenten auf „schwarze Listen“ gesetzt werden, wechselt Elfride Trötschel 1953 endgültig an die Städtische Oper nach West-Berlin, nachdem sie schon zuvor im Westen aufgetreten war und auch erfolgreiche Schallplattenaufnahmen eingespielt hatte. In den ihr noch verbleibenden Lebensjahren findet ihr Ruf als Lyrische Sopranistin in ganz Europa Anerkennung: Edinborough, Glyndebourne-Festival, Hamburg, München, Bordeaux, Wien, Rom und Salzburg locken mit interessanten Aufgaben und nichts scheint ihr zu viel zu werden. In einem Brief berichtet sie, dass sie an der Wiener Staatsoper drei große Partien in nur vier Tagen gesungen habe: die Michaela in Bizets Carmen, die Pamina in Mozarts Zauberflöte und das Evchen in Wagner Die Meistersinger von Nürnberg! Und immer, wenn es der Terminkalender zulässt, kommen Konzerte dazu: „Das Unaufhörliche“ von Paul Hindemith, „Von Deutscher Seele“ von Hans Pfitzner, König David von Arthur Honegger, „Der Wein“ von Alban Berg, „Die Chinesische Flöte“ von Ernst Toch, „Carmina burana“ und „Trionfo di Aphrodite“ sowie „Catulli carmina“ von Carl Orff – unter dem Komponisten selbst oder unter Ference Fricsay, dessen Sohn Andrasch sich heute als Regisseur einen Namen gemacht hat.

Butterfly 1947 auf der Behelfsbühne in Dresden
Die jugendliche Elastizität ihres lyrischen Stimmmaterials hat sie sich durch eine stetige und intensive Beschäftigung mit dem klassischen und modernen Liedgut zu erhalten gewusst und die mühelose tonale Ansprache auch bei zartestem Pianissmo vermag die emotionale Botschaft dieser musikalischen Kleinodien vollendet zu offenbaren. Diese Lieder sind es auch, die ich als Kind bei uns zu Hause so oft gehört habe, dass ich sie zur Überraschung meiner Mutter auf einmal mitgesungen habe. Von diesen intimen Hauskonzerten liegen auch Aufnahmen vor, die ein Freund unserer Familie mit einem damals hochmodernen Heimtonbandgerät gemacht hat. Neben der klassischen Oper erschloss sich meine Mutter in den 50er Jahren auch viele Werke zeitgenössischer Opernkomponisten. Ihr Rollenspektrum wurde dabei unter anderem durch folgende Partien bereichert: Die Sophie im Rosenkavalier und Zdenka in Arabella von Richard Strauss, Margiana im Barbier von Bagdad von Peter Cornelius, Harriet in der Die Flut von Boris Blacher, Ninabella in Werner Egk´s Zaubergeige, Manon Lescaut im Boulevard solitude von Hans Werner Henze, Frau Bürstner und Fräulein Leni sowie Gerichtsdienerfrau in Der Prozess von Gottfried von Einem nach Franz Kafka, die Solveigh in Peer Gynt von Werner Egk. Besonders erwähnenswert ist Die Heilige von der Bleekerstreet von Gian Carlo Menotti, in der ein armes Mädchen in fieberhaften Trancezuständen die Stigmata empfängt, jene Wunden, die auch Jesus am Kreuz empfangen hat. Die Arbeit an dieser Rolle erfüllte sie mit mehr als nur Interesse. Sie beschäftigte sich intensiv mit der Mystik der Stigmata und suchte Therese von Konnersreuth auf, die stigmatisierte Landfrau. Und mit dieser Kenntnis und innerstem Ergriffensein gestaltete sie diese Rolle. Das Publikum wurde in diese mystische Verklärung mit einbezogen, war tief betroffen, und das hat dieser heute längst wieder vom Spielplan verschwundenen Oper eine ungeheure Wirkung verschafft. Das Werk verschwand mit ihrem Tod. Es konnte so nicht wieder besetzt werden.
Was ist geblieben von dieser Dresdner Kammersängerin, was ist ihr künstlerisches Vermächtnis? * Sie hat mit dem wunderbaren Ensemble der Dresdener Staatsoper in schwerster Zeit den Menschen Tröstungen und Linderung durch ihren Gesang geschenkt. * Sie hat die Dresdener Opernkultur wesentlich durch ihre sanft- lyrische Stimmrichtung mitgestaltet. * Sie hat den Slawischen und zeitgenössischen Operngestalten Wärme und Wahrhaftigkeit verliehen. * Sie hat sich immer zu ihrer Heimat Dresden bekannt und auch dort ihre letzte Ruhestätte gefunden. * Eine Straße in Dresden ist nach Elfride Trötschel benannt.
Im Mai 1958 steht sie zum letzten Mal auf dem Podium: Unter Joseph Keilberth singt sie in Wien das Sopransolo von den „himmlischen Freuden“ in Gustav Mahlers Vierter Sinfonie. Einen Monat später ist sie tot – plötzlich herausgerissen aus einer Karriere, die ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hatte. Der Regisseur Walter Felsenstein schrieb in seinem Nachruf: Die von Elfride Trötschel gesungenen Partien ergeben den besten Beweis für die ganz ungewöhnliche Vielfalt dieser großen Begabung, die über ihren Fleiß, über ihr großes technisches Können hinaus Beziehungen zu Bezirken hatte, die nur ganz großen Künstlern zugänglich sind. (Der Beitrag von Andreas Trötschel und die Fotos stammen aus dem Booklet und wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt.)

Elfride Trötschel mit ihrem Sohn Andreas im Alter von vierzehn Monaten – ein Foto von 1946
 Auf der CD Sarasate, Music for Violin 4 (8.572276) finden sich Fantasien über Mozarts Don Giovanni und Webers Freischütz, die – von der jungen Geigerin Tianwa Yang mit schönem lyrischen Ton vorgetragen – auf Anhieb bezaubern und die Ohrwürmer aus den beiden Opern in ungewohnter Form präsentieren. Der Gitarristin Kyuhee Park ist eine Solo-CD (8.573225) gewidmet, auf der die Gewinnerin der „Alhambra International Guitar Competition“ mit Sonaten von Scarlatti, Diabelli, u.a. brilliert. Weit zurück in die Musikgeschichte führt die Naxos-CD 8.573119. Die Organistin Julia Brown spielt Werke von Heinrich Scheidemann (1595-1663). Mit der Fantasie über „Vom Himmel hoch“ begegnet man auch hier alten Bekannten. Aber auch lebende Komponisten kommen bei Naxos durchaus zum Zuge: Peteris Vasks (Jahrgang 1946) ist eine CD ausschließlich mit Werken für Flöte gewidmet (8.572634) Chorwerke der beiden Briten Jeremy Filsell und David Briggs finden sich auf einer weiteren Neuerscheinung (8.573111).
Auf der CD Sarasate, Music for Violin 4 (8.572276) finden sich Fantasien über Mozarts Don Giovanni und Webers Freischütz, die – von der jungen Geigerin Tianwa Yang mit schönem lyrischen Ton vorgetragen – auf Anhieb bezaubern und die Ohrwürmer aus den beiden Opern in ungewohnter Form präsentieren. Der Gitarristin Kyuhee Park ist eine Solo-CD (8.573225) gewidmet, auf der die Gewinnerin der „Alhambra International Guitar Competition“ mit Sonaten von Scarlatti, Diabelli, u.a. brilliert. Weit zurück in die Musikgeschichte führt die Naxos-CD 8.573119. Die Organistin Julia Brown spielt Werke von Heinrich Scheidemann (1595-1663). Mit der Fantasie über „Vom Himmel hoch“ begegnet man auch hier alten Bekannten. Aber auch lebende Komponisten kommen bei Naxos durchaus zum Zuge: Peteris Vasks (Jahrgang 1946) ist eine CD ausschließlich mit Werken für Flöte gewidmet (8.572634) Chorwerke der beiden Briten Jeremy Filsell und David Briggs finden sich auf einer weiteren Neuerscheinung (8.573111). Der Böhme Bohuslav Martinu hat neben Orchesterwerken auch zahlreiche Lieder geschrieben. Auf der CD Songs 2 (8.572) interpretiert die Mezzo-Sopranistin Jana Wallingerova leider nicht ohne ein Quentchen Schärfe in der Stimme diese reizvollen Miniaturen im Volkston. Das australische Kungsbacka Piano Trio stellt Kammermusik von Gabriel Fauré vor (8.573042), der Pianist Idil Biret nimmt sich auf zwei CDs (8.57301-02) des gesamten Klavierwerks von Paul Hindemith an, selten gehörte Stücke, die durch die Originalität der musikalischen Einfälle beeindrucken. Die vierte Symphonie von Sergey Prokofiev spielte das Sao Paulo Symphony Orchestra unter der Dirigentin Marin Alsop in der revidierten Fassung von 1947 ein, die CD (8.573186) enthält außerdem die Ballett-Musik zu L’enfant prodigue von 1928. Reizvoll ist die Kombination des 1. Violinkonzerts von Dimitry Shostakovich mit Gesungene Zeit von Wolfgang Rihm. Der Geiger Jaap van Zweden interpretiert beide Werke mit bewundernswerter Virtuosität und Kompetenz (8.573271).
Der Böhme Bohuslav Martinu hat neben Orchesterwerken auch zahlreiche Lieder geschrieben. Auf der CD Songs 2 (8.572) interpretiert die Mezzo-Sopranistin Jana Wallingerova leider nicht ohne ein Quentchen Schärfe in der Stimme diese reizvollen Miniaturen im Volkston. Das australische Kungsbacka Piano Trio stellt Kammermusik von Gabriel Fauré vor (8.573042), der Pianist Idil Biret nimmt sich auf zwei CDs (8.57301-02) des gesamten Klavierwerks von Paul Hindemith an, selten gehörte Stücke, die durch die Originalität der musikalischen Einfälle beeindrucken. Die vierte Symphonie von Sergey Prokofiev spielte das Sao Paulo Symphony Orchestra unter der Dirigentin Marin Alsop in der revidierten Fassung von 1947 ein, die CD (8.573186) enthält außerdem die Ballett-Musik zu L’enfant prodigue von 1928. Reizvoll ist die Kombination des 1. Violinkonzerts von Dimitry Shostakovich mit Gesungene Zeit von Wolfgang Rihm. Der Geiger Jaap van Zweden interpretiert beide Werke mit bewundernswerter Virtuosität und Kompetenz (8.573271). Gleich zwei CDs würdigen den ungarisch-stämmigen amerikanischen Komponisten Miklós Rózsa, der vor allem durch seine Film-Musiken größere Popularität erlangt hat. Wer erinnert sich nicht an seine, die Spannung noch steigernde Musik zum Wagenrennen in „Ben Hur“? Das BBC Philharmonic Orchestra unter Rumon Gamba hat auf der prall gefüllten Film-Music-CD – die bei Chandos herausgegeben wurde (CHAN 10806) – noch zusätzlich die Suiten „Dieb von Bagdad“, „Dschungel-Buch“ und „Sahara“ eingespielt. Sie wecken schöne Erinnerungen an diese alten, heute schon als Kult gehandelten Filme. Mit einem ganz anderen Rozsa – und damit zurück zu Naxos – macht die Einspielung seiner Streichquartette und des Streichtrios bekannt. Roszsa, der ursprünglich in Leipzig Musik studiert hatte, übrigens gleichzeitig mit Wolfgang Fortner, kann zur gemäßigten Moderne gezählt werden. Seine Kammermusik enthält Anklänge an die ungarische Folklore, hat aber einen durchaus eigenständigen Charakter. Dem jungen britischen Tippett-Quartett gelingt auf der eine überzeugende Interpretation (8.572903).
Gleich zwei CDs würdigen den ungarisch-stämmigen amerikanischen Komponisten Miklós Rózsa, der vor allem durch seine Film-Musiken größere Popularität erlangt hat. Wer erinnert sich nicht an seine, die Spannung noch steigernde Musik zum Wagenrennen in „Ben Hur“? Das BBC Philharmonic Orchestra unter Rumon Gamba hat auf der prall gefüllten Film-Music-CD – die bei Chandos herausgegeben wurde (CHAN 10806) – noch zusätzlich die Suiten „Dieb von Bagdad“, „Dschungel-Buch“ und „Sahara“ eingespielt. Sie wecken schöne Erinnerungen an diese alten, heute schon als Kult gehandelten Filme. Mit einem ganz anderen Rozsa – und damit zurück zu Naxos – macht die Einspielung seiner Streichquartette und des Streichtrios bekannt. Roszsa, der ursprünglich in Leipzig Musik studiert hatte, übrigens gleichzeitig mit Wolfgang Fortner, kann zur gemäßigten Moderne gezählt werden. Seine Kammermusik enthält Anklänge an die ungarische Folklore, hat aber einen durchaus eigenständigen Charakter. Dem jungen britischen Tippett-Quartett gelingt auf der eine überzeugende Interpretation (8.572903).







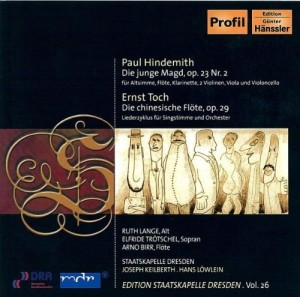





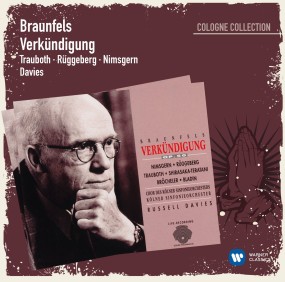



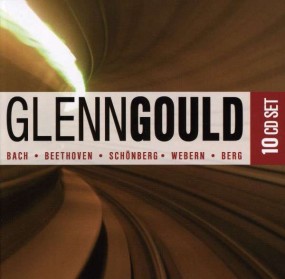


 Und offenbar liegt eine solche Gestaltung im derzeitigen Trend, denn auch die neue CD des Italieners Filippo Mineccia bei Pan Classics (PC 10297 im Vertrieb von note 1 music) mit dem Titel Alto Arias würde man eher ins Pop-Regal einordnen. Sie zeigt den Sänger Zähne fletschend mit kurz rasiertem Schädel und offenem schwarzem Military-Jackett wie einen Skinhead, was einen seriösen Musikliebhaber eigentlich abstoßen dürfte. Und die Stimme gleicht diesen optischen Vorbehalt nicht aus, sie klingt oft unangenehm krähend und schneidend in der Höhe. Einzig das Programm, 14 Arien aus Opern und Oratorien sowie einer Serenata von Leonardo Vinci, die der Komponist ausnahmslos für die Altstimme schrieb, ist bei dieser Ausgabe von Interesse. Und auch das begleitende Ensemble, Stile Galante unter Stefano Aresi, erweist sich als versierter und inspirierender Partner für den Solisten. Der italienische Komponist und einer der größten Konkurrenten von Nicola Porpora ist seit der sensationellen Veröffentlichung seines Artaserse bei Virgin mit nicht weniger als fünf Altisten/Sopranisten, an die hinsichtlich der gesanglichen Virtuosität horrende Anforderungen gestellt werden, wieder aktuell im Gespräch. Auch bei dieser Auswahl, die mit der Arie „Bella pace“ aus der Oper Gismondo re di Polonia beginnt, ist solch exorbitante Gesangskunst unabdingbar, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Und offenbar liegt eine solche Gestaltung im derzeitigen Trend, denn auch die neue CD des Italieners Filippo Mineccia bei Pan Classics (PC 10297 im Vertrieb von note 1 music) mit dem Titel Alto Arias würde man eher ins Pop-Regal einordnen. Sie zeigt den Sänger Zähne fletschend mit kurz rasiertem Schädel und offenem schwarzem Military-Jackett wie einen Skinhead, was einen seriösen Musikliebhaber eigentlich abstoßen dürfte. Und die Stimme gleicht diesen optischen Vorbehalt nicht aus, sie klingt oft unangenehm krähend und schneidend in der Höhe. Einzig das Programm, 14 Arien aus Opern und Oratorien sowie einer Serenata von Leonardo Vinci, die der Komponist ausnahmslos für die Altstimme schrieb, ist bei dieser Ausgabe von Interesse. Und auch das begleitende Ensemble, Stile Galante unter Stefano Aresi, erweist sich als versierter und inspirierender Partner für den Solisten. Der italienische Komponist und einer der größten Konkurrenten von Nicola Porpora ist seit der sensationellen Veröffentlichung seines Artaserse bei Virgin mit nicht weniger als fünf Altisten/Sopranisten, an die hinsichtlich der gesanglichen Virtuosität horrende Anforderungen gestellt werden, wieder aktuell im Gespräch. Auch bei dieser Auswahl, die mit der Arie „Bella pace“ aus der Oper Gismondo re di Polonia beginnt, ist solch exorbitante Gesangskunst unabdingbar, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
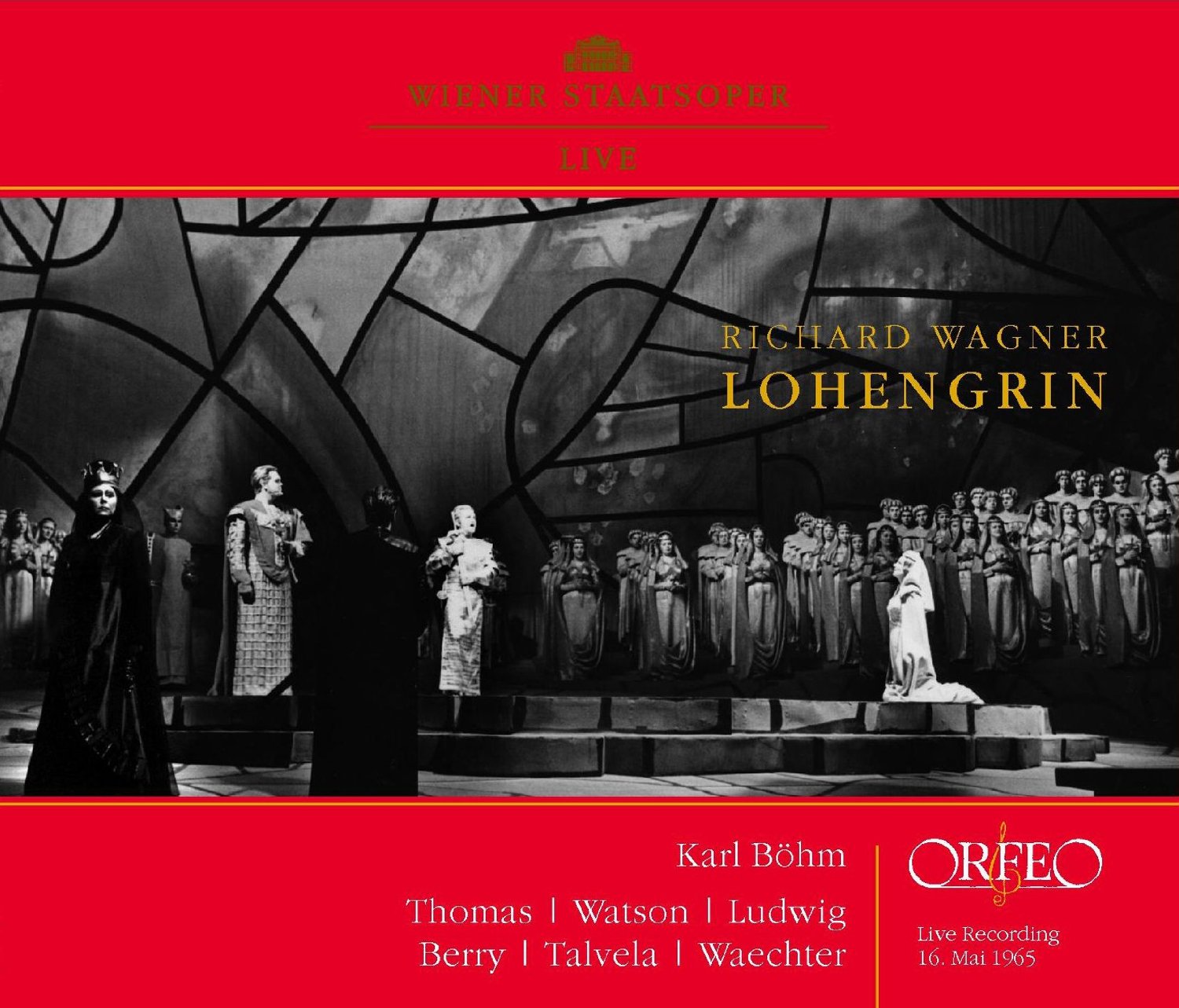




 Eine andere wichtige Facette ihres Wirkens waren Lieder von Hanns Eisler, die sie auch live bei Auftritten im Ausland vorgetragen hat. Der Komponist selbst schätze ihre Intelligenz, ihre Anmut, aber auch ihre Härte und ihren Ernst. „Dazu kamen echter Fleiß und der Wille, es immer besser zu machen, der gute Ehrgeiz, der vorwärts treibt“, so Eisler über die Arnold. Während das Füchslein als Film überdauert hat, ist ihre Violetta in Verdis La Traviata – das berühmte Gegenstück ihrer langen Karriere – als Ganzes nur in der Erinnerung von Zeitzeugen und in Beschreibungen bewahrt. Es dürfte keinen Mitschnitt geben. Dabei soll sie weniger durch ihre stimmlichen Mittel, die auch begrenzt gewesen sind, als vielmehr durch ihre Ausstrahlung zu einer Wahrhaftigkeit gelangt sein, die das Publikum tief bewegte und erschütterte.
Eine andere wichtige Facette ihres Wirkens waren Lieder von Hanns Eisler, die sie auch live bei Auftritten im Ausland vorgetragen hat. Der Komponist selbst schätze ihre Intelligenz, ihre Anmut, aber auch ihre Härte und ihren Ernst. „Dazu kamen echter Fleiß und der Wille, es immer besser zu machen, der gute Ehrgeiz, der vorwärts treibt“, so Eisler über die Arnold. Während das Füchslein als Film überdauert hat, ist ihre Violetta in Verdis La Traviata – das berühmte Gegenstück ihrer langen Karriere – als Ganzes nur in der Erinnerung von Zeitzeugen und in Beschreibungen bewahrt. Es dürfte keinen Mitschnitt geben. Dabei soll sie weniger durch ihre stimmlichen Mittel, die auch begrenzt gewesen sind, als vielmehr durch ihre Ausstrahlung zu einer Wahrhaftigkeit gelangt sein, die das Publikum tief bewegte und erschütterte.
 Noch erheblicher macht sich die Abwesenheit geeigneter Sänger in der Einspielung Gergievs bemerkbar. Zwar holt er sich mit René Pape einen idiomatisch sauber singenden Wotan ins Studio, der aber als Figur insgesamt sehr blass und glanzlos bleibt. Der zweite deutsche Import, Stephan Rügamer als Loge ist sogar eine eklatante Fehlbesetzung. Auch hier sind es wieder die Riesen, die am ehesten punkten können. Evgeny Nikitin (Fasolt) und Mikhail Petrenko (Fafner) sind ausgesprochen authentische Raubeine. Der Rest der Besetzung ist ihren Rollen weder idiomatisch noch stimmlich gewachsen. Der Alberich Nikolai Putilins gerät geradezu zu einer Parodie seiner Rolle, an Unverständlichkeit wetteifert er mit den Rheintöchtern Dombrovskaya, Vasileva, und Sergeeva. Die sonst so zuverlässige Ekaterina Gubanova als Fricka singt eben so unschön und tremololastig wie Viktoria Yastrobova (Freia) und Zlata Bulycheva (Erda). Die Freigabe dieser Aufnahme kann auch nur durch des Deutschen nicht Mächtige erfolgt sein. Da können auch Gergievs zugegeben sehr gutes Dirigat und das konzentriert spielende Mariinski Orchester nichts mehr retten, das ist Wagner zum Abgewöhnen!
Noch erheblicher macht sich die Abwesenheit geeigneter Sänger in der Einspielung Gergievs bemerkbar. Zwar holt er sich mit René Pape einen idiomatisch sauber singenden Wotan ins Studio, der aber als Figur insgesamt sehr blass und glanzlos bleibt. Der zweite deutsche Import, Stephan Rügamer als Loge ist sogar eine eklatante Fehlbesetzung. Auch hier sind es wieder die Riesen, die am ehesten punkten können. Evgeny Nikitin (Fasolt) und Mikhail Petrenko (Fafner) sind ausgesprochen authentische Raubeine. Der Rest der Besetzung ist ihren Rollen weder idiomatisch noch stimmlich gewachsen. Der Alberich Nikolai Putilins gerät geradezu zu einer Parodie seiner Rolle, an Unverständlichkeit wetteifert er mit den Rheintöchtern Dombrovskaya, Vasileva, und Sergeeva. Die sonst so zuverlässige Ekaterina Gubanova als Fricka singt eben so unschön und tremololastig wie Viktoria Yastrobova (Freia) und Zlata Bulycheva (Erda). Die Freigabe dieser Aufnahme kann auch nur durch des Deutschen nicht Mächtige erfolgt sein. Da können auch Gergievs zugegeben sehr gutes Dirigat und das konzentriert spielende Mariinski Orchester nichts mehr retten, das ist Wagner zum Abgewöhnen!
