Die Neuveröffentlichung der Samaras-Oper Mademoiselle de Belle-Isle unter Byron Fidetzis nun bei Naxos (2 CD 8.660508-09; französisches Libretto von Paul Millet nach Dumas findet sich online) ist Grund für uns, den Komponisten Spiros (Spyridon-Filiskos) Samara/s, Griechenlands großen Komponist (1861 – 1917) nach unserem Artikel über seine Oper Rhea erneut vorzustellen, denn außerhalb Griechenlands ist er kaum bekannt. Es gab manche seiner Opern, und auch einige seiner früheren Landsmänner Pavlos Carrer oder Dimitri Mitropoulos, bei der leider inzwischen verstorbenen griechischen CD-Firma Lyra, von denen ein paar ihren weg zu youtube gefunden haben. Wir bei operalounge.de haben ja reichlich über den spiritus rector der griechischen Musik, Byron Fidetzis, und über Opern wie die Rhea/Samaras, Marcos Botzaris/Carrer oder Soeur Béatrice/ Mitropoulos berichtet.
.
 Die nun bei Naxos dankenswerter Weise neu veröffentlichte Mademoiselle de Belle-Isle nach dem Roman von Alexandre Dumas auf das Libretto von Paul Millet ist m. W. die erste Samaras-Oper und wohl auch die erste griechische Oper überhaupt auf einem westlichen internationalen Label. Wieder singt Fidetzis´ nationalsprachiche Hausbesetzung (Martha Arapis in der Titelrolle, dazu Tassis Chrstioyannis, der seit der Konzertaufnahme 1995 in Sofia stramme Karriere vor allem in Frankreich und im Barocken gemacht hat, sowie Angelos Simos, Pavlos Maropoulos, Pantalis Kontos und auch die renommierte Sopranistin Marina Krilovici, Ehefrau das dto. bekannten Baritons Kostas Paskalis und Titelsängerin der ebenfalls auf CD erschienenen Samaras-Oper La Martire/youtube). Dazu spielt und singt das Pazardzik Symphony Orchestra (Georgi Koev) und der Kaval Choir Sofia (Michail Milkov) unter der Leitung des genialen Dirigenten und Musikwissenschaftlers Byron Fidetzis. Ohne dessen unermüdliche Energie wären wir um manche griechische Musik ärmer, hat er doch – wie auch hier – Fehlendes ergänzt und die musikalischen Editionen übernommen, ob nun bei Mitropoulos, Carrer, Samaras, Skalkotta, Kalafati, Kalomiris und vielen anderen mehr. Youtube ist voll mit den Dokumenten seines Wirkens.
Die nun bei Naxos dankenswerter Weise neu veröffentlichte Mademoiselle de Belle-Isle nach dem Roman von Alexandre Dumas auf das Libretto von Paul Millet ist m. W. die erste Samaras-Oper und wohl auch die erste griechische Oper überhaupt auf einem westlichen internationalen Label. Wieder singt Fidetzis´ nationalsprachiche Hausbesetzung (Martha Arapis in der Titelrolle, dazu Tassis Chrstioyannis, der seit der Konzertaufnahme 1995 in Sofia stramme Karriere vor allem in Frankreich und im Barocken gemacht hat, sowie Angelos Simos, Pavlos Maropoulos, Pantalis Kontos und auch die renommierte Sopranistin Marina Krilovici, Ehefrau das dto. bekannten Baritons Kostas Paskalis und Titelsängerin der ebenfalls auf CD erschienenen Samaras-Oper La Martire/youtube). Dazu spielt und singt das Pazardzik Symphony Orchestra (Georgi Koev) und der Kaval Choir Sofia (Michail Milkov) unter der Leitung des genialen Dirigenten und Musikwissenschaftlers Byron Fidetzis. Ohne dessen unermüdliche Energie wären wir um manche griechische Musik ärmer, hat er doch – wie auch hier – Fehlendes ergänzt und die musikalischen Editionen übernommen, ob nun bei Mitropoulos, Carrer, Samaras, Skalkotta, Kalafati, Kalomiris und vielen anderen mehr. Youtube ist voll mit den Dokumenten seines Wirkens.
.
Die Tatsache, dass Samaras´ Rhea (youtube) die einzige Oper im internationalen Kanon ist, die das Thema der Wiedererstehung der Olympiade zum Thema hat, ließ sie eine ideale Wahl zur Aufführung bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 sein. Und dazu ist sie auch noch als Oper ein Meisterwerk, das Zeugnis von einer der fruchtbarsten Epochen der griechischen und abendländischen Musik ablegt – dies zu einer Zeit, als Griechenland musikalisch eng mit ltalien verbunden war. Rhea ist eine Oper von internationalem Prestige, so würde man meinen.

Foto von Spiros Samara mit Widmung 1913/ Samara Archive/Lyra
Im Theater van San Giacomo auf Samaras Geburtsinsel Korfu, eines der wichtigsten des westlichen Mittelmeeres, hatte es stets ein Hin und Her an Opernaufführungen nach 1771 durch bedeutende italienische Truppen gegeben, was einen farbenprächtigen kulturellen Trend zur Frage hatte. Oper schlug als westeuropäisches Genre auf den übrigen ionischen lnseln ebenfalls Wurzeln und blieb dort auch während des Britischen Protektorats (1814 – 64) heimisch. Während dieser Periode kann man das zeitlich parallele Zutagetreten von Dutzenden hochbegabter griechischer Komponisten beobachten – ein weltweit einzigartiges Phänomen –, als ob der Deckel einer Schachtel abgehoben worden wäre. Der erste war Nikolaos Halikiopoulous-Mantzaros (1795 – 1872), der die Dichtung des Dionysios Solomons, „Hymne an die Freiheit“, in Musik setzte und der als Lehrer die Komponisten-Generation der lonischen lnseln auf das neapolitanische Konservatorium San Pietro a Maiella vorbereitete. 1840 war Korfu bereits reif genug für eine eigene Musikakademie internationalen Zuschnitts. Der Ecumenische Patriarch jedoch machte sich Sorgen, die lnseln seien unter den Einfluss der verderbten Franken gefallen. Die Akademie wurde hastig unter die Oberaufsicht des orthodoxen Klerus gebracht und verkümmerte nach dem Tode Mantzaros‘ zu einer unbedeutenden Banda-Schule, die nur noch bei Festlichkeiten spielte. Dem griechischen Klerus, der ganz vehement die westliche Musik bekämpfte, folgten später als Leitung der Akademie der Multimillionar Andreas Syngros und der Komponist Manolis Kalomiris, beide umtriebige Anhänger des ideologischen Konstruktes, das Griechenlands enge Verbindung zum Osten stützte.
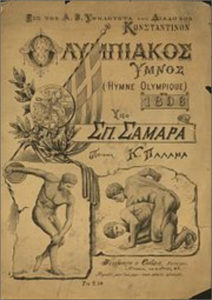
Samaras Olympische Hymne aus „Rhea“/ Wikipedia
Beide bekämpften auch die lonischen lnselbewohner und eben Samara und brachten damit die griechische Musik um ihre internationale Komponente. Vor allem Syngros, der im Handel mit den Türken ein Vermögen verdient hatte und der durchaus als verlängerter Arm des untergehenden osmanischen Reiches angesehen werden kann, spielte mit seiner Hinhalte- und Verzögerungstaktik (er kaufte sogar das Athener Theater, um Samara nicht aufführen zu lassen) eine ganz unrühmliche Rolle. Und bis heute schwelt dieser Konflikt zwischen Verachtung der westlichen kulturellen Werte und der schon trotzigen Anklammerung Griechenlands an den Westen. Die griechische Gesellschaft schien bis noch vor wenigen Jahren als Ganzes nicht sonderlich an ihren Wurzeln auch im Westen interessiert zu sein, wie der fast alleinige Kampf des Pioniers und Dirigenten Byron Fidetzis im Ringen um die Wiederentdeckung der inzwischen fast unbekannten griechischen Musik nach der Befreiung von den Türken demonstriert. Es ist ebenso bezeichnend, dass Fidetzis fast alle seine Wiederaufführungen und Einspielungen mit bulgarischen Musikern und Chören machen musste und dass nur recht wenige griechische Sänger von Rang „zu Hause“ geblieben sind und für Aufnahmen dieser inzwischen vergessenen Werke zur Verfügung stehen.
.

„Mademoiselle de Belle-Isle“/ Samaras/Szene der Aufführung in Athen 1997 mit Martha Arapis und Angelos Simos/ youtube
Zurück zur Mademoiselle de Belle-Isle: Im Folgenden bringen wir einen längeren Text zum Komponisten Spiros Samaras des renommierten Musikwissenschaftlers George Leotskos sowie eine Art Rechenschaftsbericht von Byron Fidetzis, der die letzten beiden Akte der Oper ergänzt und musikalisch ediert hat. Beide Artikel entnahmen wir der Beilage zur neuen Naxos-Ausgabe in der Übersetzung von Daniel Hauser und danken allen dreien. G. H.
Spyridon Samaras war zweifellos der international bedeutendste griechische Komponist seiner Zeit, der erste, der im Ausland verehrt wurde und der bedeutendste der Zweiten Ionischen Musikschule. Sein Beitrag zur veristischen italienischen Oper des späten 19. bis frühen 20. Jahrhunderts wird allmählich, aber zunehmend entdeckt.
.
Samaras wurde am 17. November 1861 auf Korfu als Sohn des griechischen Vizekonsuls Skarlatos Samaras und von Fani, geb. Courtenay, geboren. Sein Musikstudium begann er in Korfu unter anderem bei Spyridon Xyndas (1810–1896). Kurz nach dem Tod seines Vaters schrieb er sich 1875 am neu gegründeten Athener Konservatorium ein. Seine Lehrer waren Federico Bolognini senior (Violine), Angelo Mascheroni und vor allem Enrico Stancampiano (Musiktheorie, Orchestrierung). In der Zwischenzeit begann er seine ersten Werke zu komponieren, von denen die meisten bis 1985 als verschollen galten: Die Fantasie über Errico Petrellas Oper La Contessa d’Amalfi (von ihm selbst aufgeführt am 17. Juni 1877 am Athener Konservatorium), die Sérénade, gewidmet Königin Olga (1876 oder 1877) und die Melancholischen Reflexionen über den Tod von Cpt Vourvachis, alles Werke für Klavier, gefunden in undatierten italienischen Publikationen von Luigi Trebbi, Bologna. Einige Stücke, auf die in literarischen Quellen verwiesen wurde, werden noch immer vermisst – Die Jugend, Walzer für Klavier (1879), komponiert mit seinem Landsmann Joseph Kaisaris (1845–1923), seine Lieder für Vlasis Gavrielides (1848–1920), die Komödie Torpedos (Torpillai) von 1879, die Sonate für Violine und Klavier (1880); das Ave Maria für Tenor und Klavier (1880), hauptsächlich aber die Oper Olao in vier Akten, komponiert in Zusammenarbeit mit seinem Lehrer Stancampiano (Auszüge wurden am Athener Konservatorium aufgeführt), am 12. Januar 1880.
.

„Mademoiselle de Belle-Isle“/Samaras: Martha Arapis in der Athener Aufführung von 1997/ youtube
Ende 1881 oder Anfang 1882 ging Samaras nach Paris, um eine höhere Ausbildung zu absolvieren. Er wurde Mitglied der Pariser Aristokratie, während er vom musikliebenden, philhellenischen Marquis De Queux de Saint-Hilaire und der Fürstin Trubetzkoy beschützt wurde, und war in Verbindung mit dem Gelehrten Demetrios Vikelas (1835-1908) und dem Tenor Ioannis Kritikos, vor allem aber dem Bariton Aramis (dessen echte Name Perikles Aravantinos war, 1854?/1857?–1932). Er studierte auf unbestimmte Zeit bei dem Komponisten und Theoretiker Théodore Dubois (1837–1924) und schrieb sich am Pariser Konservatorium in der Klasse von Léo Delibes (1836–1891) ein, der von vielen als sein wichtigster Lehrer nach Stancampiano angesehen wird. Eine angebliche Lehrzeit bei Charles Gounod (1818–1893) ist unwahrscheinlich, doch soll dieser Samaras zu seiner Chitarrata (1885) in einem der wenigen Pariser Konzerte mit diesem Werk gratuliert haben.
Eine fast fünfjährige Lücke in den Aufzeichnungen des Pariser Konservatoriums über die Inskription von Studenten in Kurse ermöglicht es uns, Samaras‘ Karriere in Paris nur anhand der erhaltenen Veröffentlichungen seiner Werke zu verfolgen. So wurden einige seiner in Griechenland unbekannten Werke entdeckt: Chitarrata, Edition für Klavier, V. Durdilly et Cie (Paris, 1885), Sérénade Chinoise, Dichtung von Paul Milliet (1848–1924), Edition A. Quinzard et Cie (Paris, 1892) und zwei Walzer für das Klavier; Chamant, Edition A. Quinzard et Cie (Paris, 1893) und Les Charmettes, Edition Leon Grus (Paris, 1902).
.

Der Musikwissenschaftler Georges (Giorgos) Leotsakos/ Wikipedia
Trotz gelegentlichem Lob von Persönlichkeiten wie den Komponisten Delibes, Massenet, Alfred Bruneau und Georges Hüe, verlegte Samaras seine künstlerische Tätigkeit 1885 nach Italien, nachdem der Mailänder Verlag Ricordi die Scènes Orientales, Vier charakteristischen Suiten für Klavier vierhändig (Edition Ricordi-V. Durdilly, Paris 1883) und seinen Klavierromanzen gekauft hatte, obwohl er während seiner Pariser Zeit (Frühjahr 1883) mit der Komposition seiner Oper Medgé begonnen hatte, deren Handlung auf einer indischen Geschichte basierte. Die folgenden 26 Jahre seiner Karriere waren mit Ricordis großem Konkurrenten, dem Mailänder Verleger Edoardo Sonzogno (1836–1920), verbunden. Librettist für zwei der drei Opern seiner Jugend war sein lebenslanger Freund und Bewunderer Ferdinando Fontana (1850–1919), Autor des Textes zu Puccinis ersten beiden Opern. Samaras zweite Oper Flora mirabilis (Oper in drei Akten, uraufgeführt am 16. Mai 1886 am Teatro Carcano, Mailand) mit Fontanas Libretto war ein Triumph, wurde aber erst nach 1887 international bekannt (aufgeführt in Köln, Wien und sogar Argentinien), nachdem sie an der Mailänder Scala mit der angesehenen Emma Calvé in der Hauptrolle aufgeführt worden war.
.

„Mademoiselle de Belle-Isle“/Samara: der Dichter und Librettist Paul Millet/ Wikipedia
Der Erfolg von Samaras begeisterte Griechenland, dem er sich nie entfremdet hatte. Der früheste bekannte griechische biographische Text über Samaras wurde von Konstantinos F. Skokos im August 1886 verfasst. Medgé, eine Oper in vier Akten mit einem Text von Pierre Elzéar, übersetzt von Fontana ins Italienische, wurde am 11. Dezember 1888 im Costanzi-Theater in Rom erfolgreich inszeniert. Die Calvé war erneut der Star unter dem Taktstock des damals führenden italienischen Dirigenten Leopoldo Mugnone. Flora mirabilis („Die wundersame Blume“) war jedoch die einzige Oper, die 1889 in Griechenland aufgeführt wurde, mit drei Aufführungen in Korfu ab 5. Februar, Produktionen in Athen von Oktober bis November und fünf Aufführungen einer französischen Theatergruppe anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Konstantin. Aus Samaras dritter Oper Lionella (drei Akte, mit einem Libretto von Fontana) entdeckte Dirigent Byron Fidetzis im Athener Konservatorium einen Orchesterauszug, die Ungarische Rhapsodie. Im April 2010 entdeckte der Musikwissenschaftler Alexandros Hadjikyriakos jedoch den gesamten Gesangsauszug von Lionella (Edition Sonzogno, 1891). Diese Entdeckung bestätigte zweifelsfrei die Überzeugung, dass die heftige Missbilligung von Lionella an der Mailänder Scala (4. April 1891) auf Ricordis Intrigen zurückzuführen war; er war ein rachsüchtiger Gegner Sonzognos, und Samaras war zu diesem Zeitpunkt „weitergezogen“. Diese beeindruckende, meisterhaft für die Bühne konzipierte Partitur besticht auch durch die Originalität ihres Melodieflusses (und sie ist 2023 in der neuen Instrumentierung nach Athen zurückgekehrt, in einem beeindruckenden Konzert/youtube unter Fidezis selbst/ G. H.)
.
 Es folgte die einzigartige Oper La Martire („Der Märtyrer“/Lyra/youtube) (drei Akte, mit einem Libretto von Luigi Illica, uraufgeführt am 23. Mai 1894 am Mercadante-Theater in Neapel) und war ein großer Erfolg für Samaras, der ihn als einen Pionier des Verismo ausweis. 1896 komponierte er eine ganze Kantate für die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit nach einem Text des Dichters Kostis Palamas, welcher nur einmal aufgeführt wurde und danach auf mysteriöse Weise verschwand, bis auf die Hymne (111 Takte), die 1958 in Tokio zur offiziellen Olympischen Hymne erklärt wurde. Mit Ausnahme von La furia domata (drei Akte, mit einem Libretto von Enrico Annibale Butti und Gustavo Macchi, nach Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung, uraufgeführt am 19. November 1895 am Teatro Lirico Internazionale, Mailand) war der Librettist für Samaras‘ letzte vollendete Opern der französische Schriftsteller Paul Milliet: Histoire d’amour (Storia d’amore – „Liebesgeschichte“) oder La Biondinetta (drei Akte, Mailand, uraufgeführt als Histoire d’amour/Storia d’amore am 17. November 1903 am Teatro Lirico Internazionale, Mailand, und als La Biondinetta (Lyra/youtube) am 1. April 1906 am Herzoglichen Theater in Gotha, Deutschland), Mademoiselle de Belle-Isle (Uraufführung am 9. November 1905 im Politeama Genovese, Genua) und Rhea (drei Akte, uraufgeführt am 11. April 1908 im Verdi-Theater in Florenz).
Es folgte die einzigartige Oper La Martire („Der Märtyrer“/Lyra/youtube) (drei Akte, mit einem Libretto von Luigi Illica, uraufgeführt am 23. Mai 1894 am Mercadante-Theater in Neapel) und war ein großer Erfolg für Samaras, der ihn als einen Pionier des Verismo ausweis. 1896 komponierte er eine ganze Kantate für die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit nach einem Text des Dichters Kostis Palamas, welcher nur einmal aufgeführt wurde und danach auf mysteriöse Weise verschwand, bis auf die Hymne (111 Takte), die 1958 in Tokio zur offiziellen Olympischen Hymne erklärt wurde. Mit Ausnahme von La furia domata (drei Akte, mit einem Libretto von Enrico Annibale Butti und Gustavo Macchi, nach Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung, uraufgeführt am 19. November 1895 am Teatro Lirico Internazionale, Mailand) war der Librettist für Samaras‘ letzte vollendete Opern der französische Schriftsteller Paul Milliet: Histoire d’amour (Storia d’amore – „Liebesgeschichte“) oder La Biondinetta (drei Akte, Mailand, uraufgeführt als Histoire d’amour/Storia d’amore am 17. November 1903 am Teatro Lirico Internazionale, Mailand, und als La Biondinetta (Lyra/youtube) am 1. April 1906 am Herzoglichen Theater in Gotha, Deutschland), Mademoiselle de Belle-Isle (Uraufführung am 9. November 1905 im Politeama Genovese, Genua) und Rhea (drei Akte, uraufgeführt am 11. April 1908 im Verdi-Theater in Florenz).
.
Samaras’ Werke, die Mitgliedern der griechischen Königsfamilie gewidmet sind, sowie eine Reihe von Photographien lassen eine enge Verbindung zu ihnen vermuten. Es gibt Anlass zur Annahme, dass seine Rückkehr mit den angeblichen Bestrebungen Georgs I. zu tun hat, ihn nach mannigfaltiger Kritik der Athener Presse am damaligen Amtsinhaber Georgios Nazos zum Direktor des Athener Konservatoriums zu machen. Dieser Plan wurde wegen Samaras‘ diplomatischen „Unfähigkeit“ und aufgrund der mutmaßlichen Unterstützung von Nazos durch vermögende Persönlichkeiten, die mächtiger waren als der Monarch, vereitelt. Der Streit zwischen Samaras und Nazos endete Anfang 1912 für den Komponisten ungünstig. Inzwischen war seine dreijährige Romanze mit der Pianistin Anna Antonopoulou (1888–1967) im Gange; sie heirateten schließlich am 28. Dezember 1914. Der Erste Weltkrieg sorgte dafür, dass Samaras dauerhaft in Griechenland blieb.
.

Zu „Mademoiselle de Belle-Isle“/Samaras: Alexandre Dumas d. Ä. schrieb die Theatervorlage 1839/ Wikipedia
Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, komponierte Samaras Operetten in drei Akten mit oft entzückender Musik, aber zugegebenermaßen mittelmäßigen Libretti, wie Pólemos en polémo („Krieg im Krieg“) von George Tsokopoulos und Ioannis Delikaterinis (uraufgeführt am Stadttheater Athen Athen am 10. April 1914) und zweien von Nikolaos Laskaris und Polyvios Dimitrakopoulos, I pringipissa tis Sassonos („Die Prinzessin von Sasson“) und I Kritikopoula („Das kretische Mädchen“) (beide uraufgeführt am 21. Januar 1915 bzw. 30 März 1916 am Stadttheater Athen). Er komponierte auch Gruß an Mutter Griechenland, 1914, für Chor und Orchester, mit Text von Aristotelis Valaoritis (die Partitur wurde aus kürzlich wiederentdeckten Orchesterstimmen rekonstruiert), Epinikeia, mit Text von Georgios Drosinis, Liederzyklus für Stimme und Orchester (1914) , und einige ausgezeichnete Lieder. Zu erwähnen sind Der Jungfernbrunnen, Mutter und Sohn (Text von Georgios Drosinis), Mein Schwur, Idyll und Bekenntnis (Text von Ioanis Polemis). 1990 entdeckte der Autor des hiesigen Artikels in der griechischen Nationalbibliothek in einem Manuskript die unbekannte Hymne an Bacchus (Text von Georgios Tsokopoulos) für Männerchor und Klavier, datiert auf den 28. Januar 1912 und orchestriert von Byron Fidetzis im Jahre 2012.
Von den bisher 18 (Stand 2020) erhaltenen Klavierwerken sind zu nennen: Sérénade (1877), Scènes Orientales, Vier charakteristische Suiten für Klavier vierhändig (1883), Die Zigeunerin (1886), La Veneziana, Vorspiel des dritten Aktes der Histoire d’amour (1903), Sechs Serenaden (Edition C. F. Kahnt, Leipzig, 1903); Valse Lente, Danse Monotone und Danse Espagnole (alle Edition C. F. Kahnt, Leipzig, 1904).
.
Aber was hat Griechenland Samaras gegeben? Nur die königliche Medaille der schönen Künste am 12. Januar 1915 … 1916 wurde er zum Vorsitzenden der ersten, wenn auch kurzlebigen Hellenischen Komponisten-Gesellschaft gewählt, und wie moderne Forschungen von Stella Kourbana vom Athener Konservatoriumsarchiv zeigen, erhielt er finanzielle Hilfe (2000 Drachmen, wenn wir uns nicht irren) von der Stiftung. Er starb am 25. März 1917 (julianischer Kalender – 7. April im gregorianischen Kalender) nach langer und schmerzhafter Krankheit, nachdem er die Partitur des ersten Aktes seiner letzten Oper Tigra fast vollendet hatte, die auf einem exquisiten Libretto des renommierten Wissenschaftlers Renato Simoni (1875–1952) basiert. Diese unvollendete Oper wurde 2009 von Byron Fidetzis orchestriert.

Alexandre Dumas: „Mademoiselle de Belle-Isle“/ Illustration zur Erstausgabe des Theaterstückes 1839/ BNF/ Gallica
Die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs, die den Hauptsitz und das Archiv von Sonzogno (Mailand) und vielleicht sogar von Kahnt (Leipzig) beschädigten, zerstörten einen bedeutenden Teil von Samaras’ Werk. Einige gedruckte Stücke könnten in bisher unerforschten europäischen Sammlungen überlebt haben. Darüber hinaus schickte Samaras’ Witwe um 1961 alle erhaltenen Orchestermaterialien, die Samaras 1911 nach Athen mitbrachte, an den Sonzogno-Verlag. Heute sind die Opern La Martire, Histoire d’amour, Mademoiselle de Belle-Isle und Rhea sowie drei Operetten vollständig orchestriert erhalten. Medgé und Lionella überlebten in Partiturform, und 2013 wurde der größte Teil des bis dahin verlorenen Orchestermaterials von Flora mirabilis wiederentdeckt.
Fazit: Von den wunderbaren Liedern für Singstimme und Klavier bis zu seinen Opern ist Samaras ein spontaner und hoch inspirierter Melodiker, der emotionale Zustände durch die kontrastierenden rhythmischen und melodischen Muster sowie die aufwendige Orchestrierung ausdrückt, ob nun vorimpressionistisch oder spätromantisch, je nachdem. Die Bandbreite seines künstlerischen Spektrums erschuf diverse Meisterwerke wie Flora mirabilis, Medgé, Histoire d’amour und Rhea. In seinen Werken nähert sich die traditionelle Aufteilung in mehr oder weniger autonome „Nummern“ (Arien, Ensembles, Chöre etc.) allmählich dem wagnerischen Konzept der endlosen Melodie und Leitmotivik; Medgé und Flora mirablis, vor allem aber La Martire lassen die Melodiesprache Puccinis erahnen, und das zu einer Zeit, als dieser seine berühmtesten und beliebtesten Meisterwerke noch nicht komponiert hatte. George Leotsakos
.
.

Dirigent und Pionier der griechischen Musik, Byron Fidetzis/Lyra
Dazu auch Byron Fidetzis: Mademoiselle de Belle-Isle als Teil einer neugriechischen „Quasi-Tetralogie“. Seit November 1983, als ich dem damaligen Präsidenten der Korfu-Lesegesellschaft, dem verstorbenen Konstantinos Nikolakis-Mouchas (1910–1987), anvertraute, dass ich daran denke, das Werk des Komponisten Spyridon Samaras bis in die Gegenwart wiederzubeleben, sind über 37 Jahre verstrichen. Und doch scheint erst heute die letzte – wie wir damals dachten – der erhaltenen Opern von Samaras den Weg zum Publikum zu finden, obwohl es die ganze Zeit über eine Aufnahme davon gab , die bereits in den Sommer 1995 datiert.
Mademoiselle de Belle-Isle wurde 1903 nach einem Libretto von Paul Milliet (1848–1924) komponiert und am 9. November 1905 in Genua uraufgeführt. Zusammen mit den beiden vorangegangenen Opern La Martire (1894) und Histoire d’amour (1903) (Xanthoula von 1906 war eine andere Fassung davon) und der darauf folgenden Oper Rhea (1908) bilden sie die vier Samaras-Opern, von denen wir dachten, dass sie vollständig oder zumindest nur mit kleineren Verluste überlebt haben. So kam mir das Wort „Tetralogie“ in den Sinn, als ich diesen Beitrag schrieb; offenkundig nicht wegen eines nicht existierenden Themas, das die vier Werke verbindet, sondern aus dem Gefühl heraus, dass sie ein gemeinsames Schicksal teilen, indem sie überlebten. Dies waren die Fakten, auf die ich meine damaligen Kommentare und Meinungen stützte. Ab Herbst 2013 änderten sich die Fakten zum Œuvre von Samaras jedoch dramatisch dahingehend, dass aus der „überlebenden Tetralogie“ eine „Quasi-Tetralogie“ wurde! Was passierte, war, dass die als verschollen geglaubte Orchesterpartitur eines anderen Werkes – oder zumindest umfangreiches Material davon, mit einigen Verlusten, wie im Fall von Mademoiselle de Belle-Isle – auf der Insel Korfu gefunden wurde – die Oper Flora mirabilis (1886)! So wurde aus der Tetralogie eine „Quasi-Tetralogie“ oder besser gesagt eine „Pentalogie“!

Samaras „Mademoiselle de Belle-Isle“: Der Bariton Antonio Paoli sang den Richelieu in der Uraufführung iun Genua 1905/ OBA
Der von mir erwähnte Materialverlust betrifft hauptsächlich Mademoiselle de Belle-Isle. Das von dieser Oper überlieferte Material besteht aus der Partitur des zweiten, dritten und vierten Akts, den Orchesterstimmen – mit Ausnahme der beiden Oboen-, der drei Posaunen- und der Harfenstimmen – einem gedruckten Libretto in italienischer Sprache sowie zwei Vokalpartituren – einer auf Französisch-Italienisch und einer auf Deutsch, die sich an einigen Stellen unterscheiden. Diese Probleme führten dazu, dass sich die Einspielung dieser besonderen Oper im Vergleich zu den anderen drei in Erwartung ihrer musikwissenschaftlichen Restaurierung verzögerte. Der Prozess erwies sich als äußerst zeitaufwendig; es dauerte etwa vier Jahre, von 1991 bis 1995, und wurde in zwei Etappen durchgeführt. Die erste bestand darin, die Partitur anhand der Orchesterstimmen umzuschreiben, und die zweite – ein sehr sensibles Verfahren – darin, die fehlenden Stimmen für bestimmte Instrumente so hinzuzufügen, dass sie nicht dem Stil des Komponisten zuwiderliefen. Es versteht sich von selbst, dass ich dabei die Hinweise oder Noten der erhaltenen Orchesterstimmen berücksichtigt habe. Ich habe alle abgängigen Stimmen sowie die fehlenden Partiturteile im Vergleich mit den beiden Vokalpartituren ergänzt, so dass die ursprünglich komponierte Musik fast vollständig eingespielt werden konnte. Aus dem gleichen Grund habe ich die alternativen Finali der Oper eingefügt, sowohl das ursprüngliche, tragische (das das Werk in der erhaltenen Partitur und dem französisch-italienischen Gesangsauszug beendet) als auch das alternative, glückliche, das für eine Aufführung in Monte-Carlo komponiert wurde und sich nicht nur im deutschen Vokalauszug als alleiniger Schluss findet, sondern auch in der Partitur als einige Seiten langer Nachtrag mit der Angabe „Finale p. Monte Carlo“. Ich kann davon ausgehen, dass der Komponist angesichts der Affinität des Publikums in Monte-Carlo zur französischen Kultur für diesen Anlass ein Happy End gewählt hat, das mit dem Ende des gleichnamigen Original-Theaterstücks (1839) von Alexandre Dumas d. Ä. (1802–1870) identisch ist, auf dem das Libretto von Paul Milliet basiert. Für dieses alternative Happy End wurden Orchesterstimmen herauskopiert, damit es auch aufgenommen werden konnte. Für diesen – nur in der italienischen und deutschen Fassung erhaltenen – Schluss wurden einige Worte des französischen Librettos von George Leotsakos vervollständigt, dem ich noch einmal meinen herzlichsten Dank aussprechen möchte.

„Mademoiselle de Belle-Isle/ Samaras: Präludium aus dem 3. Akt; Costas Kardamis leitet das Sinfonieorchester der Philharmonischen Gesellschaft Korfu/ youtube Nicos Grigoropoulos
Eine Reihe von Ereignissen führte zu weiteren Verzögerungen und schließlich zur Absage der Veröffentlichung dieser Aufnahme, die nun, 26 Jahre nach ihrer Fertigstellung, endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde: Mademoiselle de Belle-Isle ist die zweite und letzte Oper der französischen Periode von Samaras, die erste ist Histoire d’amour (auch als Xanthoula aufgeführt). Im Gegensatz dazu markiert die Oper Rhea, ebenfalls zu einem französischen Libretto von Paul Milliet, Samaras’ Hinwendung zu einem griechischen musikalischen Rätsel, in dem er versucht, das Problem des Komponierens auf „griechische Weise“ anzugehen. Diese drei Opern bieten uns zusammen mit den vorangegangenen italienischen Werken La Martire nach einem Libretto von Luigi Illica (1857–1919) und Flora mirabilis nach einem Libretto von Ferdinando Fontana (1850–1919) ein Panorama der Errungenschaften, Bestrebungen und Einflüsse des Komponisten während der besten Phase seines Lebens. Doch wenn man tiefer in diese „überlebende Pentalogie“ eintaucht, erkennt man, dass sich die Aufteilung von Samaras’ Werk in italienische, französische und griechische Perioden nur auf das Äußere beziehen kann, nicht auf das Wesen seiner Musik. Solche Zuschreibungen können helfen, das Material zu klassifizieren und zu organisieren und sind daher nützlich. In den meisten Fällen läuft man jedoch Gefahr, bei der Anwendung an der Oberfläche der Dinge zu bleiben – ein Risiko, dem weder der junge Manolis Kalomiris im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts noch der reifere Dimitrios Levidis in den 1940er Jahren entkommen konnte. Nachdem ich nun eine tiefere Kenntnis des Gesamtwerks von Samaras erlangt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dieser korfiotische Komponist nicht als typischer Fall eines Komponisten der nationalen Schule angesehen werden kann. Zunächst trägt Samaras zur Entwicklung des italienischen Verismo bei, dann zieht es ihn zum französischen lyrischen Drama und schließlich ebnet er mit Werken wie Rhea oder Epinikeia („Siegeslieder“) den Weg für eine griechische nationale Schule der Musik. Daher mag es sich als nicht allzu schwierig erweisen, seine Werke in Perioden einzuordnen; er selbst jedoch ist nicht so sauber in eine dieser Perioden einzuordnen. Im Gegenteil, der Komponist aus Korfu bezieht systematisch Elemente aus den wichtigsten europäischen Schulen – einschließlich der deutschen Nationalschule – aber auch aus der griechischen Tradition in sein Werk ein. Der Schlüssel zu einer solchen Interpretation von Samaras und seiner Ästhetik ist seine unvollendete Oper Tigra. Er komponierte sie am Ende seiner Karriere außerhalb Griechenlands, auf Italienisch – mit anderen Worten, er kehrte in seine italienische Zeit zurück, bevor er sich mit griechischen Kompositionen wie den Melodramen Pólemos en polémo, I pringipissa tis Sassonos und I Kritikopoula beschäftigte. In Tigra jedoch enthält Samaras zusätzlich zu einer ganz modernen Harmonie und dramatischen Struktur die griechisch-orthodoxen Hymne der Auferstehung Christi (auf eine ganz andere Weise als in I Kritikopoula); dies ist ein Beispiel für seine kreative Individualität, die eine Vielzahl von Einflüssen verarbeitet, um ein sehr persönliches musikalisches Idiom auszubilden.
.

Dumas´ Komödie „Mademoiselle de Belle-Isle“ hatte auch in Deutschland Verbreitung, hier ein Theaterzettel zu einer Würzburger Aufführung als „Gabrielle von Belle-Isle“/ Würzburger Theaterzettel
Was eine musikalische Führungsfigur wie Kalomiris nachdrücklich verkündete – indem er ein Manifest darüber herausgab, was in der griechischen Musik zu tun sei –, hat Samaras im Laufe seines Lebens durch den konsequenten Ausdruck seiner schöpferischen Individualität erreicht. Der große korfiotische Komponist schrieb nicht speziell „griechische Musik“, sondern drückte durch seinen kreativen Werdegang das moderne Griechenland und seine Menschen an einem kritischen historischen Punkt aus. Er hat sich nie von allem Griechischen getrennt – er lauschte aufmerksam dem innersten Ausdruckssehnsüchten einer ganzen Gesellschaft und schaffte es, als er die volle Reife erreicht hatte, diese Gesellschaft ganz bewusst auszudrücken, ohne jemals seine Individualität durch Bindung an eine bestimmte künstlerische Bewegung oder den Ehrgeiz, eine Schule zu gründen, aufzugeben. So blieb er individuell, eine einsame Figur, die das zum Universalen tendierende griechische Individualitätsparadigma repräsentierte. Byron Fidetzis
.
.
Samaras Opern dokumentiert: Fidetzis hat die „offizielle“ Einspielung der Rhea bei Lyra (vergriffen wie der gesamte Lyra-Katalog; erst in einer luxuriösen LP-Ausgabe und dann als CD nachgeschoben, aber bei youtube auf Fidetzis´Kanal) als Mitschnitt aus Korfu 1984 aufgenommen. Die Wiederausgabe auf CD ist einer der Projekte zur Neubelebung der griechischen Oper durch Fidetzis & fils, über das in operalounge.de bereits berichtet wurde. 1999 dirigierte Fidetzis erneut die Rhea mit Giulia Souglakou und dem heute berühmten Bassisten Tassis Christoyannis (damals noch Christoyannopoulos) in Athen, wovon bei Sammlern ein Live-Mitschnitt kursiert. Nikos Athineos schließlich leitete die bereits erwähnte Rhea bei den Olympischen Spielen 2004 mit Dimitria Theodossiou und Lucio Gallo (Guarca), auch hiervon existiert ein Mitschnitt.
Die obige Naxos-Aufnahme der Mademoiselle de Belle Isle gab es bereits als Mitschnitt bei Lyra von einem Konzert in Pasardijk/Bulgarien 1994 (Fidetzis/Arapi, Krilovici/ italienische Version von Amintore Galli nach Milliet auf die Komödie von Alexandre Dumas); La Martire ist 1990 ebenfalls in Pasardijk aufgenommen bei Lyra als CD erschienen (und liegt in der deutschen und damals viel im deutschsprachigen Raum gespielten Fassung bei Bote & Bock, heute Boosey & Hawk/ youtube); auch ein Mitschnitt aus Wuppertal 2011 findet sich. Ebenfalls bei Lyra gab es als CD La Biondinetta (1998 Pasardijk/Fidetzis mit Arapis und Stamboglis) und nun auch bei youtube. Flora Mirabilis gibt es bei Sammlern als Generalprobenmitschnitt von 1979 unter Odisseus Dimitroadis mit Frangiskos Voutsinos (der in Belgien eine Karriere machte). Und der glanzvolle Tenor Zachos Terzakis sing das Solo des Valdo in einer Klavierprobe 2011 ebenfalls bei youtube, wo sich noch weitere historische Aufnahmen wie die von Antonio Paoli finden. Und schließlich kann man den ersten Akt von La Tigra bei youtube hören (immerhin 56 Minuten), erneut dirigiert Byron Fidetzis, der auch die Auszüge aus Medgé aus Athen 1005 leitet. Die letztere Oper wird 2024 von Fidetzis restauriert im Konzert vorgestellt, Lionella kehrte 2023 in der neuen Instrumentierung nach Athen zurück, in einem beeindruckenden Konzert/youtube unter Fidezis selbst). G. H.
(Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de Foto oben: Ausschnitt aus der Coverillustration der polnischen Ausgabe von Dumas´ Komödie.)





 Für
Für 









 Die nun bei Naxos dankenswerter Weise neu veröffentlichte
Die nun bei Naxos dankenswerter Weise neu veröffentlichte 
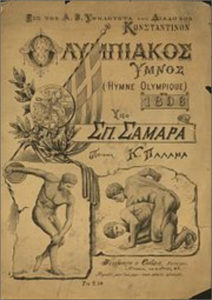




 Es folgte die einzigartige Oper
Es folgte die einzigartige Oper 






 Das ist hochpoetisch ausgedacht. Aber die Szenerie wirkt auch finster und bedrohlich („Pfähle mit aufgespießten Schädeln“, heißt es in der Beschreibung zum ersten Bild!), man denke nur an Strawinskys auf den gleichen Motiven basierenden Feuervogel von 1910. Und der oftmals tosende Wind, der als Knecht Sturm, Recke Sturmwind oder Ritter Sturm bezeichnet wird, sorgt für eine übernatürliche, unheimliche und beklemmende Atmosphäre, die durch chromatisch kühne Orchesterfarben und harmonische Effekte klanglich erweitert und geradezu filmhaft aufgeladen wird; der Schneesturm ist kein liebliches Flockentreiben, sondern Aufruhr finsterer Mächte. Orchestrale Moderne und Spielkultur bringen die Spieler des
Das ist hochpoetisch ausgedacht. Aber die Szenerie wirkt auch finster und bedrohlich („Pfähle mit aufgespießten Schädeln“, heißt es in der Beschreibung zum ersten Bild!), man denke nur an Strawinskys auf den gleichen Motiven basierenden Feuervogel von 1910. Und der oftmals tosende Wind, der als Knecht Sturm, Recke Sturmwind oder Ritter Sturm bezeichnet wird, sorgt für eine übernatürliche, unheimliche und beklemmende Atmosphäre, die durch chromatisch kühne Orchesterfarben und harmonische Effekte klanglich erweitert und geradezu filmhaft aufgeladen wird; der Schneesturm ist kein liebliches Flockentreiben, sondern Aufruhr finsterer Mächte. Orchestrale Moderne und Spielkultur bringen die Spieler des 




