Schon Brigitte Hamann hat 2002 in ihrer Winifred-Monographien nicht nur ein Buch über die gegenseitige Umarmung zweier Ungleicher, die sich brauchten geschrieben. Winifred Wagner (die Gattin und Erbin des Wagnersohnes Siegfried) hat die Bayreuther Festspiele vor dem Bankrott gerettet, indem sie Hitler als großzügigen Beschützer und finanzkräftigen Förderer gewann, dafür hat sie ihm propagandistisch gedient als Steigbügelhalterin großbürgerlichen Renommees. Das Buch beschäftigte sich erstmal und wegweisend auch mit dem Siegfried-Sohn Wieland Wagner, dem Entrümpler und Erneuerer Nachkriegsbayreuths, der sich selbst als Saubermann stilisierte, aber wie man spätestens nach der Lektüre dieses Buches nicht länger ignorieren darf, eine nicht unerhebliche Nazi-Vergangenheit aufwies. Nicht ohne Grund nannte der Bayreuth-Regisseur Heinz Tietjen ihn „den übelsten der Hitler-Günstlinge“. Brigitte Hamann nannte ihn in einem Interview, das ich mit ihr führte, den „Obernazi von Bayreuth“. Wieland, das „Genie“ Neubayreuths der Adenauerzeit war in der Tat Hitlers Protegé gewesen, arbeitete im KZ-Außenlager Bayreuth und hatte bis 1945 sehr enge persönliche Beziehungen zu Hitler. Nach 1945 zog er sich in die französisch besetzte Zone an den Bodensee zurück, um dem Entnazifizierungsverfahren zu entgehen, dem sich seine Mutter unängstlich und entschlossen stellte.
„Wieland hat sich der Entnazifizierung entzogen … Deswegen hat er sich an den Bodensee abgesetzt … Was muss er für Spannungen in sich gehabt haben. Er ist ja auch früh gestorben. … Es wird sich unser Bild von den bekannten Nazis und Antinazis gewaltig verändern.“ (Brigitte Hamann)
Brigitte Hamann hat ein Tabu gebrochen. Es waren schließlich die Winifred-Enkel, die die Entstehung ihres Buches behinderten, im Gegensatz zum Festspielchef Wolfgang Wagner (Vater von Katharina Wagner, der jetzigen Festspielchefin), der Brigitte Hamanns akribische Recherchen im Richard Wagner-Archiv zu Bayreuth offenherzig und tatkräftig förderte, indem er ihr nicht nur viel Material zur Verfügung stellte, sondern beispielsweise auch den Zugang zu den von der Stadt Bayreuth gesperrten, aber außerordentlich aufschlussreichen Tagebüchern der ehemaligen nationalsozialistischen Archivarin Gertrud Strobel zugänglich machte. Sowohl der Briefwechsel Winifreds und Wielands, als auch der Nachlass Wielands werden von den Winifred-Enkeln bis heute unter Verschluss gehalten. „Es sind die Enkel, die eine Aufarbeitung der braunen Bayreuther Geschichte verhindern, nicht Wolfgang Wagner (Brigitte Hamann).“
Brigitte Hamann hat in ihrem aufsehenerregenden Buch über Winifred Wagner, die Mutter Wieland und Wolfgangs als Erste mutig auf die Verstrickung des von Hitler protegierten, zum künftigen Bayreuth-Leiter auserkorenen Sohnes Wieland hingewiesen und die gängige Meinung Lügen gestraft, er hätte eine „reine Weste“ gehabt. Nach Brigitte Hamanns Buch konnte die vorherrschende Verherrlichung des als verschlossen geltenden Wieland nach der Maxime Daphne Wagners, „Die Omi war Nazi, der Vater nie“, nicht länger aufrechterhalten werden. Es war nach der Lektüre ihres Buches klar, dass die Geschichte Neubayreuths neu geschrieben werden müsse.
Albrecht Bald und Jörg Skriebeleit haben in ihrem 2003 erschienenen Buch „Das Außenlager Bayreuth des KZ Flossenbürg. Wieland Wagner und Bodo Lafferenz im „Institut für physikalische Forschung“ den Anfang gemacht. Sie haben den Wagner-Enkel Wieland als Nazi und Leiter des Außenlagers Bayreuth des KZ Flossenbürg“ aus der Grauzone der vorherrschenden Biographik des Wagner-Enkels ans Licht gezogen.
Wieland Wagner, zweifellos ein genialer Regisseur, kreierte mit seiner Weltenscheibe, auch „Wielandsche Kochplatte“ genannt, seiner Lichtregie, seiner szenischen Abstraktion und Verbannung aller Dekoration und seiner ganz und gar un-nationalistischen, archaisch-mythischen Lesart Wagners und seiner Musikdramen einen geradezu wegweisenden „Neubayreuther Stil“, der Theatergeschichte schrieb. Das Nachkriegs-Bayreuth mit den kühnen, strengen Inszenierungen Wielands und dem bis heute nicht wieder erreichten vorbildlichen Sängerensemble wurde zum vielgepriesenen Modell neuen, modernen, unvorbelasteten Wagnertheaters.
Nicht, dass Wieland irgendeine wichtige, verantwortungsvolle Tätigkeit innerhalb des Machtapparates der Nazis innegehabt hätte. Aber er hat doch, selbstverständlich Parteimitglied, ohne den geringsten moralischen Zweifel eine bedenkliche Einrichtung der Nazis dankbar benutzt, um – obwohl er als vorherbestimmter Bayreuth-Erbe von Hitler persönlich vom Wehrmachtsdienst freigestellt war – nicht im letzten Moment noch zum Militär eingezogen zu werden und ungefährdet im Krieg zu überwintern. Er war, worauf schon Brigitte Hamann hingewiesen hatte, von September 1944 bis April 1945 stellvertretender ziviler Leiter eines Bayreuther Außenlagers des fränkischen KZs Flossenbürg, in dem Tausende von Inhaftierten ums Leben kamen.
Gemessen am Grauen dieses KZs war das Bayreuther Außenlager zwar ein angenehmes Hotel, in dem niemand zu Tode kam, wie überlebende Inhaftierte in der Dokumentation von Bald und Skriebeleit berichten, aber es war doch immerhin eine Institution, in der physikalische Experimente zur Entwicklung der Wunderwaffe V2 durchgeführt wurden, Experimente, an denen 85 Häftlinge mitwirken mussten.
Wieland Wagners Schwager Bodo Lafferentz, seit 1943 mit Wielands Schwester Verena Wagner verheiratet, hatte sich als SS-Multifunktionär für ein Institut zur Entwicklung einer Wunderwaffe stark gemacht. Er sorgte dafür, dass Wieland als Verbindungsmann in Bayreuth fungierte und so weder zur Wehrmacht, noch zum Volkssturm eingezogen wurde. Im Lager selbst – auf dem Gelände einer Baumwollspinnerei – konnte Wieland Experimente an Bühnenbildern und Leuchtsystemen anstellen – und dabei auf die Hilfe von Häftlingen zählen. Wieland soll sich mehrfach für die Überstellung von Häftlingen in zivile Tätigkeitsfelder eingesetzt haben. Er fungierte als Mittelsmann zu Lafferentz. Bevor das Lager im April 1945 aufgelöst wurde und die Häftlinge einen Todesmarsch ins KZ Flossenbürg antraten – erschütternde Berichte Überlebender sind in der Dokumentation nachzulesen – setzten sich Lafferentz und Wieland mitsamt kostbarer Wagner-Handschriften nach Nußdorf am Bodensee ab – in die französische Zone, wo man einer Entnazifizierung zunächst entging.
1948 kam es zum Spruchkammerverfahren. Wieland wurde aufgrund seiner Mitgliedschaft in der NSDAP, in der Reichskammer der Bildenden Künste und in der Reichstheaterkammer per Sühnebescheid als „Mitläufer“ eingestuft. Er zahlte ein Sühnegeld von 100 Mark plus Prozesskosten. Seine Beschäftigung im Bayreuther Außenlager aber hatte er unterschlagen. Eine Verharmlosung.
Es ist das Verdienst der Autoren Bald und Skriebeleit, diese in aller gebotenen Klarheit und Nüchternheit aufgearbeitet und sorgfältig dokumentiert zu haben. Nach der Lektüre dieser Arbeit muss sich die Wagner-Welt fortan der Tatsache stellen, dass ausgerechnet jener ästhetische Grundstein, auf dem „Neubayreuth“ und die von aller „braunen“ Deutschtümelei sich distanzierende Wagner-Renaissance der Nachkriegszeit aufbaute, womöglich in einem KZ-Außenlager gelegt wurde.
Dem schließt sich das Buch des Theater- und Musikwissenschaftlers Anno Mungen an, indem es mit Fakten und Fotografien der Jahre 1941-1945 den letzten Zweifel ausräumt, dass der Spruch, den die Brüder als Leitsatz ihrer neugegründeten „Neubayreuther“ Festspiele im Festspielhaus anbrachten, Hier gilt’s der Kunst (auf dem Buchdeckel ohne Anführungszeichen, was bei einem solchen Zitat ebenso befremdlich ist wie bei der Verwendung von „Antarteter Musik“ ohne dieselben) eine Verharmlosung, ja eine Lüge ist.
Mungen betont, „nur das, was auch die Quellen hergeben“ zu verwendet zu haben. Aber sowohl die Liste verwendeten Literatur (die ideologisch einseitig ausgewählt wurde) als auch der Quellen ist äußerst schmal. Wichtigste Quellen sind für ihn die bisher nicht edierten Tagebücher Gertrud Strobels, Zeitungen und der Nachlass Wielands, der inzwischen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv liegt.
Halb romanhafte Nacherzählung der Ereignisse, halb akribische Dokumentation der vier maßgeblichen, die Karriere Wielands bestimmenden Jahre, kommt Mungen zu keinen anderen Ergebnissen als Brigitte Hamann und Jörg Skribeleit, sein Buch geht auch nicht über ihre Forschungen hinaus.
Mungen lässt zwar wie unter einer Lupe akkurat den ganzen Bodensatz, alles Scheußliche, Inhumane, Faulige des Nazismus der Wagner-Familie, aufscheinen, von der Bayerns Finanzminister Konrad Pöhner schon 1968 urteilte: „Man weiß nicht, ob in der Familie die Dummheit oder die Gemeinheit größer ist.“
Mungen erzählt unzählige unappetitliche Ereignisse aus der Geschichte Bayreuths im chronologischen Tagebuchstil, aber wirklich Neues oder neu Erleuchtendes ist eigentlich nicht zu lesen. Die Verlogenheit der Wagnerfamilie, die Verlogenheit auch der Wieland-Hagiographie ist bekannt. Wer sich voyeuristisch daran weiden möchte, mag das reißerische Buch Mungens genüsslich verschlingen. Manchem aber wird es wohl degoutant wo nicht überflüssig erscheinen, zumal es – reichlich moralisierend und auf Betroffenheit der Lesenden setzend – als Motto ausgerechnet den fragwürdigen, aber für einen Teil der Wagnerliteratur bezeichnenden Ausspruch von Peter Adam „The Arts of the Third Reich“, London 1992 zitiert: „One can only look at the art of Third Reich through the lens of Auschwitz“.
Dem hielt schon 1986 der britische Historiker Peter Gay entgegen: „Für den Historiker des modernen Deutschlands ist die Suche nach schädlichen, unheilvollen oder gar tödlichen Ursachen problematischer und riskanter geworden, als es sonst unvermeidlich ist – sie wird ihm zu einer Zwangsvorstellung, so dass er die ganze Vergangenheit nur noch als ein Vorspiel zu Hitler sieht und jeden angeblich deutschen Charakterzug als einen Baustein zu jenem schrecklichen Gebäude, dem Dritten Reich“.
Schon in seinem vor 1997 veröffentlichten Buch „Wagners Hitler“ hat Joachim Köhler Hitler offenbar mehr geglaubt, als Richard Wagner. Der Titel Hitlers Wagner wäre der geschichtlichen Chronologie der Beziehung zwischen Wagner und Hitler weit angemessener. Immerhin handelt es sich um einen Prozess der Usurpierung. Ein Vorgeborener wird in die Ideologie eines größenwahnsinnigen Nachgeborenen einverleibt. Was nur funktionierte, indem Hitler und die Seinen wesentliche Aspekte Wagners ausblendeten, ja ignorierten. Man kann in diesem Zusammenhang nur noch einmal daran erinnern, was der israelische Historiker Jakob Katz in seinem 1985 erschienenen Buch „Richard Wagner. Vorbote des Antisemitismus“ angesichts der Flut von Veröffentlichungen betonte, die Wagner vom Holocaust, vom Deutschen Nationalismus der Kaiserzeit, von Chamberlain und von Hitler aus rückblickend interpretieren: Die Deutung Wagners „aufgrund der Gesinnung und der Taten von Nachfahren, die sich mit Wagner identifizierten, ist ein unerlaubtes Verfahren.“; es handele sich … um eine Rückdatierung, ein Hineinlesen der Fortsetzung und Abwandlung Wagnerscher Ideen durch Chamberlain und Hitler in die Äußerungen Wagners selbst (Anno Mungen: Hier gilt’s der Kunst. Wieland Wagner 1941-1945; Westend Verlag, 150 S.; ISBN 978-3-86489-329). Dieter David Scholz





 Anders als bei anderen Komponisten der Fall, muss sich Dvořáks Musik in den Konzertsälen der Welt nicht erst durchsetzen. Zumindest die späten drei Sinfonien gehören seit Jahrzehnten zum Standardrepertoire. Mit zunehmender Tendenz erscheinen auch die früheren, besonders die Sinfonien Nr. 5 und 6, auf den Spielplänen; ab und an hört man eine der Tondichtungen. Dass
Anders als bei anderen Komponisten der Fall, muss sich Dvořáks Musik in den Konzertsälen der Welt nicht erst durchsetzen. Zumindest die späten drei Sinfonien gehören seit Jahrzehnten zum Standardrepertoire. Mit zunehmender Tendenz erscheinen auch die früheren, besonders die Sinfonien Nr. 5 und 6, auf den Spielplänen; ab und an hört man eine der Tondichtungen. Dass 
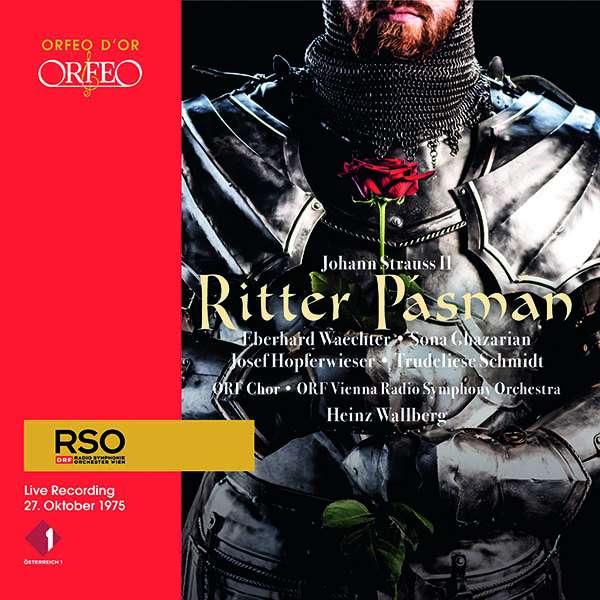



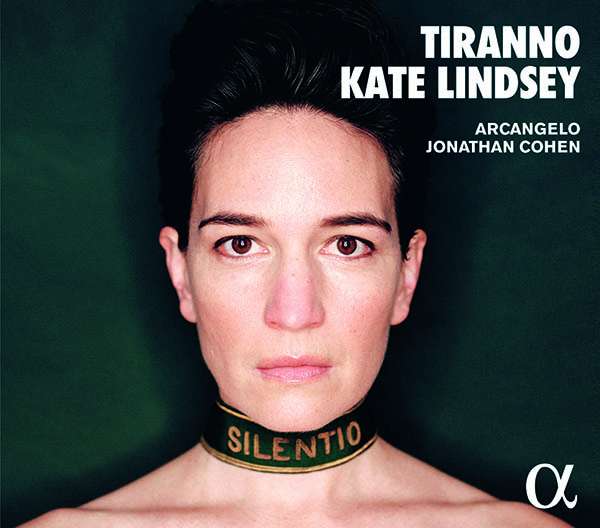
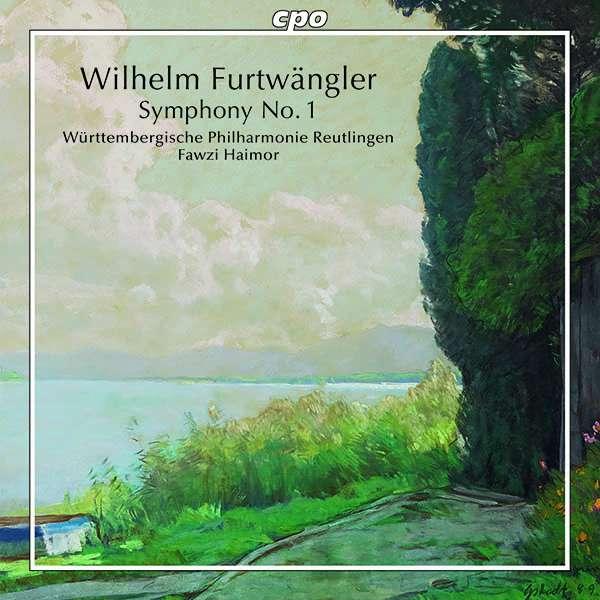


 Die Diva Neapels bediente Mayr vier Jahre später mit einer
Die Diva Neapels bediente Mayr vier Jahre später mit einer 


 Die
Die
