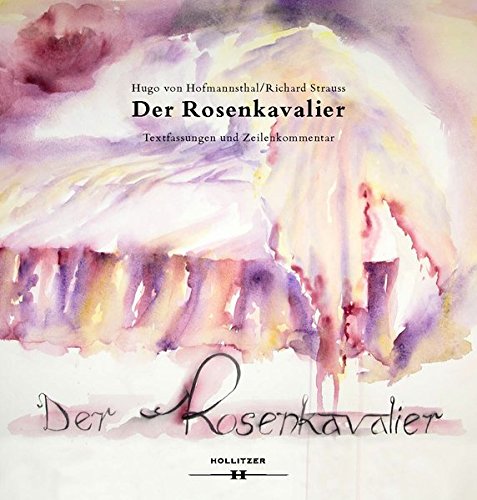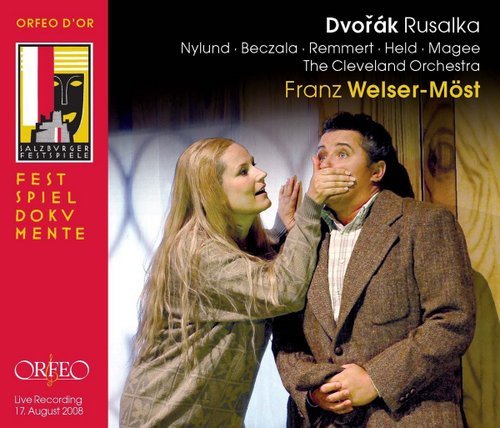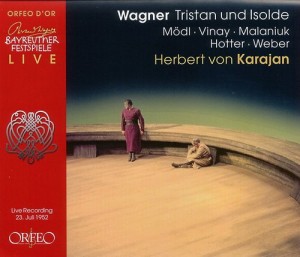Wer im Netz und in einschlägigen Büchern nach André Cluytens sucht, findet ihn vornehmlich als Operndirigenten. Diesem Eindruck halten Erato / Warner jetzt sechsundsechzig CDs entgegen: „The Complete Orchestra & Concerto Recordings“. So viele? Dagegen ist die Summe seiner einschlägigen vokalen Einspielungen allerdings sehr übersichtlich. Blieb ihm zu wenig Zeit, sich neuen Unternehmungen zu widmen? Mainstream lag ihm offenbar nicht. Dafür ist seine Opern-Diskographie erlesen. Berlioz, Debussy, Gounod, Ravel, Lalo, Strawinsky, Bondeville, Thomas, Poulenc. Humperdincks Hänsel und Gretel mit Anneliese Rothenberger und Irmgard Seefried sind die absolute Ausnahme. Typischer für Cluytens ist schon ehr die legendäre Carmen mit den originalen Dialogen.

Die erste „und sehr viel idomatischere „Contes d´Hoffmann“-Einspielung 1948 in Paris: André Cluytens, Fanély Revoil, Ramonde Amade, Bourvil, Renée Doria, André Pernet und René Lapelletière/ Foto X./ Columbia
Begleitet vom Orchestre de l’Opéra Comique Paris singen Solange Michel die Carmen und Raoul Jobin den José. Jobin ist auch der Hoffmann in der Offenbach-Oper von 1948, in der sogar der legendäre französische Schauspieler und Chansonnier Bourvil mitwirkte. Mit seiner zweiten Aufnahme von Les contes d’Hoffmann scheitert er 1965 trotz – oder gerade wegen des internationalen Staraufgebots. Eigentlich war Maria Callas für die Aufnahme vorgesehen, die aber absagte und dadurch eine bemerkenswerte Rochade an Namen auslöste: Elisabeth Schwarzkopf (Giulietta), Victoria de los Angeles (Antonia), Gianna d’Angelo (Olympia), Nicolai Gedda (Hoffmann) George London (Coppélius und Miracle) und Nicola Ghiuselev (Lindorf) fanden idiomatisch nicht zusammen.
Wie ein monolithischer Block ragt Wagner aus dem akustischen Nachlass heraus. Bei den Bayreuther Festspielen hat Cluytens Tannhäuser, Meistersinger, Lohengrin und Parsifal dirigiert. Lediglich Tannhäuser ist nachträglich von Orfeo in der Festspielreihe offiziell herausgegeben worden. Bis auf Parsifal, den es auch aus der Mailänder Scala gibt, sind die übrigen Titel in unterschiedlicher Klangqualität auf dem so genannten grauen Markt verbreitet worden. Sie werden Cluytens nicht immer gerecht. Die Veröffentlichung des Tannhäuser nach den originalen Bändern ist insofern wichtig, weil diese Oper 1955 der Einstand von Cluytens in Bayreuth gewesen ist. Nach dem tragischen Tod seines Sohnes Andreas hatte der vorgesehene Dirigent Eugen Jochum absagen müssen. Festspielleiter Wieland Wagner, der auch Regie führte, flehte Cluytens ganz kurzfristig am Telefon an: „Kommen sie schnell, retten sie die Aufführung.“ Cluytens kam, siegte und blieb für die nächsten Jahre Wielands bevorzugter Dirigent. Bereits ein Jahr später betreute er dessen spektakuläre Neuinszenierung der Meistersinger – ohne Nürnberg.

„Er kultivierte, was für Franzosen wichtig ist: Essen, Eleganz, Stil und ein Haus in der Bretagne. Er sprach sechs Sprachen, worum ich ihn glühend beneidete. Er lehrte mich, was Leidenschaft ist“: Anja Silja über André Cluytens in ihren Erinnerungen „Die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren“ (Parthas/ISBN 3-932529-29-4).
In seiner zweibändigen „Geschichte der Bayreuther Festspiele“ schreibt dazu Oswald Georg Bauer: „Man schätze seine spirituelle, niemals auftrumpfende Art, die genau zur Regie passte.“ Wieland habe keine „deutsche“ Interpretation, schwer und wuchtig, gewollt. Vielmehr sollten Wagners „romantische Ironie“ zum Klingen gebracht werden. „Cluytens dirigierte transparent und luzide, in den Konversationsstücken mit einer Leichtigkeit, in der jedes Detail der Partitur zu erkennen war, in den großen Orchester- und Chorszenen niemals dröhnend“, so Bauer weiter. Man habe seinen Klang mit einem kostbar gewirkten Gobelin verglichen, „manche Stellen waren impressionistisch wie von Debussy“. Weitreichende Pläne wurden geschmiedet. „Sie sind für mich der legitime Nachfolger von Knappertsbusch für den Parsifal“, zitiert Anja Silja in ihren Erinnerungen „Die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren“ aus einem Brief Wielands an André Cluytens. Bekanntlich wurde daraus nichts. Wenn die Rede auf Cluytens kommt, ist die Silja nicht weit. Ihr Name muss also fallen in einem Text über Cluytens. Es geht nicht anders. Sie und der Dirigent waren ein Paar. Nur für kurze Zeit. Nach Wielands Tod nahm Cluytens die Stelle an ihrer Seite ein. In Bayreuth hatte sie nur in zwei Produktionen unter seiner Leistung, nämlich als Venus im Tannhäuser und als Erstes Blumenmädchen im Parsifal (1965) mitgewirkt. Dafür gab es anderswo gemeinsame Auftritte auch schon vor Beginn der intimen Beziehung. So beim Othello in Frankfurt, bei der Salome in Paris und beim Tristan in Rom. „Obwohl gebürtiger Belgier, war alles an ihm französisch. Er kultivierte, was für Franzosen wichtig ist: Essen, Eleganz, Stil und ein Haus in der Bretagne. Er sprach sechs Sprachen, worum ich ihn glühend beneidete. Er lehrte mich, was Leidenschaft ist.“ Das Erinnerungsbuch widmet Cluytens ein ganzes Kapitel. In ihrer entwaffnenden Offenheit gelingt es der Silja, Den Menschen und den begnadeten Künstler eins werden zu lassen. R.W.
 Nun also die voluminöse Neuerscheinung bei Erato/Warner. Unser Korrespondent Daniel Hauser hat sich in die Aufnahmen vertieft. Hier seine Eindrücke: Vor einem halben Jahrhundert, am 3. Juni 1967, starb André Cluytens, belgisch-französischer Dirigent, mit gerade einmal 62 Jahren. Erato/Warner bedenkt ihn nun mit einer voluminösen, nicht weniger als 65 CDs umfassenden Box der kompletten Orchester- und Konzerteinspielungen (0190295886691). Cluytens war zwar Wahlfranzose, doch verleugnete er seine belgischen Wurzeln nicht und bestand, so berichten Zeitzeugen, auf der niederländischen Aussprache seines Nachnamens. Etliche der hier enthaltenen Aufnahmen erfahren nunmehr ihre späte CD-Premiere. Soviel darf bereits vorangestellt werden: Es hat sich in jedem Fall gelohnt. Gut die Hälfte der Aufnahmen ist in Mono, der Rest in Stereo festgehalten. Es wird ein Zeitraum von siebzehn Jahren dokumentiert, von 1949 bis 1966. Neben einem fast unüberschaubaren Schwerpunkt auf französischem Repertoire (Bizet, Saint-Saens, Berlioz, Gounod, Fauré, Chopin, Franck, Ravel, Debussy, auch Boieldieu und einige mehr) dominiert vor allem die deutsch-österreichische Schule (Beethoven, Wagner, Schubert, Schumann, auch Liszt, Haydn und Mozart), der sich Cluytens, immerhin der erste Franzose bei den Bayreuther Festspielen, besonders verbunden fühlte. Dazu recht intensive Ausflüge ins russische Repertoire (Tschaikowski, Mussorgski, Prokofjew, Schostakowitsch usw.). Einzig die Italiener sind bis auf Menotti gar nicht vertreten. Zeitlich wird ein Zeitraum vom Barock bis in die Moderne umfasst, wobei die Romantik und Spätromantik den Löwenanteil ausmachen. Neben diversen französischen Orchestern (darunter das legendäre Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, das in Cluytens‘ Todesjahr unterging) sind die Berliner und Wiener Philharmoniker, das Philharmonia Orchestra aus London und das Belgische Nationalorchester vertreten.
Nun also die voluminöse Neuerscheinung bei Erato/Warner. Unser Korrespondent Daniel Hauser hat sich in die Aufnahmen vertieft. Hier seine Eindrücke: Vor einem halben Jahrhundert, am 3. Juni 1967, starb André Cluytens, belgisch-französischer Dirigent, mit gerade einmal 62 Jahren. Erato/Warner bedenkt ihn nun mit einer voluminösen, nicht weniger als 65 CDs umfassenden Box der kompletten Orchester- und Konzerteinspielungen (0190295886691). Cluytens war zwar Wahlfranzose, doch verleugnete er seine belgischen Wurzeln nicht und bestand, so berichten Zeitzeugen, auf der niederländischen Aussprache seines Nachnamens. Etliche der hier enthaltenen Aufnahmen erfahren nunmehr ihre späte CD-Premiere. Soviel darf bereits vorangestellt werden: Es hat sich in jedem Fall gelohnt. Gut die Hälfte der Aufnahmen ist in Mono, der Rest in Stereo festgehalten. Es wird ein Zeitraum von siebzehn Jahren dokumentiert, von 1949 bis 1966. Neben einem fast unüberschaubaren Schwerpunkt auf französischem Repertoire (Bizet, Saint-Saens, Berlioz, Gounod, Fauré, Chopin, Franck, Ravel, Debussy, auch Boieldieu und einige mehr) dominiert vor allem die deutsch-österreichische Schule (Beethoven, Wagner, Schubert, Schumann, auch Liszt, Haydn und Mozart), der sich Cluytens, immerhin der erste Franzose bei den Bayreuther Festspielen, besonders verbunden fühlte. Dazu recht intensive Ausflüge ins russische Repertoire (Tschaikowski, Mussorgski, Prokofjew, Schostakowitsch usw.). Einzig die Italiener sind bis auf Menotti gar nicht vertreten. Zeitlich wird ein Zeitraum vom Barock bis in die Moderne umfasst, wobei die Romantik und Spätromantik den Löwenanteil ausmachen. Neben diversen französischen Orchestern (darunter das legendäre Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, das in Cluytens‘ Todesjahr unterging) sind die Berliner und Wiener Philharmoniker, das Philharmonia Orchestra aus London und das Belgische Nationalorchester vertreten.

Mit Victoria de los Angeles, Nicolai Gedda, Roger Soyer und Ernest Blanc ist „L’Enfance du Christ“ von Hector Berlioz prominent besetzt.
Herzstück der Box ist dann auch der schon seit langem bei Kennern in hohen Ehren gehaltene Zyklus der Beethoven-Sinfonien, die erste Gesamteinspielung der Berliner Philharmoniker (1957-1960). Cluytens vereint den seinerzeit noch präsenten Furtwängler-Klang mit einer ihm eigenen französischen Eleganz, so dass man mit einigem Recht sagen könnte, dass dies nicht nur der erste, sondern nach meiner Auffassung auch der vielleicht interessanteste Beethoven-Zyklus aus Berlin ist – trotz Herbert von Karajan, Claudio Abbado und Sir Simon Rattle. Die mitunter kühl anmutende Perfektion Karajans, die bereits dessen berühmten Zyklus von 1961/62 kennzeichnet, ist Cluytens‘ Sache nicht. Emotionalität und schwungvolle Sinnlichkeit findet man dafür zuhauf. Ergänzt werden die Beethoven-Sinfonien durch Einspielungen zahlreicher Ouvertüren („König Stephan“ fehlt) und Klavierkonzerte (ohne Nr. 5); interessant auch der Vergleich mit einer ebenfalls enthaltenen früheren Aufnahme der 7. Sinfonie in Mono.
Dass sich Cluytens gerade im deutschen Fach heimisch fühlte, beweist er insbesondere in seinen Wagner-Interpretationen. Nicht hoch genug bewertet werden können die Vorspiele und Ouvertüren, die in den späten 1950er Jahren bereits in Stereo eingespielt wurden. Im besten Sinne „deutscher“ könnte in dieser Aufnahme das Meistersinger-Vorspiel kaum klingen. Die unbändige Ekstase der Tannhäuser-Ouvertüre (Dresdner Fassung) mit ihrem furiosen Höhepunkt erfasst André Cluytens wie nur wenige andere. Hier machte sich gewisslich die mannigfaltige Erfahrung als Operndirigent bezahlt. Großartig die bisher auf CD nicht greifbare Aufnahme der „Les Préludes“ von Franz Liszt. Cluytens lässt sich mehr Zeit als die meisten anderen Dirigenten (beinahe 18 Minuten), gibt der Musik Raum zum Atmen und setzt auf hochromantische Prachtentfaltung. Einmal mehr entpuppt sich der hier noch konservierte Klang Wilhelm Furtwänglers als ideal. Erstaunlich „deutsch“ auch sein Schubert (eine sehr intensive und bedeutungsschwere „Unvollendete“, leider keine „Große“ in C-Dur) und Schumann (die „Manfred“-Ouvertüre und die „Rheinische“ Sinfonie). Man bedauert es, dass Mendelssohns „Italienische“ nur in Auszügen enthalten ist. Überhaupt ist das 19. Jahrhundert die Hauptdomäne des Dirigenten Cluytens. Borodins „Steppenskizze aus Mittelasien“ sei hier nur beispielhaft genannt. Wie viele andere Werke ist sie in der Box sogar zweimal vertreten, wobei die Interpretationen sehr ähnlich und die gut klingende Stereoversion hier vorzuziehen ist. Ausgezeichnet Mussorgskis „Nacht auf dem kahlen Berge“. Ein Jammer, dass Cluyten’s Lesart der Tschaikowski-Sinfonien ebenfalls nur fragmentarisch überliefert ist. Erstaunlich nüchtern sein „Boléro“, den er ohne Mätzchen sowohl in Mono als auch in Stereo durchzieht.

Die Wagner-CD enthält Ouvertüren und Vorspiele zu den „Meistersingern“, „Tannhäuser“, „Holländer“ und „Lohengrin“.
Dass Cluytens generell ein herausragender Interpret der französischen Musik war, braucht hier im Detail nicht nachgewiesen zu werden. Sein Expertentum in Sachen Gounod ist durch seine 1958 entstandene Aufnahme des Faust hinlänglich bekannt. Die hier enthaltene Ballettmusik darf insofern als Anreiz auf die Gesamtaufnahme betrachtet werden. Fabelhaft auch seine Sichtweise auf Berlioz. Die enthaltenen Ouvertüren sind auch größtenteils doppelt eingespielt, was ebenso für die „Symphonie fantastique“ gilt. In diesem Zusammenhang sei auf seine beste, in dieser Box nicht enthaltene Aufnahme des Werkes mit dem Orchester des Pariser Konservatoriums in der Reihe „Great Conductors of the 20th Century“ (IMG Artists/EMI) verwiesen, in der er die beiden hier inkludierten Studioeinspielungen noch übertrifft. Sehr ungewöhnlich Cluytens‘ gallisch interpretierte „Moldau“ von Smetana, die ganz ungewohnt erklingt und eigenartige Akzente setzt; man hat stellenweise tatsächlich eher die Seine vor Augen.
Eine unerwartete westliche Referenzaufnahme legte Cluytens mit der 11. Sinfonie von Schostakowitsch vor, bekannt unter ihrem Beinamen „Das Jahr 1905“. Diese wurde vom Label Testament zwar bereits vor zwei Jahrzehnten erstmals auf CD veröffentlicht, doch ist es nur konsequent, dass sie auch in der neuen Box enthalten ist. Die Aufnahme entstand im Mai 1958, kurz nach der Welturaufführung der Sinfonie im Oktober des Vorjahres. Dmitri Schostakowitsch höchstpersönlich begleitete die Einspielung, so dass sie einen hohen Grad von Authentizität besitzt. Cluytens scheint sich des versteckten Zeitbezuges (Ungarnaufstand 1956) durchaus bewusst gewesen zu sein. Gegen Ende des Finalsatzes wechselt der Ton etwa eine halbe Minute lang ins Mono – vermutlich war das Stereomasterband an dieser Stelle unbrauchbar geworden. Glücklicherweise ist die beeindruckende Coda davon nicht betroffen. Bemerkenswert ist, dass auch Komponisten berücksichtigt wurden, die in den 1950er Jahren nicht wirklich massentauglich waren. Dies gilt besonders für Charpentier und C.P.E. Bach, aber auch eine Einspielung der „Abschiedssinfonie“ von Haydn (Nr. 45) (neben den Sinfonien Nr. 94, 96 und 101) ist nicht unbedingt naheliegend. Ein Wermutstropfen ist, dass diese Werke, wie auch Händels „Wassermusik“, nur in Mono eingefangen wurden. Eine spätere Neueinspielung wurde womöglich durch den frühen Tod des Dirigenten verhindert.

Claude Debussys „Le Martyre de Saint Sébastien“ wurde mit gesprochenen Dialogen aufgenommen und beansprucht zwei CDs.
Erwähnenswert ist die hohe Dichte an diversen Konzerten (daher auch im Boxtitel zurecht besonders betont): Beethovens Klavierkonzerte Nr. 1, 2, 3 und 4 sowie das Violinkonzert, C.P.E. Bachs Cellokonzert Nr. 3, Tschaikowskis Klavierkonzert Nr. 1, Schumanns Cellokonzert, Menottis Klavierkonzert, Niggs Klavierkonzert Nr. 1, Chopins Klavierkonzert Nr. 2, Prokofjews Klavierkonzert Nr. 3, Rachmaninows Klavierkonzerte Nr. 2 und 3, Saint-Saens‘ Klavierkonzert Nr. 2, Schostakowitschs Klavierkonzerte Nr. 1 und 2 sowie Ravels Klavierkonzert und sein Klavierkonzert für die linke Hand. Cluytens erweist sich dabei als kluger Begleiter, der sich nie in den Vordergrund drängt. Indem er sich nicht nur auf einige „Gassenhauer“ beschränkte, zeigte sich auch eine enge Verbundenheit des Dirigenten zur kollegialen Zusammenarbeit mit Instrumentalsolisten. Vokalwerke dominieren diese Box mitnichten. Die späte Einspielung von L’Enfance du Christ von Berlioz von 1965/66 (der Monofassung von 1950 vorzuziehen) bildet neben dem Requiem von Fauré die Ausnahme. Überaus hochkarätig die Sängerbesetzung beim Berlioz: Victoria de los Ángeles, Nicolai Gedda, Roger Soyer und Ernest Blanc stehen im Zentrum. Als Chor fungieren die Choeurs René Duclos. Eine idiomatischere, französischere Aufnahme dürfte man schwerlich finden. Wieder spielt das Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. Gleichsam ein Schwanengesang für Dirigent und Orchester, die kurz darauf beide verstummten. Cluytens betont das Lyrische des ohnehin verinnerlichten Oratoriums, nicht so sehr die opernhaften Züge. Selbst wenn man als Hörer kein Freund historischer Monoaufnahmen ist, bleiben nicht weniger als 30 CDs mit noch immer vorzeigbarem Stereoklang übrig, welche allein schon eine Anschaffung dieser essentiellen Box rechtfertigen.
Tatsächlich ist Erato/Warner mit dieser wichtigen Veröffentlichung eine lang ausstehende Würdigung von André Cluytens gelungen, der die Generation der französischen Dirigenten zwischen Pierre Monteux und Pierre Boulez zusammen mit dem etwas jüngeren (und ebenfalls zu zeitig verstorbenen) Jean Martinon vortrefflich repräsentierte. Die Aufmachung der Box ist sehr gelungen. Die einzelnen CDs finden sich in ansprechenden Papphüllen mit den jeweiligen ursprünglichen Originalcovern. Daniel Hauser