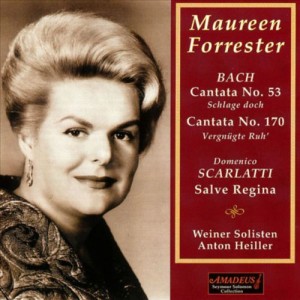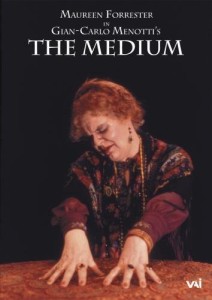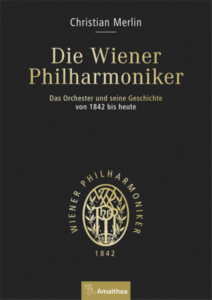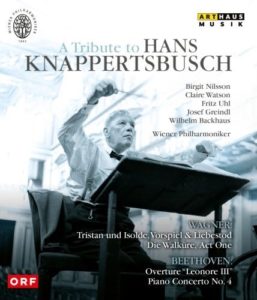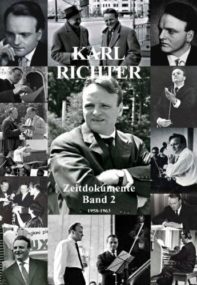Die Wiener Philharmoniker dürften in jedem musikinteressierten Haushalt präsent sein. Einspielungen, in denen sie mitwirken, sind Legion. Neue Produktionen werden oft genau so geschätzt wie die historischen Dokumente, die nicht selten Kultstatus erlangten. Mitschnitte aus der Wiener Staatsoper oder von den Salzburger Festspielen, sind nie aus den Katalogen verschwunden. Es gibt kaum Dirigenten, Instrumentalsolisten oder Sänger von Rang, die nicht mit diesem Orchester zusammengearbeitet hätten. Die berühmten Neujahrskonzerte erreichen durch die Fernsehübertragungen in alle Welt ein Publikum, das in die Millionen geht. Die Wiener Philharmoniker sind ein gewichtiges Kapitel Musikgeschichte für sich. Jetzt ist eine umfangreiche Dokumentation im Amalthea Verlag Wien erschienen (ISBN 978-3-99050-081-1). Unser Wiener Korrespondent Daniel Hauser hat sich durch die beiden Bände hindurch gearbeitet.
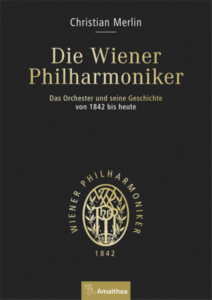 Im wahrsten Sinne des Wortes gewichtig kommt das neue zweibändige Werk Die Wiener Philharmoniker daher. Der in Paris lebende französische Musikwissenschaftler und Musikkritiker Christian Merlin, geboren 1964, erhebt damit den Anspruch, ein modernes Standardwerk verfasst zu haben. Tatsächlich ist Merlins Ansatz insofern revolutionär, als er versucht, das Orchester nicht als Kollektiv, sondern als die Summe seiner Mitglieder zu begreifen und seine Betrachtung gleichsam aus der Nanoperspektive heraus aufzieht. Bereits der Name unterstützt diese Vorgehensweise, ist doch, anders als beim ursprünglich Berliner Philharmonisches Orchester genannten deutschen Pedant, immer die Rede von den Wiener Philharmonikern.
Im wahrsten Sinne des Wortes gewichtig kommt das neue zweibändige Werk Die Wiener Philharmoniker daher. Der in Paris lebende französische Musikwissenschaftler und Musikkritiker Christian Merlin, geboren 1964, erhebt damit den Anspruch, ein modernes Standardwerk verfasst zu haben. Tatsächlich ist Merlins Ansatz insofern revolutionär, als er versucht, das Orchester nicht als Kollektiv, sondern als die Summe seiner Mitglieder zu begreifen und seine Betrachtung gleichsam aus der Nanoperspektive heraus aufzieht. Bereits der Name unterstützt diese Vorgehensweise, ist doch, anders als beim ursprünglich Berliner Philharmonisches Orchester genannten deutschen Pedant, immer die Rede von den Wiener Philharmonikern.
Der erste Band widmet sich dem Orchester und seiner Geschichte, der zweite den Musikern und Musikerinnen, wobei jeweils der gesamte Zeitraum von 1842 bis heute betrachtet wird. Bereits einleitend betont Merlin, dass die Philharmoniker in ihrem ursprünglich multikulturellen und multiethnischen Charakter ein Spiegelbild der Habsburgermonarchie gewesen seien, der erst später auf eine postulierte „Wiener Identität“ reduziert worden sei und in jüngster Zeit wieder vermehrt an den Geist der Gründerjahre anknüpfe. Um sich seine Einzigartigkeit zu bewahren, habe sich das Orchester der zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung widersetzt und andere aufstrebende Orchester als gefährliche Konkurrenten begriffen. Tatsächlich wurde stets die Tradition von der Beethoven-Nachfolge über Brahms und Bruckner betont. Merlin hebt die Janusköpfigkeit der Wiener Philharmoniker hervor, die sich ja aus Mitgliedern des Wiener Staatsopernorchesters zusammensetzen und eben in erster Linie ein Opernorchester sind. Nur als Orchester der Wiener Staatsoper kennen sie auch eine Hierarchie, sind im Verein der Wiener Philharmoniker doch alle Mitglieder gleichgestellt und teilen sich die Einnahmen zu gleichen Teilen. Mit einigem Recht, so Merlin, lese man also eher die Geschichte des Staatsopernorchesters, sind die Philharmoniker doch untrennbar mit der Wiener Hof- und später Staatsoper verbunden, von der auch alle großen Impulse für ihre eigene Entwicklung ausgingen.

Der Preuße Otto Nicolai gilt als der Gründer der Wiener Philharmoniker/ OBA
Zunächst thematisiert der Autor die Gründung der Wiener Philharmoniker durch den Preußen Otto Nicolai im Jahre 1842. Von der Idealbesetzung war man bei diesen frühen philharmonischen Konzerten noch weit entfernt, so dass fallweise auf externe Aushilfemusiker zurückgegriffen werden musste. Bereits kurz nach der Gründung gab es zudem Konflikte zwischen dem Dirigenten und einzelnen Orchestermusikern, die auf ihre weitgehende Unabhängigkeit pochten. Nicolai sollte die Oberhand behalten, doch war die Autonomiebestrebungen des Orchesters auf Dauer nicht mehr von der Hand zu weisen. Der frühe Tod Nicolais am 11. Mai 1849 im Alter von gerade 39 Jahren mag diese Weichenstellung noch verstärkt haben. Auf Nicolai folgte Franz Ignaz von Holbein, unter dem es erste Vorstöße in Richtung Pensionsfonds gab. Derartige Überlegungen wurden nötig, da es nach wie vor keinerlei finanzielle Absicherung im Alter und im Krankheitsfalle gab. Die nachfolgende Direktion des unbeliebten Julius Cornet hatte lediglich Interimscharakter. Ganz entscheidend war hingegen diejenige von Carl Eckert, der bereits 1853 Kapellmeister und 1858 schließlich Direktor geworden war. Unter ihm setzte sich die Vergrößerung des Orchesters fort und wurden 1860 die prägenden Abonnementkonzerte ins Leben gerufen. Nach den Statuten von 1862 nahm der Dirigent nach wie vor die vorherrschende Stellung ein. Von Bedeutung war in dieser Phase das Engagement des Geigers Josef Hellmesberger sen., der nicht nur ob seiner Meisterschaft gerühmt wurde (so von Eduard Hanslick), sondern auch das seit Jahrzehnten brachliegende Kammermusikleben in Wien mit seinem Quartett wiederbelebte.

Eine neue Ära in der Geschichte des Orchesters begann mit der Eröffnung des neuen Opernhauses. Foto: Winter
Eine neue Ära begann 1869 mit der Eröffnung des seinerzeit scharf kritisierten neuen Opernhauses. Keiner seiner beiden Architekten, August Sicard von Sicardsburg und Eduard van der Nüll, erlebte diese. Für das Orchester bedeutete das neue große Haus zusätzliche Arbeit. Hinzu kamen außerordentliche Konzerte, darunter etwa von Richard Wagner geleitete in den Jahren 1862 und 1863. Bald schon kam es zu neuen Konflikten zwischen dem Operndirektor und dem Orchester, das weiter um seine Unabhängigkeit kämpfte und dem vorgeworfen wurde, die Opernvorstellungen zugunsten der Konzerte zu vernachlässigen. Die Zusammensetzung des Orchesters in dieser Zeit darf mit Fug und Recht als multiethnisch bezeichnet werden. Die verschiedenen Länder der Donaumonarchie waren genauso präsent wie der überdurchschnittlich hohe Anteil an Juden im Orchester. Gründe hierfür waren das Emanzipationsgesetz von 1867 sowie die Folgen des österreich-ungarischen Ausgleiches vom selben Jahr. Die neue Hofoper brachte zudem den größten Zuwachs in der Geschichte des Orchesters.

Gustav Mahler Foto: Sammlung Manskopf
Von enormer Wichtigkeit war die von 1897 bis 1907 andauernde Dekade unter der Stabführung des Hofoperndirektors Gustav Mahler. Seine Reformarbeit wird häufig auf die Modernisierung des Repertoires und der Regie reduziert. Dabei wird übersehen, welch großen Anteil Mahlers Perfektionismus an der weiteren Professionalisierung des Orchesters hatte. Auf dessen Initiative gehen auch die Auslandstourneen der Wiener Philharmoniker zurück. Den Anfang machte 1900 eine Reise nach Paris, die sich finanziell indes als Misserfolg entpuppte. Nach dem entnervten Rückzug Mahlers als Leiter der Abonnementkonzerte (1901) und einem kurzen und erfolglosen Zwischenspiel des einstigen Wunderkindes Josef Hellmesberger jun. (1903) behalf man sich in der Folge mit Gastdirigenten. Die Senkung des Durchschnittsalters im Staatsopernorchester war Mahlers wichtigste Reform. Tatsächlich setzte eine spürbare Verjüngung ein. In seiner zehnjährigen Amtszeit wurden nicht weniger als 79 neue Orchestermitglieder engagiert. In etwa die Hälfte, 35, blieb mehr als 30 Jahre mit dem Orchester verbunden und prägten es nachhaltig, so dass Mahler letztlich eine wichtige Weichenstellung weit über seine aktive Zeit als Operndirektor hinaus einleitete. Nicht unkritisch wurde die zunehmende Internationalisierung der Orchestermusiker beäugt. Neben Niederländern und einem Griechen waren es insbesondere deutsche Musiker, welche Mahler ins Orchester holte. Nicht nur wegen seines oft willkürlich erscheinenden Umgangs mit Mitgliedern des Orchesters war Mahler höchst umstritten. Allerdings gab es durchaus eine Fraktion, die bedingungslos hinter ihm stand. Welche Rolle Antisemitismus spielte, bleibt strittig.

Franz Schalk. Foto: Sammlung Manskopf
Das Jahrzehnt nach Mahler war aufgrund des Ersten Weltkrieges politisch überaus stürmisch, für das Orchester indes eine Ruhephase. 1908 erfolgte die Gründung des Vereins Wiener Philharmoniker, die damit erstmals auch rechtlich von der Hofoper unabhängig wurden. Erst jetzt erhielten die Philharmoniker endgültig ihren bis heute gültigen Namen. Die ebenfalls 1908 zustande gekommene Berufung Felix Weingartners zum Operndirektor (bis 1911) und Leiter der Abonnementkonzerte (bis 1927) sollte sich als wichtigstes personelles Ereignis erweisen. Dem Zusammenbruch der Monarchie im November 1918 folgte die Umwandlung der Hofoper in die Staatsoper, was aufgrund der Umsichtigkeit des neuen Direktors Franz Schalk reibungslos über die Bühne ging. Obgleich in erster Linie Dirigent, hatte Schalk bei den Philharmonikern einen schweren Stand, zogen diese doch andere Dirigenten vor. Gleichwohl vermied Schalk einen offenen Konflikt. Zwischen 1919 und 1924 wurde er durch Richard Strauss als Operndirektor unterstützt. Unter der Direktion Schalk/Strauss kam es zu den ersten Salzburger Festspielen (1922) sowie zur bislang größten und kompliziertesten Tournee der Philharmoniker nach Südamerika (1923), auf der nicht weniger als vier Mitglieder ihr Leben ließen. Auf die erste Auslandstournee Mahlers nach Paris (1900) folgten Reisen nach England (1906), München (1910), in die Schweiz (1917), nach Berlin (1918) und in die Tschechoslowakei (1921). In die 1929 endende Ära Schalk fielen zudem die Anfänge der später so wichtig werdenden Rundfunkübertragungen. 1924 kam es zudem zur ersten Plattenaufnahme der Wiener Philharmoniker: Der Donauwalzer unter der musikalischen Leitung von Josef Klein.

Die Wiener Philharmoniker mit Arturo Toscanini nach einer Probe in Salzburg 1935/ Hist. Archiv Wiener Philharmoniker
Bereits 1928 folgten mehrere Beethoven-Sinfonien unter Schalk. Ein 1922 unternommener ambitionierter Versuch einer massiven Orchester-Vergrößerung fiel bereits 1925 von der Regierung verordneten Sparmaßnahmen zum Opfer. Nach dem Ausscheiden Weingartners folgte diesem 1927 Wilhelm Furtwängler, seit 1922 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, als Leiter der Philharmonischen Abonnementkonzerte nach. Auch wenn Franz Schalk mit seinem Reformvorhaben aufgrund der seinerzeit angespannten wirtschaftlichen Situation nicht durchdrang, darf seine knapp elfjährige Amtszeit doch als wichtiger als bislang angenommen gelten. Von großer Bedeutung war die Amtszeit von Clemens Krauss als Staatsoperndirektor (1929 – 1934) und Hauptdirigent der Abonnementkonzerte (1930 – 1933). Zum ersten Mal seit 1911 und zum letzten Mal überhaupt lagen Operndirektion und Leitung der Abonnementkonzerte in einer Hand. Tatsächlich sollte es danach bis zum heutigen Tage nur mehr Gastdirigenten und keine festen Leiter der letzteren mehr geben. Krauss hatte trotz seiner unbestreitbaren musikalischen Fähigkeiten von Anfang an einen schweren Stand sowohl in der Staatsoper als auch bei den Philharmonikern, besaß er doch eine unverkennbare Liebe für die Moderne und auch zeitgenössische Komponisten. Obwohl er das spieltechnische Niveau des Orchesters weiter steigerte, gingen die Besucherzahlen während seiner Ära zurück. Auf seine Initiative gingen die Verpflichtung des gerade 19-jährigen argentinisch-russischen Geigers Ricardo (Richard) Odnoposoff als Konzertmeister wie auch das Engagement des später so wirkungsmächtigen Willi Boskovsky zurück. Vom zunehmenden Widerstand ermüdet, gab Clemens Krauss seine Positionen in Wien in den Jahren 1933/34 entnervt auf und ging nach München. Die Direktion des gealterten Felix Weingartner (1935/36) blieb Episode. Von nun an dominierten Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer, Arturo Toscanini und insbesondere der in München geschasste Hans Knappertsbusch das Geschehen. Knappertsbusch hatte zwischen 1938 bis 1941 faktisch die künstlerische Leitung der Staatsoper inne, auch wenn er mit keinem entsprechenden Titel ausgestattet wurde.

Clemens Krauss Foto: Sammlung Manskopf
Der unseligen Zeit des Nationalsozialismus in Österreich (1938 – 1945) widmet Merlin breiten Raum. Nicht weniger als siebzehn Philharmoniker wurden in diesem Zeitraum unmittelbare Opfer der Nazis, darunter dreizehn Aktive und vier Pensionisten. Neun dieser siebzehn gingen ins Exil, fünf kamen im KZ ums Leben, zwei verstarben noch vor ihrer beabsichtigten Deportation, ein einziger verblieb in Wien. Die nur wenige Tage nach dem „Anschluss“ eingeleiteten Zwangspensionierungen jüdischer Musiker machten ab März 1938 den Anfang. So maßgebliche Musiker wie Arnold Rosé und Friedrich Buxbaum wurden auf diese Art in geradezu entwürdigender Weise aus dem Orchester gedrängt. Tonangebend war in diesen Jahren Wilhelm Jerger, der im März 1938 kommissarischer Leiter und zwischen Dezember 1939 und Mai 1945 schließlich offizieller Vorstand der Wiener Philharmoniker war. Jerger, ein strammer Nationalsozialist, war bereits seit 1932 Parteimitglied der NSDAP und seit 1938 zudem in der SS. Seine Rolle ist höchst umstritten. Von ihm nach dem Krieg versuchte Relativierungsversuche halten einer jüngst vorgenommenen kritischen Überprüfung nicht stand. Gleichwohl bescheinigt ihm Merlin, dass er „zwar autoritär, aber kein Diktator“ gewesen sei. Immerhin gab es tatsächlich seinerseits vorgenommene Interventionsversuche, um jüdischen Orchestermitgliedern beizustehen; bis auf einen einzigen blieben diese indes erfolglos. Der wichtigste Staatsoperndirektor in der NS-Zeit war der zwischen 1943 und 1945 erstmals amtierende Karl Böhm, dessen Stellung zu den Nationalsozialisten ebenfalls umstritten ist.

Die Wiener Philharmoniker mit Richard Strauss in Rio 1923/ Foto Hist. Archiv Wiener Philharmoniker
Der Vereinsstatus der Philharmoniker stand zwischenzeitlich durchaus auf der Kippe. Anders als die Berliner Philharmoniker wurden die Wiener indes niemals zum „Reichsorchester“ und konnten ihre Autonomie zumindest teilweise verteidigen. Kurioserweise kam es ausgerechnet in der NS-Zeit zu einer massiven Vergrößerung des Orchesters, obwohl der Aderlass infolge des Ausschlusses jüdischer Mitglieder gewaltig war. Aufgrund einer von Wilhelm Furtwängler vorgelegten Liste gelang es zumindest, einige sogenannte „jüdisch Versippte“ und „Mischlinge“ im Orchester zu halten. Gleichwohl ging auch Furtwängler hier mitunter willkürlich vor. Die Frage, inwieweit die Orchestermitglieder mit dem Nationalsozialismus verstrickt waren, wurde in den letzten Jahren häufig aufgeworfen. Bereits der österreichische Historiker Oliver Rathkolb stellte fest, dass nicht weniger als 60 Philharmoniker, was beinahe der Hälfte der Aktiven entsprach, Mitglied der NSDAP waren. Andererseits gab es keinesfalls eine Bevorzugung für Parteimitglieder, wenn es um Stellenausschreibungen ging. Merlin zieht das Resümee, dass sich das Orchester der Doktrin des Regimes „im besten Fall mit passivem Fatalismus, im schlimmsten Fall mit schuldhafter Mittäterschaft beugte“. Zu einer Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg kam es innerhalb des Orchesters nur marginal. Jerger war freilich unhaltbar geworden. Die meisten anderen der wenigen Betroffenen wären indes ohnehin in den Ruhestand geschickt worden oder standen kurz davor. Den österreichischen Behörden ging die Aufrechterhaltung des musikalischen Niveaus des Orchesters vor. Selbst scharfe Gegner des Nationalsozialismus plädierten für Milde im Umgang mit ehemaligen Parteimitgliedern und -anwärtern. Die Besatzungsmächte ließen die Autonomie des Orchesters unangetastet und konnten sich aufgrund interner Uneinigkeit noch nicht einmal auf die Entlassung stark belasteter Orchestermitglieder verständigen.
Clemens Krauss kehrte sofort nach Kriegsende von München nach Wien zurück und dirigierte zunächst mit ausdrücklicher Billigung der Sowjets, bevor er mit einem bis 1947 andauernden Berufsverbot belegt wurde. Zwischen 1945 und 1955 kam es infolge der Zerstörung des Opernhauses zu einer Trennung in die „Staatsoper im Theater an der Wien“ und die „Staatsoper in der Volksoper“. Musiker des Volksopernorchesters hatten keine Chance, zu Philharmonikern aufzusteigen. Das Volksopernorchester wurde vom amerikanischen Label Westminster unter dem missverständlichen Namen „Orchestra of Vienna State Opera“ kostengünstig für Schallplattenaufnahmen herangezogen. Als Dirigent wirkte insbesondere Hermann Scherchen.

Das Cover dieser noch von der EMI veröffentllichten CD zeigt Herbert von Karajan vor dem Stammhaus der Wiener Philharmoniker – dem Musikverein.
Die Anfänge des berühmten Wiener Neujahrskonzertes gehen auf den Clemens Krauss im Jahre 1939 zurück. Abgesehen von den Jahren 1946/47, in denen es Josef Krips leitete, stand Krauss dem Neujahrskonzert bis zu seinem Tode 1954 vor. Das Orchester einigte sich sodann auf Erich Kleiber, der jedoch ablehnte (Furtwängler erhielt in einer weiteren Abstimmung lediglich zwei Stimmen!). Schließlich nominierte man Konzertmeister Willi Boskovsky, der das Neujahrskonzert bis 1979 leiten und stark prägen sollte. Erst danach wurden wieder Gastdirigenten dafür verpflichtet. Den Anfang machte Lorin Maazel im Jahre 1980. Die prägenden Dirigenten der frühen Nachkriegsjahre waren Hans Knappertsbusch, Wilhelm Furtwängler und Clemens Krauss. Aufgrund des persönlichen Gegensatzes mit Furtwängler spielte Herbert von Karajan am Pult der Philharmoniker in dieser Zeit keine Rolle, dies freilich ganz zum Vorteil der konkurrierenden Wiener Symphoniker. Karl Böhm kehrte 1951 zurück. Daneben gab es enge Verbindungen mit André Cluytens, Rafael Kubelík, Pierre Monteux, Carl Schuricht und insbesondere Dimitri Mitropoulos. Von Wichtigkeit und als Genugtuung darf die neuerliche Verpflichtung des jüdischen Dirigenten Bruno Walter bezeichnet werden.

Der Mitschnitt aller Sinfonien Beethovens mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Leonard Bernstein am Pult der Wiener Philharmoniker wurde im Fernsehen gezeigt und ist bei Deutsche Grammophon erschienen.
Nach der Wiedereröffnung der Staatsoper im Jahre 1955 kam es zu immer ausgedehnteren Auslandstourneen der Wiener Philharmoniker (1956 Japan und USA, 1959 Welttournee). Ein dringend notwendiger Aufholprozess wurde unter der Direktion Böhms (1954 – 1956) und insbesondere Karajans (1956 – 1964) eingeleitet. Letzteren charakterisiert Merlin als „sicher de[n] Einzige[n], der sich mit Gustav Mahler in Hinblick auf seinen Ruf und die in ihn gesetzten Erwartungen vergleichen ließ“. Tatsächlich betätigte sich Karajan lediglich als Gastdirigent der Philharmoniker, hatte die Staatsoper jedoch fest in seiner Hand. Obwohl er einige Alleingänge bei Personalentscheidungen tätigte und somit in die Autonomie des Orchesters eingriff, wussten die Philharmoniker sehr gut, was sie an diesem Dirigenten hatten. Das „summarische Niveau“ überstrahle die bisherigen Vorbilder, so das Orchester. Konnte ein Rückzug Karajans von der Operndirektion 1962 aufgrund philharmonischer Intervention noch vermieden werden, kam es 1964 zum endgültigen Bruch. Erst 1977 sollte Karajan an die Wiener Staatsoper zurückkehren, gar erst 1983 zu seinem Abonnementkonzert im Musikverein.
Die zunehmende Konkurrenz durch ausländische Orchester, die in ihrem Niveau den Wiener Philharmonikern nicht mehr nachstanden, mag die beispiellose Intervention des Decca-Produzenten John Culshaw erklären, der mehrfach seine Wunschvorstellungen hinsichtlich der Orchesterbesetzung durchbringen konnte. Angeführt wurden Probleme bei diversen Aufnahmen, die einen solchen Schritt nötig machten (Le Sacre unter Georg Solti wurde deswegen sogar nicht zur Veröffentlichung freigegeben). Tatsächlich verdankten die Wiener Philharmoniker der britischen Plattenfirma einen erheblichen Teil ihres weltweiten Renommees. Zuvörderst muss hier die erste und noch heute als Referenz betrachtete Stereoeinspielung von Wagners Ring des Nibelungen angeführt werden, die in den Jahren zwischen 1958 und 1965 zustande kam.

Die erste Gesamtaufnahme des „Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner durch die Decca gehört zu den bleibenden Leistungen des Orchesters.
Anfang der 1960er Jahre tat sich erstmal die Frauenfrage auf. Lange nach diversen amerikanischen, britischen und französischen Orchestern und auch nach den Berliner Philharmonikern (1982) wurde erst 1997 (!) die erste Frau als vollwertiges Vereinsmitglied zugelassen. Dem vorausgegangen war schließlich eine Intervention des zuständigen Ministeriums. In den 1960er Jahren kam es auch zu einer vierten massiven Orchestervergrößerung, welche den Philharmonikern im Grunde genommen ihre heutige Gestalt verlieh. Mittlerweile spielen immerhin elf Frauen bei den Wiener Philharmonikern. Eine jüngere Generation von Dirigenten trat nun auf den Plan. Von den „Alten“ war einzig Böhm übriggeblieben. Hinzu kamen späterhin so bedeutend werdende junge Dirigenten wie Lorin Maazel (ab 1962), Zubin Mehta (ab 1962), Claudio Abbado (ab 1965) und Seiji Ozawa (ab 1966). Abbado sollte es 1986 zum Musikdirektor der Staatsoper, Ozawa 2002 gar zum Staatsoperndirektor bringen. In den frühen 1970er Jahren kam Riccardo Muti hinzu. Als besonders wichtig sollte sich allerdings die Zusammenarbeit mit Leonard Bernstein erweisen, der zwischen 1966 und 1990 eine ganz essentielle Rolle im Wiener Musikleben spielte (Merlin spricht von einem „Höhepunkt“). Unter „Lennys“ Stabführung kam es zur lange ausstehenden systematischen Beschäftigung des Orchesters mit Gustav Mahler. Nach Böhms Ableben 1981 konnte mit der Wiederverpflichtung Karajans 1983 ein Ausgleich geschaffen werden. Der Tod Karajan 1989 und Bernsteins 1990 sowie der 150. Geburtstag der Philharmoniker 1992 markierten eine Zeitenwende. Neben der Aufnahme von Frauen und einer spürbaren Verjüngung waren die letzten Jahrzehnte von einer neuerlich zunehmenden Internationalisierung der Wiener Philharmoniker geprägt, wobei ost(mittel)europäische und insbesondere ehemalige habsburgische Kronländer präsent sind (Ungarn, Tschechien, Slowakei, Kroatien, Slowenien). Freilich wäre es auch heute übertrieben, von einem „internationalen Orchester“ zu sprechen, sind doch zwei Drittel gebürtige Österreicher/innen.
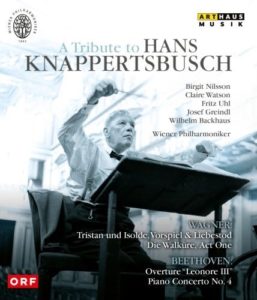
Hans Knappertsbusch/ ORF
Im zweiten Band schließlich listet Merlin akribisch die Biographien sämtlicher Orchestermusiker und -Musikerinnen auf. Er geht hier auch auf Staatsopernmitglieder ein, die nie bei den Philharmonikern aufgenommen wurden. In weiteren Kapiteln werden die Entwicklung des Orchesterstandes, die Abfolge der Vereinsmitglieder und die Nachfolgen am Pult behandelt. Auch den Philharmoniker-Familien widmet der Autor einen eigenen Abschnitt. Von besonderem Interesse ist das Kapitel zu den Rekorden. Das jüngste Mitglied (Otto Stehlik) trat etwa mit nur 14 Jahren ein und zwei Mitglieder (Arnold Rosé und Mathias Meyer) gehörten dem Orchester über ein halbes Jahrhundert lang an. Insgesamt eine unverzichtbare Fleißarbeit, die ihrem Anspruch, das neue Standardwerk zu sein, sehr nahekommt. Nur vereinzelt hätte man sich noch ausführlichere Details gewünscht, etwa hinsichtlich der Opernreform Karajans, der Intrigen um die Staatsoperndirektoren allgemein (man denke nur Egon Hilbert und Lorin Maazel) und bezüglich konzertanter Opernaufführungen durch die Wiener Philharmoniker wie den erste Aufzug der Walküre unter Knappertsbusch von 1963 (Foto oben: die Wiener Philharmoniker/ Foto Terry Linke; Dank auch an Silvia Kargl vom Historischen Archiv der Wiener Philharmoniker). Daniel Hauser
 In ihrer ursprünglichen Form, der sogenannten Linzer Fassung von 1866, hat die 1. Sinfonie von Anton Bruckner, der beinahe zwei Generationen vor Sibelius geboren wurde, nicht einmal zeitlich etwas mit dessen Erster gemein. Ihre Komposition begann 1865, im Geburtsjahr des Finnen. Ein Vierteljahrhundert später legte Bruckner eine völlig überarbeitete, die Wiener Fassung von 1891, vor. In dieser Neufassung blieb vom „kecken Beserl“ nicht mehr viel übrig, dafür gebührt ihr als Letztfassung schon per se Beachtung. In der Diskographie ist diese 1891er Version nicht unbedingt bevorzugt worden (dort dominiert die überarbeitete Linzer Fassung von 1877). Der spanische Dirigent Gustavo Gimeno entschied sich in seiner neuen Einspielung mit dem Orchestre Philharmonique de Luxembourg auf dem Label Pentatone (PTC 5186 613) gleichwohl für diese reifere Variante. Bereits im mächtigen Kopfsatz (12:03) ist der Bruckner’sche Tonfall unverkennbar zu spüren. Auch Bruckner kleidet seinen ersten Satz in ein düsteres Gewand, doch in völlig anderer Weise als Sibelius. Hier hat man eher gotisches Bauwerk vor Augen denn eine Naturschilderung. Nachdenklich das Adagio (12:07), mit einigen eruptiven Orchesterausbrüchen versehen. Wahrlich Lebhaft das Scherzo (9:08), einer der Höhepunkte der Aufnahme. Man ist freudig überrascht, welch hohe Qualität dieses luxemburgische Orchester doch besitzt. Auch hier muss die vorzügliche Klangqualität hervorgehoben werden. Allein diese rechtfertigt schon Neueinspielungen auf einem übersättigt wirkenden Markt. Bewegt, feurig zündet das Finale bereits in den ersten Takten und unterscheidet sich damit von allen anderen Finalsätzen Bruckners, die es zu Beginn ruhig angehen lassen. Mit 16:57 verfügt dieser Satz bereits beinahe über die Dimensionen der späten Sinfonien. Die Dramatik erstirbt urplötzlich und geht in eine lyrische Stimmung über. Dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich insgesamt das Drama durchsetzt. Stellenweise entfacht Gimeno ein regelrechtes Feuerwerk. Abschließender Gipfelpunkt, wie könnte es anders sein, die Coda, mit einem geradezu apokalyptischen Momentum. Bravo! Von Interesse für den Bruckner-Freund sind gerade auch die Beigaben auf der CD: vier selten gespielte Orchesterwerke aus der Frühzeit des Komponisten (1862). Zum einen der knapp fünfminütige Marsch in d-Moll WAB 96, der trotz seiner Tonartbezeichnung kurioserweise eher grüblerisch daherkommt. Die Drei Sätze für Orchester Moderato, Allegro non troppo und Andante con moto, zusammen kaum acht Minuten, stehen in einem engeren Zusammenhang (WAB 97). Hier widmete sich Bruckner zum ersten Mal der absoluten Musik, die sein weiteres Schaffen so stark prägen sollte.
In ihrer ursprünglichen Form, der sogenannten Linzer Fassung von 1866, hat die 1. Sinfonie von Anton Bruckner, der beinahe zwei Generationen vor Sibelius geboren wurde, nicht einmal zeitlich etwas mit dessen Erster gemein. Ihre Komposition begann 1865, im Geburtsjahr des Finnen. Ein Vierteljahrhundert später legte Bruckner eine völlig überarbeitete, die Wiener Fassung von 1891, vor. In dieser Neufassung blieb vom „kecken Beserl“ nicht mehr viel übrig, dafür gebührt ihr als Letztfassung schon per se Beachtung. In der Diskographie ist diese 1891er Version nicht unbedingt bevorzugt worden (dort dominiert die überarbeitete Linzer Fassung von 1877). Der spanische Dirigent Gustavo Gimeno entschied sich in seiner neuen Einspielung mit dem Orchestre Philharmonique de Luxembourg auf dem Label Pentatone (PTC 5186 613) gleichwohl für diese reifere Variante. Bereits im mächtigen Kopfsatz (12:03) ist der Bruckner’sche Tonfall unverkennbar zu spüren. Auch Bruckner kleidet seinen ersten Satz in ein düsteres Gewand, doch in völlig anderer Weise als Sibelius. Hier hat man eher gotisches Bauwerk vor Augen denn eine Naturschilderung. Nachdenklich das Adagio (12:07), mit einigen eruptiven Orchesterausbrüchen versehen. Wahrlich Lebhaft das Scherzo (9:08), einer der Höhepunkte der Aufnahme. Man ist freudig überrascht, welch hohe Qualität dieses luxemburgische Orchester doch besitzt. Auch hier muss die vorzügliche Klangqualität hervorgehoben werden. Allein diese rechtfertigt schon Neueinspielungen auf einem übersättigt wirkenden Markt. Bewegt, feurig zündet das Finale bereits in den ersten Takten und unterscheidet sich damit von allen anderen Finalsätzen Bruckners, die es zu Beginn ruhig angehen lassen. Mit 16:57 verfügt dieser Satz bereits beinahe über die Dimensionen der späten Sinfonien. Die Dramatik erstirbt urplötzlich und geht in eine lyrische Stimmung über. Dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich insgesamt das Drama durchsetzt. Stellenweise entfacht Gimeno ein regelrechtes Feuerwerk. Abschließender Gipfelpunkt, wie könnte es anders sein, die Coda, mit einem geradezu apokalyptischen Momentum. Bravo! Von Interesse für den Bruckner-Freund sind gerade auch die Beigaben auf der CD: vier selten gespielte Orchesterwerke aus der Frühzeit des Komponisten (1862). Zum einen der knapp fünfminütige Marsch in d-Moll WAB 96, der trotz seiner Tonartbezeichnung kurioserweise eher grüblerisch daherkommt. Die Drei Sätze für Orchester Moderato, Allegro non troppo und Andante con moto, zusammen kaum acht Minuten, stehen in einem engeren Zusammenhang (WAB 97). Hier widmete sich Bruckner zum ersten Mal der absoluten Musik, die sein weiteres Schaffen so stark prägen sollte. Der dritte sinfonische Erstling in diesem Dreigestirn unterscheidet sich deutlich von den beiden anderen. 1924/25 komponiert und 1926 uraufgeführt, ist die 1. Sinfonie des noch nicht zwanzigjährigen Dmitri Schostakowitsch Kind einer gänzlich anderen Zeit. Bestritten wird die Aufnahme von denselben Kräften wie bereits der Bruckner: Gustavo Gimeno mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg (Pentatone PTC 5186 622), die auch hier beweisen, dass es nicht immer die ganz großen Namen braucht, um zu überzeugen. Die Anklänge an Strawinski und Prokofjew sind bei diesem Frühwerk deutlich erkennbar, was freilich nicht unbedingt von Nachteil sein muss. Mit großer Virtuosität und Frische gehen die Luxemburger an diese Sinfonie heran und zeigen sich unbeeindruckt von all den maßgeblichen Interpreten vergangener Tage. Mag auch nicht ganz die Expressivität eines Jewgeni Swetlanow oder Kirill Kondraschin erreicht werden (womöglich in dieser Form nur zu Sowjetzeiten möglich), so beeindruckt doch die enorme Beweglichkeit in Gimenos Deutung. Die reinen Spielzeiten decken sich übrigens beinahe 1:1 mit Kondraschin: 8:47 – 4:55 – 9:27 – 9:43. Sehr gelungen ist in dieser Neueinspielung der zweite Satz mit seinem Klavierpart. Im langsamen und dunklen dritten Satz hört man gar dezente Wagner-Anklänge. Schostakowitsch sollte dies Jahrzehnte später in seiner letzten Sinfonie nochmal in Form eines waschechten Wagner-Zitats wiederholen (dann in todesverkündender Absicht). Die exquisite Tontechnik tut einmal mehr das Ihrige, um dem Hörer diese neue Aufnahme schmackhaft zu machen. Die Attacca-Überleitung zum Finale mit Trommelwirbel profitiert hiervon beispielsweise. Im Finalsatz gibt es ruhige Passagen, die regelmäßig von furiosen Ausbrüchen des vollen Orchesterapparats unterbrochen werden; die Stimmung ist hier wie dort düster. Markerschütternd das Paukensolo, welches wiederum eine lyrische Passage mit Solocello einleitet. Die Coda klingt mit einem letzten fanfarenartigen Aufheulen der Blechbläser aus.
Der dritte sinfonische Erstling in diesem Dreigestirn unterscheidet sich deutlich von den beiden anderen. 1924/25 komponiert und 1926 uraufgeführt, ist die 1. Sinfonie des noch nicht zwanzigjährigen Dmitri Schostakowitsch Kind einer gänzlich anderen Zeit. Bestritten wird die Aufnahme von denselben Kräften wie bereits der Bruckner: Gustavo Gimeno mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg (Pentatone PTC 5186 622), die auch hier beweisen, dass es nicht immer die ganz großen Namen braucht, um zu überzeugen. Die Anklänge an Strawinski und Prokofjew sind bei diesem Frühwerk deutlich erkennbar, was freilich nicht unbedingt von Nachteil sein muss. Mit großer Virtuosität und Frische gehen die Luxemburger an diese Sinfonie heran und zeigen sich unbeeindruckt von all den maßgeblichen Interpreten vergangener Tage. Mag auch nicht ganz die Expressivität eines Jewgeni Swetlanow oder Kirill Kondraschin erreicht werden (womöglich in dieser Form nur zu Sowjetzeiten möglich), so beeindruckt doch die enorme Beweglichkeit in Gimenos Deutung. Die reinen Spielzeiten decken sich übrigens beinahe 1:1 mit Kondraschin: 8:47 – 4:55 – 9:27 – 9:43. Sehr gelungen ist in dieser Neueinspielung der zweite Satz mit seinem Klavierpart. Im langsamen und dunklen dritten Satz hört man gar dezente Wagner-Anklänge. Schostakowitsch sollte dies Jahrzehnte später in seiner letzten Sinfonie nochmal in Form eines waschechten Wagner-Zitats wiederholen (dann in todesverkündender Absicht). Die exquisite Tontechnik tut einmal mehr das Ihrige, um dem Hörer diese neue Aufnahme schmackhaft zu machen. Die Attacca-Überleitung zum Finale mit Trommelwirbel profitiert hiervon beispielsweise. Im Finalsatz gibt es ruhige Passagen, die regelmäßig von furiosen Ausbrüchen des vollen Orchesterapparats unterbrochen werden; die Stimmung ist hier wie dort düster. Markerschütternd das Paukensolo, welches wiederum eine lyrische Passage mit Solocello einleitet. Die Coda klingt mit einem letzten fanfarenartigen Aufheulen der Blechbläser aus.