.
Das Theater für Niedersachsen (TFN) ist seit einer Zeit für Opern-Überraschungen gut. Unter Florian Ziemen hat sich die Hildesheimer Bühne zu einem veritablen Zauberkasten gewandelt, man erinnert sich noch an Donizettis Adelia und Mercadantes Briganti (sorry, natürlich auch an Wagners Tristan, Offenbachs Trapezunt & Co.), wo vor allem bei Letzteren dem Belcanto-Fan das Wasser im musikalischen Mund zusammenlief (und wir bei operalounge.de beide Aufführungen gebührend würdigten).

Pacinis „Medea“ am TFN Hildesheim/Szene/ Foto Tim Müller
Nun also Pacinis Medea in m. W., deutscher Erstaufführung und als zweiter europäischer Versuch nach der auch bei Agora dokumentierten Aufführung in Savona 1993 unter Richard Bonynge (immerhin). Hier nun in Hildesheim dirigiert der Chef Florian Ziemen (der dafür erfreulicherweise einige Striche aufgemacht hat, die man in Savona beanstandete), und die Besetzung ist mit Robyn Allegra Parton, Yohan Kim, Zachary Wilson, Uwe Tobias Hieronimi, Xin Pan und Neele Kramer besetzt. Gerhard Eckels bespricht die Aufführung für uns (folgt), und der renommierte Musikwissenschaftler und Belcanto-Spezialist Alex Weatherson von der Londoner Donizetti Gesellschaft steuert einen Artikel zum Komponisten und dem Werk bei. Chapeau für das TFN und Florian Ziemen für deren Mut und Kreativität.
Belcanto-Ausgrabung: Bei operalounge-de gab und gibt es zu Recht immer wieder Lob für Florian Ziemen, den GMD am Theater für Niedersachsen (TfN), für seinen Mut, in dem kleinen, aber keineswegs provinziellen Theater weitgehend Unbekanntes aufzuführen. Dort wird der Medea-Stoff ähnlich wie im Vorjahr bei Mercadantes Briganti im Rahmen einer Trilogie verarbeitet. Neben der Oper Medea von Giovanni Pacini gibt es die Tragödie von Pierre Corneille und ein Tanztheater mit dem Donlon Dance Collective. G. H.

Pacinis „Medea“: Figurinen zur Uraufführung/ Ricordi
Und nun also Alex Weatherson: „Il maestro delle cabalette“: Zur Besorgnis und Bestürzung von weniger produktiven Komponisten unterteilt sich die Karriere des unermüdlichen Giovanni Pacini, eines Opernlieferanten im Handumdrehen, in zwei gleichermaßen erfolgreiche Hälften: Diejenigen Opern, die vor 1835 geschrieben wurden, eine unaufhaltsame Flut von Arien, Duetten und Trios; Strettas und Cabalettas in Hülle und Fülle (so viele, dass er von einem nicht immer dankbaren Publikum den Spitznamen „Maestro delle cabalette“ erhielt), zusammengeschustert in jeder Art von Handlung, ernsthaft, halbernst und komisch. Und diejenigen, welche nach 1839 komponiert wurden, als er sich selbst an die Hand nahm, seine Orchestrierung und seinen Ruf für Leichtfertigkeit überdachte und mit einer ganzen Reihe solide geplanter Werke zurückschlug, deren Ehrgeiz und Bandbreite nur von Verdi übertroffen werden. Ein schelmischer, aufreizender Mensch, zu leichtsinnig für sein eigenes Wohl, schockierte er alle mit seinen Liebesbeziehungen (mit Pauline Bonaparte, die doppelt so alt war wie er) und monopolisierte das Repertoire überall in Italien, indem er schneller als jeder andere komponierte, mit mehr Schwung und nicht wenig Gespür, sich Aufträge schnappte und Rivalen so sehr verdrängte, dass er sich den Respekt von Rossini und Donizetti und den unsterblichen Neid und die Verachtung von Bellini und Berlioz verschaffte. Geboren und aufgewachsen im Theater, begründete er 1813 im Alter von siebzehn Jahren seine Karriere und blickte niemals zurück, fast jede Stunde des Tages bis zu seinem Tode im Jahre 1867 komponierend verbringend.

Giovanni Pacini/ OB
Wie Rossini konnte er eine lange Liste vertonen, mit dem Ergebnis, dass er zurückging bis Zeno und Metastasio, mit Handlungen „so alt wie Noah“, darunter Cesare in Egitto (1821) oder Temistocle (1823) und Alessandro nell’Indie ( 1824). Er versuchte sich an einem Proto-Lucia-artigen, von Scott inspirierten Vallace (1820), nahm Bellinis berühmte Norma zehn Jahre früher mit seiner La sacerdotessa d’Irminsul (ebenfalls 1820) vorweg und schlug Donizetti mit seinem aufrührerischen Il falegname di Livonia (1819), der 47 Abende an der Mailänder Scala lief. Zwei Bühnenspektakel legten den Grundstein für seinen reifen Ruf, L’ultimo giorno di Pompei (1825), der nicht mit einem rasanten Arienfinale, sondern mit einem erschreckend realistischen Ausbruch des Vesuvs endete; und Gli arabi nelle Gallie (1827) mit ihrem stereoskopischen Panorama von bande, Trompeten hinter den Kulissen, aufeinander zu marschierenden Chören und anderen gewaltigen Gerätschaften. Beide wurden international gespielt und wurden in eine Vielzahl unwiderstehlicher Partituren eingebettet: Amazilia (1825), komponiert für Fodor-Mainvielle, Giovanni David und Lablache; Niobe (1826) für Pasta und Rubini, I cavalieri di Valenza (1828) für Méric-Lalande und Carolina Ungher, sogar eine vorverdianische Giovanna d’Arco (1830) mit der glänzenden Besetzung von Méric-Lalande, Rubini und Tamburini, alle wunderbar bei Stimme. Er war in der Opernszene unablässig präsent, hyperaktiv, schrieb für jedes große Theater Italiens, komponierte seine nächsten Oper in Intervallen zu den gerade gespielten, heiratete dreimal, hatte neun Kinder und komponierte nicht weniger als hundert Bühnenwerke (was er zumindest behauptete) und für alle großen Sänger: für Malibran, Camporesi, Mariani, Pisaroni, Maffei-Festa, für Velluti, Nicola Taccinardi, Donzelli – und später für Tadolini, Frezzolini, Barbieri-Nini , Delagrange, De Giuli-Borsi, Ronconi, Fraschini und Varesi, unter vielen anderen. Mario, Jenny Lind und Wilhelmine Shroeder Devrient fanden in ihren Konzerten einen Platz für ihn.

Pacinis „Medea“: Figurinen zur Uraufführung/ Ricordi
Er liebte Sänger und passte seine Musik an deren Bedürfnisse an, schrieb für sie, wenn nötig, ganze Partituren um (für Gli arabi nelle Gallie lieferte er nicht weniger als neunzehn zusätzliche Arien). Seine zweite Karriere begann mehr oder weniger mit Saffo (1840), welche zum Triumph seines Lebens wurde. Mit seinem überstürzten Melodienrausch, seiner verrückten Fantasie, seiner leidenschaftlichen Virtuosität und seiner Vorliebe für Innovationen erfüllte er stets die Erwartungen des Publikums. Zwei Jahrzehnte lang hielt er seinen Platz in einer zunehmend von Verdi dominierten Ära, mit bitterem Ausgang, als der kommerzielle Wettbewerb eine Fermate in seiner Opernflut erzwang und das Angebot an großen Sängern versiegte.
Medea ist eine Oper seiner zweiten schöpferischen Phase. Für eine Inszenierung am Teatro Carolino von Palermo am 28. November 1843 komponiert, hatte er sich dezidiert für ein althergebrachtes Thema entschieden, um die Kontinuität seiner Muse und seine Erneuerungsfähigkeit zu betonen. Mit Geltrude Bortolotti als Medea, Luigi Valli als Creonte und Giovanni Pancani als Giascone machte die Oper die erhoffte Furore. Tatsächlich hatte er sich ungewöhnliche Mühe gegeben, obwohl er gleichzeitig zwei Opern schrieb (die andere war Luisetta o La cantatrice del molo, die am 13. Dezember 1843 in Neapel glücklich inszeniert wurde). Es ist klar, dass er sich immens bemüht hat. „Guai se conoscesse la musica!“ hatte Rossini von Pacini „nessuno potrebbe resistergli“ gesagt, und wie als Antwort darauf wird Medea so stark wie möglich besetzt mit dynamischen Markierungen aller Art, Spitzkehren und Bögen; nichts wird dem Zufall überlassen, interpretative Angaben finden sich in fast jedem Takt, jede gesangliche und instrumentale Nuance ist vollständig detailliert.

Pacinis „Medea“: die bislang einzige Aufnahme, Savona 1993 Savona, vergriffen
Es gibt sogar eine allgemeine Tonartstruktur, die er überraschenderweise während der unglaublichen Neufassung, der seine erfolgreiche Oper unterzogen wurde, aufrecht erhalten wollte, noch bevor der Applaus in seinen Ohren aufgehört hatte. Fast jedes Element der Originalpartitur wurde in späteren Inszenierungen ersetzt, mehrere Schlüsselstücke mehr als einmal. Cassandra, die in der ersten Fassung eine Arie hatte, verlor sie fast augenblicklich; das Preludio wurde alsbald zu einer vollwertigen Sinfonia, und sogar die beiden großartige Duette, die den Kern der Handlung bilden, wurden anschließend bis zur Unkenntlichkeit überarbeitet. Die Oper wurde für eine Wiederaufnahme in Vicenza am 22. Jänner 1845 umgeschrieben, erneut für Turin am 20. August 1845 und noch einmal für Florenz am 12. Juni 1850, um dann eine letzte glanzvolle Neuinszenierung in Neapel zu erfahren, drei Jahre später.

Pacinis „Medea“: Adelaide Cortesi war einer der ganz großen Primadonnen der Zeit, die mit Pacis Oper einen gigantischen Erfolg hatte; sie brachte sogar die Oper 1860 nach New York, „(1860 …) And tickets to see the famed soprano Madame Adelaide Cortesi portray the title role in Giovanni Pacini’s “splendid tragic opera Medea” at Niblo’s Garden ranged from two bits for a ticket in ‘Family Circle’ to $10 for an exclusive private box. The first performance was promised for the evening of Thursday, September 27 at eight o’clock, with a “farewell performance” at the one o’clock matinee on the following Saturday.
The Niblo’s production of „Medea“ by Madame Cortesi’s Italian opera troupe was the United States premiere of Pacini’s opera. (…)
Over the previous year, Cortesi had taken the opera scene in New York by storm; she was a versatile singer and actress, first reported in New York papers to be a mezzo-soprano. (…) Daughter of a choreographer and sister to an opera composer. She debuted in 1847 at La Scala in the title role in Donizetti’s Gemma di Vergy, rising to prominence as the lead soprano of that house.She became known for such roles as Norma, Lucrezia Borgia, Poliuto, and Il Trovatore. She sang all over the world, creating a furor wherever Italian opera was popular, though in London and Paris she was not as successful. She was especially liked in Havana, Mexico City, and South America; indeed, it was glowing reports from such far-flung locales that led to her first engagement to sing in New York.
Cortesi was also no stranger to the music of Pacini, for she not only sang Saffo and Medea frequently, but also created the title role in his lurid gothic melodrama „Malvina di Scozia“ in 1851. Her New York debut was, in fact, as Saffo at the Academy of Music. She drove her audience wild, and is said to have had to wade through flowers to reach the footlights when taking her curtain call at the end of that performance. The announcement of Medea on the September 27 New York Herald’s front page trumpeted Cortesi’s previous triumphs in Pacini’s “grandest tragic opera”, in which she had, we are told, “invariably created so startling a sensation”. (Quelle: La Strega)
Pacinis Medea steht in nichts Cherubinis berühmter Meédée (1797) oder Mayrs Medea in Corinto (1813) mit ihrem neoklassischen Libretto von Romani nach. Fast jeder Fetzen antiker Würde wurde abgelegt und sie ist zu einer für das melodramma romantico typischen arcivittima geworden; gewiss wütend, rachsüchtig und einschüchternd, aber auch voller tödlicher Schwäche. Es gibt keine Zauberei, sie ist einfach eine ausrangierte Frau, ohne Liebhaber und Kinder, für die der Komponist Mitgefühl empfindet. Der übergroßzügige, verschwenderische Pacini findet etwas Neues über sie zu sagen und vertritt ihre Sache mit jeder gewitzten melodischen Wendung, die ihm zur Verfügung steht. In Medea zeigt Pacini den mit Donizetti geteilten Einfallsreichtum, Konventionen für ihn arbeiten zu lassen. Auf diese Weise nutzt er den traditionellen Tempo- und Stimmungswechsel zwischen Arie und Cabaletta aus, indem er diesen letzten schizophrenen Trieb seiner dämonischen Heldin ausnutzt. In ihren ruhigeren Momenten ist sie eine liebevolle Mutter und Frau mit gebrochenem Herzen, aber wenn sie von gefühlloser Wut verzehrt wird, bricht sie in eine leidenschaftliche Stretta oder Cabaletta mit pochendem Rhythmus und angeschwollener Fioritur aus. Diese brillanten Stücke sind nicht nur allein um des Effekts willen erdacht und haben den Anspruch, verdianischer als Verdi selbst zu sein. Natürlich ruft das moderne Publikum mit frischem Verdi in den Ohren „Verdi!“ aus, wenn es Medeas Cabaletta im ersten Akt hört, aber dieser berühmte „Maestro delle cabalette“ brauchte keine Lektionen von anderen; die Beweise, die wir haben, ergibt eine umgekehrte Nachfolge. Verdi gab eine Kopie von Medeas cavatina d’entrata in Auftrag und verwahrte sie in seinem Archiv (die Kopie befindet sich heute in der Bibliothek des Conservatorio Padua). Wer was und wann in der Oper des 19. Jahrhunderts initiierte, ist noch immer ein Buch mit verschlossenem Siegel
Die ganze Partitur, vor allem die Orchestrierung, ist leicht französifiziert. In den 1840er Jahren richteten italienische Komponisten, einschließlich Verdi, ihren Blick auf Frankreich. Aber die zu hörende Fassung von Medea ist weitgehend die der letzten Ausgabe, welche am 26. Februar 1853 am Teatro San Carlo in Neapel mit Carolina Alaimo in der Titelrolle gegeben wurde. Darin wurden die meisten Verfeinerungen für Vicenza und Turin sowie die bereits drei Jahre zuvor für Alaimo in Florenz vorgenommenen Verbesserungen zusammengefasst. Ebenfalls enthalten ist die große Arie für Giasone (welche diejenige für Cassandra ersetzt) zu Beginn des zweiten Aktes, die speziell für die heikle Stimme von Settimio Malvezzi – Verdis erstem Rodolfo (Luisa Miller) – komponiert wurde, der diese in Turin sang. Diese San-Carlo-Ausgabe hat zusammen mit der heutigen Aufführungsrealität bestimmte Kürzungen vor allem der Chöre, aber auch bezüglich der Instrumentierung untermauert. Die zwei bemerkenswerten bande sul palco, die Pacini zur Feier von Giasones unglückseliger Hochzeit eingefügt hat, wurden im Allgemeinen in die Orchestertextur aufgenommen (wodurch die Tatsache verschleiert wird, dass Medeas letzte Cabaletta zu Giasones Hochzeitsmusik gesungen wird). Auch das schallende Ritornell für diese letzte lyrische Szene ist etwas gedämpft. Pacini hat für das Instrumentalsolo ein Kornett vorgesehen, für das der helle Klang einer modernen Trompete unangenehm schrill ist. Vermutlich beabsichtigte er ein cornet-à-pistons gemäß seines französifizierten Geschmacks anderswo (aber es ist nicht unmöglich, dass er das traditionelle Kornett beabsichtigte, das von Komponisten im frühen 18. Jahrhundert verwendet wurde – man sollte Pacinis Liebe für das Althergebrachte nie unterschätzen; ein moderner Ersatz wären dann Klarinetten und Oboen im Unisono). Es sind die in die Länge gezogenen Duette, die das volle Ausmaß von Pacinis hyper-erfinderischer Vorstellungskraft zeigen.

Pacinis „Medea“: Figurinen zur Uraufführung/ Ricordi
Seit L’ultimo giorno di Pompei hat er mit langen, langen Duetten, fast generisch in ihrer Form, einen nahtlosen melodischen Umgang mit den Veränderungen seines Textes und ihren dramatischen Implikationen ausgenutzt. Diese sind voll von seinen eigenen bizarren Modulationen und Dissonanzen, improvisierte Kleinode, die kommen und gehen, manchmal zusammengehalten von der Skelettform eines rossinianischen gran duetto, aber häufiger sowohl in Stimmung als auch Inhalt wild abschweifend, trotz der abgedroschenen Stretta, die sie normalerweise abschließt. Hier wird das erste der Duette, die flammende Begegnung von Medea und Giasone, als Abschluss des ersten Aufzugs verwendet, eine echte Neuheit für die damalige Zeit. Und das zweite, das hektische Duett des zweiten Akts zwischen Medea und Creonte, ist der Höhepunkt des Terrors, der Angst und List, der Drohungen und der unzureichend unterdrückten Wut der Antiheldin, somit das absolute Herz der Partitur. Man beachte die Leichtigkeit von Pacinis ausdrucksstarkem Gesang, ebenso die beiden unheimlichen Pizzicato-Akkorde, denen er die beiden Schlüsselwörter, Medeas furor und Creontes duol, beifügt, beide im Gefolge von sieben wiederholten Stakkato-Noten von wunderbar tragischer Bedeutung.

Pacinis „Medea“: Jolanta Omilian und Sergio Panajia in Savona 1996/ Agora
Nur zwei Teile der Partitur scheinen Pacinis Umarbeitungsdrang entgangen zu sein: die gesamte Introduzione, einschließlich des Chors und der Cavatine „Voice di morte“, gesungen von Creonte (obwohl es einige Hinweise darauf gibt, dass sie ursprünglich für Cassandra bestimmt war), mit ihrer schnippische Cabaletta, die der Komponist anscheinend schon seit der Erstaufführung in Palermo intakt hielt, und das trendige concertato, welches den zweiten Akt beschließt, wo Medea beinahe die korinthischen Frauen auf ihre Seite zieht. Der zynische Pacini zeigt hier wie auch in ihrer köstlichen vorletzten Äußerung „Ah dolci! … Nel seno“, wie sehr seine Schwäche für die unheilvolle Prinzessin seine Leidenschaft für Brillanz versüßen konnte.

Mehr von Pacini gibt es bei Opera Rara mit dieser Zusammenstellung aus seinen Opern; und natürlich ist die „Medea“ nicht die einzige dokumentierte Pacini-Oper: Sammler haben „Amazilia“, „Carlo di Borgogna“/Opera Rara, „Il Corsaro“, „“Don Giovanni“, „Edipo re“, „Malvina di Scozia“, „Maria Regina Inghilterra“/Opera Rara, „Maria Stuarda“/ Opera Rara, „Maria Tudor“, „Saffo“/Naxos u. a., „L´ultimo giorno die Pompei“/ Dynamic und weitere
Sie war beinahe die letzte seiner klassischen Heldinnen (Merope von 1846 war die allerletzte). Mit Medea gab er praktisch die mythischen Wesen auf, mit denen er sich früher einen Namen gemacht hatte, und mit ihr auch die überlebensgroßen Gesten und überdimensionalen Emotionen, die das melodramma romantico zu solchen Höhen des Blutvergießens und der Extravaganz geführt hatten. Von nun an widmete er sich trotz der malerischen Natur einiger seiner Handlungen il vero.
Hat er die Cabaletta aufgegeben? Nein, nicht wirklich. Eine kompositorische Eigenart, die ihn in den Schatten stellte, als das späte 19. Jahrhundert solche Künstlichkeit des goldenen Zeitalters des Gesangs verachtete (eine Verachtung, die Verdi nicht teilte – wenn man ihn beim Wort nehmen will). Aber was seine Rivalen verärgerte, ist in Wirklichkeit seine Rettung. Alle seine Opern enthalten einiges an ausgezeichneter Musik, lebendige Ideen, plötzliche Aufwallungen von Originalität, in denen die populistischen, extravertierten, holterdiepolter Cabalettas – das schiere Allheilmittel der Stimmdarstellung – der Schlüssel zum Herzen dieses großartigen Melodisten sind, dessen Opernstrom von 1813 bis 1867 das Zeitalter Rossinis mit seinen Verismo-Erben verbindet. Mit oder ohne Unterstützung von Bellini, Donizetti, Verdi et al. Alexander Weatherson
.
.
In Hildesheim hat die Ausstatterin Anna Siegrot für alle drei Medea-Produktionen ein Stahlgerüst bauen lassen, das in seiner Grundstruktur an ein Baugerüst erinnert. Zwei durchsichtige Plastikplanen sind angebracht, die wie Vorhänge auf- und zugezogen werden können. Die Kostüme charakterisieren die Akteure sinnfällig: So treten die Choristen in schwarzen Kostümen auf; warum sie zeitweise mit einer auf den Hinterkopf gesetzten Maske versehen sind, erschließt sich nicht ohne weiteres. Während die übrigen Korinther in kaltes Schwarz-Grau gekleidet sind, an das sich auch Giasone allmählich annähert, wurde die Außenseiterrolle Medeas durch feuerrote Haare und ein Kleid mit warmen Farben verdeutlicht.

Pacinis „Medea“ am TFN HIldesheim/Szene/© Tim Müller
Die serbische Regisseurin Beka Savić gab sich redlich Mühe, jeden Anflug von Stehoper zu vermeiden, was bei den gesangstechnisch höchst anspruchsvollen Partien nicht immer gelang. So ließ sie die Akteure die Treppen des Gerüstes herauf- und heruntergehen und die Vorhänge auf- und zuziehen, was oft reichlich krampfhaft wirkte. Manches in den Aktionen blieb rätselhaft: So wurde die stumme Rolle der Creusa (Neele Kramer) stark aufgewertet, indem sie immer wieder mit weitem, weißen Tüll-Rock auftauchte und sich auch als Cassandra verkleidete. Unklar war auch die eingefügte stumme Rolle des Lisimaco (Julian Rohde), der auf der Bühne wie ein Arrangeur der jeweiligen Szene herum wuselte. Schließlich war der Schluss reichlich merkwürdig: Die beiden Kinder (offenbar ca. halbjährige Zwillinge) erhielten aus einer großen Wasserschale, in das Calcante zuvor eine Flüssigkeit (Gift?) geträufelt hatte, eine Art Taufe. Anschließend fesselte Creusa die beiden kleinen Bündel mit einem schwarzen Strick, vielleicht, um sie in der Schale zu ertränken. Doch Medea verhinderte ihr Vorhaben, erdolchte sie und befreite die Kinder, die sie schließlich selbst in der Schale ertränkte.

Pacinis „Medea“ am TFN Hildesheim/Szene/© Tim Müller
In der besuchten Vorstellung, der zweiten nach der deutschen Erstaufführung in Hildesheim am 2. Oktober 2021, sorgte Florian Ziemen am Pult des in allen Gruppen tüchtigen Orchesters des TfN mit schwungvollem und zugleich präzisem Dirigat dafür, dass der typische Belcanto-Klang, der vielfach den frühen Werken Verdis ähnelt, mehr als nur angemessen zur Geltung kam. Die sängerische Bewältigung der alles andere als einfachen Partien der Oper ließ aufhorchen, gab es doch Leistungen von beachtlich hohem Niveau: Das gilt in erster Linie für die Robyn Allegra Parton, die die Titelpartie in ihrer Vielschichtigkeit (liebende Mutter und rachsüchtige Furie) glaubhaft verkörperte. Mit ihrem volltimbrierten Sopran beherrschte sie durchgehend die strapaziöse Partie; sie führte ihn sicher durch alle Lagen bis hin zu bombensicheren Höhen und begeisterte mit sauber gesungenen Intervallsprüngen, ausgeprägten Koloraturen, aber auch mit lyrischen Passagen, die sie mit feinem Legato präsentierte. Mit seinem apart timbrierten, kräftigen Tenor kam auch Yohan Kim als Giasone mit den belkantistischen Anforderungen seiner Partie gut zurecht. Auffällig war, dass er die Intervallsprünge ebenso wie die zurückgenommene Lyrik intonationsrein zur Geltung brachte. Die Rolle des Königs Creonte war Zachary Wilson anvertraut, der seinen markigen, abgerundeten Bariton überzeugend einsetzte und niemals forcierte, obwohl er im 1. Akt vom zeitweise zu starken Orchesterklang bedrängt wurde. Uwe Tobias Hieronimi (Calcante) und Steffi Fischer (Licisca) ergänzten. Der von Achim Falkenhausen einstudierte, wohl wegen der Pandemie auf vier Damen und sechs Herren reduzierte Chor klang weitgehend ausgewogen.
Mit starkem, lang anhaltendem Beifall dankte das begeisterte Publikum allen Mitwirkenden für die vor allem hörenswerte Aufführung. Gerhard Eckels (besuchte Vorstellung 09.10. 2021)
.
.
(Alexander Weathersons Artikel entnahmen wir mit freundlicher Genehmigung des Autors dem Beiheft zur Agora-Ausgabe der Oper im Mitschnitt aus Savona 1993/ Übersetzung Daniel Hauser. Foto oben Giovanni Pacini/ Wikipedia)
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.



















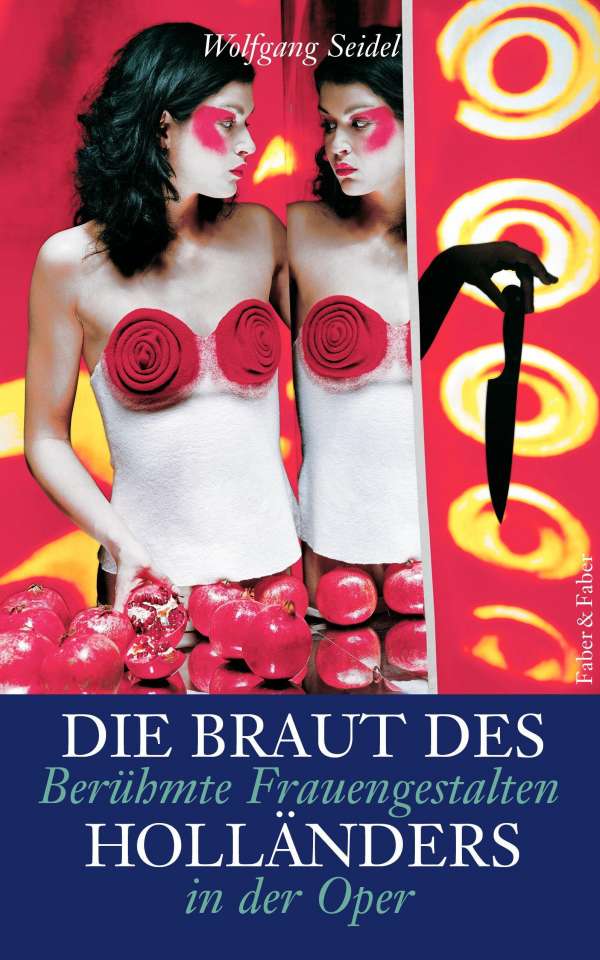

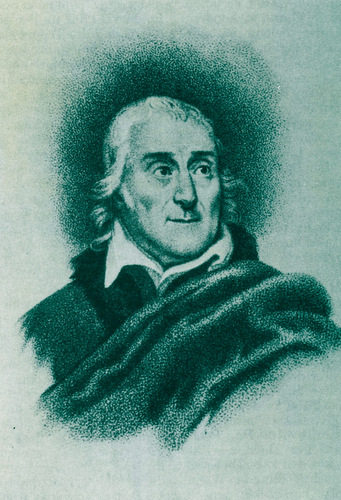


 Mit der Gräfin im
Mit der Gräfin im  Im Vergleich dazu hatte sie bei der Fiordiligi in
Im Vergleich dazu hatte sie bei der Fiordiligi in  Alle diese Erfolge überragt jener mit der Marschallin im
Alle diese Erfolge überragt jener mit der Marschallin im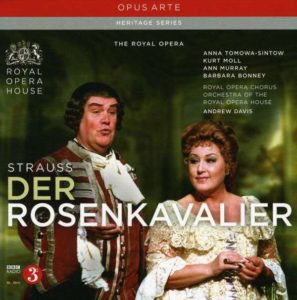 Nicht vergessen werden darf Tomowas sehr persönliche Interpretation der
Nicht vergessen werden darf Tomowas sehr persönliche Interpretation der 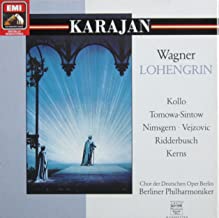 Einen mindestens ebenso breiten Raum wie das deutsche nahm das italienische Repertoire in der Arbeit der Sängerin ein. Den Beginn markierte, wie bereits erwähnt, die
Einen mindestens ebenso breiten Raum wie das deutsche nahm das italienische Repertoire in der Arbeit der Sängerin ein. Den Beginn markierte, wie bereits erwähnt, die 
 Die Fans der Sängerin bedauern noch heute, dass es nicht zu einer
Die Fans der Sängerin bedauern noch heute, dass es nicht zu einer  Zu ergänzen sind zwei
Zu ergänzen sind zwei

 Das Solistenquartett aus München ist pure (damalige) Starbesetzung. Wer könnte ein reicheres Timbre mitbringen als
Das Solistenquartett aus München ist pure (damalige) Starbesetzung. Wer könnte ein reicheres Timbre mitbringen als 

