.
Anna Gottlieb, die erste Pamina in der Zauberflöte, war bei der Uraufführung siebzehn. Eine neue Einspielung der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart folgt genau diesem Vorbild. In einem Auswahlverfahren wurde sie gefunden. Ihr Name: Ruth Williams. Sie stammt wie das von Martin Wåhlberg geleiteten Trondheimer Orkester Nord aus Norwegen. Den Chor stellt das Vokalensemble Vox Nidrosiensis, das auch mit Bach-Kantaten in Erscheinung getreten ist. Aufgenommen wurde in der katholischen Kirche Saint-Michel der mittelfranzösischen Gemeinde Pontaumur. Der Dirigent schließt damit eine der französischen Opéra-comique gewidmeten Aufnahmeserie mit seinem Ensemble ab. In deren Tradition sieht er auch die Zauberflöte. Deshalb wurde entschieden, den meist drastisch gekürzten Sprechtext des Librettos von Emanuel Schikaneder komplette einzuspielen. Figuren wie Sarastro treten dadurch deutlicher und auch zwiespältiger hervor. Wer mitlesen will, wird im Boooklet mehrsprachig fündig. An der bei Aparte erschienen Ausgabe (AP367) in Buchformat wurde nicht gespart wurde.
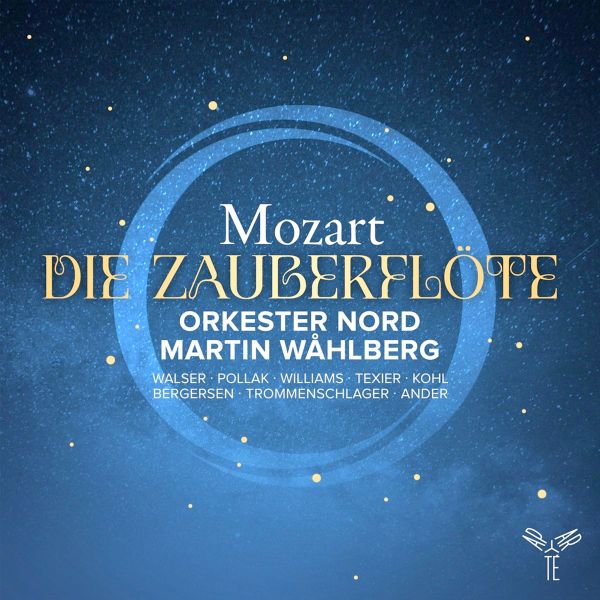 Im erklärenden Vorwort, das entgegen den Angaben auf der Rückseite des Covers nur in Englisch und Französisch abgedruckt ist, kommt der Dirigent selbst zu Wort. Nach seiner Überzeugung ergebe Mozarts Musik nur dann ihren vollen Sinn, wenn sie als Teil des gesamten dramatischen Gefüges erlebt werde, aus dem sie hervorgehe. Hinweise oder Anhaltspunkte für die aktuelle musikalische Umsetzung hätten sich in verschiedenen Quellen gefunden. Bei den Vorarbeiten sei man schließlich auch auf das Aufführungsmaterial gestoßen, das nach Einschätzung von Wåhlberg selten erforscht worden sei und in keiner der Urtext-Ausgaben Berücksichtigung gefundene habe. Es stamme aus dem Archiv des Theaters auf der Wieden, dem Uraufführungshaus und offenbare faszinierende Informationen. Es gebe Markierungen, Phrasierungs- und Bogenangaben, die die Partitur detailliert beschreiben würden und auch Hinweise darauf, wo Pausen, Pizzicato-Spiel und die Balance der Instrumente zu beachten seien, so der Dirigent.
Im erklärenden Vorwort, das entgegen den Angaben auf der Rückseite des Covers nur in Englisch und Französisch abgedruckt ist, kommt der Dirigent selbst zu Wort. Nach seiner Überzeugung ergebe Mozarts Musik nur dann ihren vollen Sinn, wenn sie als Teil des gesamten dramatischen Gefüges erlebt werde, aus dem sie hervorgehe. Hinweise oder Anhaltspunkte für die aktuelle musikalische Umsetzung hätten sich in verschiedenen Quellen gefunden. Bei den Vorarbeiten sei man schließlich auch auf das Aufführungsmaterial gestoßen, das nach Einschätzung von Wåhlberg selten erforscht worden sei und in keiner der Urtext-Ausgaben Berücksichtigung gefundene habe. Es stamme aus dem Archiv des Theaters auf der Wieden, dem Uraufführungshaus und offenbare faszinierende Informationen. Es gebe Markierungen, Phrasierungs- und Bogenangaben, die die Partitur detailliert beschreiben würden und auch Hinweise darauf, wo Pausen, Pizzicato-Spiel und die Balance der Instrumente zu beachten seien, so der Dirigent.
Bisher unveröffentlichte musikalische Fragmente wurden eingebaut. Am auffälligsten ist eine kurze Flötenfantasie während der Prüfung des Schweigens im zweiten Akt, die Tamino erfolgreich besteht (CD 2, Tr. 17). Im Ergebnis solcher Forschungen klingt in der an Verzierungen reichen neuen Aufnahme manches anders. Warum aber der ungenannt bleibende dritte Sklave, der seinen Peiniger Monostatos an den Galgen wünscht, schwäbelt, erklärt sich nicht. Es hört sich allerdings vergnüglich an, wenn er sagt: „Pamina, des reizende Mädl ischt enschprunge.“ Der Gag fällt umso mehr auf, als sich einige Solisten, mit ihren Dialogen in deutscher Sprache schwer tun. Wenn man sie denn vollständig bietet wie hier, hätte an der Aussprache gefeilt werden müssen. Das gilt allerdings nicht für den jetzt 36-jährigen schweizerischen Bariton Manuel Walser, der den Papageno gibt und auf dem Besetzungszettel des Booklets an erster Stelle erscheint. Diese ungewohnte Position – mag sie zufällig sein oder nicht – ist allemal durch Leistung unterfüttert. Gewandt in Wort und Musik zeichnet er ein in sich geschlossenes Porträt. Mit seinem einnehmendes Timbre und ist er von allen Mitwirkenden am besten zu verstehen. Für mich schafft der stimmlich und darstellerisch glänzend aufgelegte Walser gemeinsam mit dem Tamino von Angelo Pollak die gesanglichen Höhepunkte der Neuerscheinung. Bereits ihr erster gemeinsamer Auftritt gleich nach der Ouvertüre lässt erahnen, warum der Dirigent das Werk Mozarts in formaler Nähe zur Opéra-comique sieht. Pollak, der noch keine dreißig sein dürfte, schloss sein Masterstudium in Gesang erst 2019 ab. Zuvor war er an der Wiener Universität für Darstellende Kunst und Musik in ein Hochbegabten-Förderungsprogramm für Klavier und Violoncello aufgenommen worden. Gnädig hört man darüber hinweg, dass sich seine Stimme fast überschlägt, wenn er in jugendlicher Großspurigkeit dem zuvor nie gesehenen Sarastro mit geschwellter Brust entgegenschleudert: „Erzittre feiger Bösewicht.“
Dem folgenden Auftritt des Sprechers, der zu den ergreifenden Szenen der Oper zählt, weiß Eric Ander schlichte Würde zu verleihen. Der 32jährige Bastian Kohl dürfte einer der jüngsten, wenn nicht gar der jüngste Sarastro auf dem Musikmarkt sein. Er kommt nicht salbungsvoll daher, sondern mehr als Konkurrent von Tamino, der seine erotischen Begehrlichkeiten hinter priesterlichen Ritualen zu verberben weiß. Auch der in Mulhouse geborene Oliver Trommenschlager, der den Monostatos singt, befindet sich noch im Frühstadium seiner Karriere. Die Pamina von Ruth Williams, der für die Produktion ein Vocal-Coach zur Seite stand, hat es nicht leicht neben Kollegen, die bereits gut im Geschäft sind. Dennoch nötigt es Respekt ab, wie selbstbewusst sie die anspruchsvolle Aufgabe durchsteht.
Pauline Texier als Königin der Nacht folgt den hochdramatischen Erwartungen, die der gewaltige Donner bei ihrem ersten Erscheinen weckt, zunächst sehr verhalten, steigert sich aber im Verlauf ihrer ersten Arie immer mehr. International sind die drei Damen mit Julie Goussot, Natalie Perez und Alienor Feix besetzt, was man auch hört, weil sie in den Dialogen ihre eigenen Akzente einbringen und gelegentlich durch die gesprochenen Passagen radebrechen, was letztlich aber nicht sonderlich stört. Schließlich steht nirgendwo geschrieben, woher sie stammen. Auch der umtriebige Papageno, den sie mit Speis und Trank versorgen, weiß nicht, wer sie eigentlich sind. Ihm ist wichtig, dass er am Ende seine Papagena findet, die in Person von Solveig Bergersen stimmlich und darstellerisch vorzüglich zu ihm passt. Wie in fast jeder Einspielung der Zauberflöte wissen die drei Knaben Felix Hofbauer, Ludwig Meier-Meitinger und Benedikt Ebert für sich einzunehmen zu. Sie kommen aus dem Tölzer Knabenchor und agieren mit betont individuellen Stimmen und nicht als kollektives Neutrum. Der feierliche Gesang der beiden Geharnischten Kristoffer Emil Appel und Filip Eshetu Steinland gelingt ausgesprochen ergreifend.

Martin Wahlberg/Facebook
Überhaupt geht von der Aufnahme eine starke real-assoziative Wirkung aus. Da zwitschern Vögel, knarren Türen, läuten Glocken. Die virtuelle Bühne mit ihren eigenen Geräuschen ist allgegenwärtig. Martin Wåhlberg waltet an seinem Pult wie ein Musikregisseur, der die Zügel straff in seinen Händen hält, gleichzeitig aber den Eindruck zulässt, als sei manches dem Zufall überlassen und spontan aus der jeweiligen Situation geboren. Das gilt auch für die Tempi. Für das Publikum an den Lautsprechern kann die Aufnahme so zum reinsten Vergnügen werden, vorausgesetzt, es wird keine traditionelle Darbietung mit Stars der Opernbühne erwartet, die extra für eine Produktion anreisen. Vielleicht kommt ja Wåhlberg der Uraufführung von 1791 klanglich nahe. Auch, weil die meisten Solisten derselben noch jungen Generation angehören wie seinerzeit. Rüdiger Winter

