Mit der nunmehr dritten CD, MEYERBEER:vocal mit unbekannten Liedern von Giacomo Meyerbeer bei dem Label Antes/ Bella Musica Edition, hat sich die Berliner Sopranistin Andrea Chudak (& Friends), in letzter Zeit auch hervorgetreten durch ihre eindrucksvolle CD mit rund 70 „Ave Maria“-Vertonungen, erneut enormen Verdienst um die Popularisierung des Komponisten erworben. Wie die vorangehenden CDs, die wir bei operalounge.de ebenso wie die „Ave Maria“-CD bereits ausführlich besprochen haben, ist auch diese neue wieder angefüllt mit vielem Unbekannten und Spannenden, das unserer Kenntnis des Komponisten neue Facetten hinzufügt. Zudem fällt die Veröffentlichung der wiederentdeckten Lieder mit der Gründung der Meyerbeer-Gesellschaft in Berlin zusammen, die dieser Tage durch den Vorsitzenden und Gründer Thomas Kliche bekanntgegeben wurde. Grund genug, Frau Chudak näher dazu zu befragen. Das tat René Brinkmann für uns. G. H.
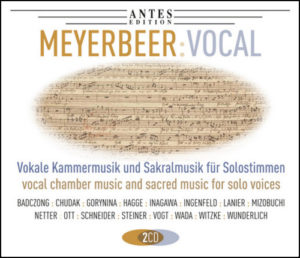 Sie gelten seit Jahren als ausgesprochene Fachfrau für die Musik Meyerbeers. Was begeistert Sie an der Musik dieses Komponisten? Oh, „Fachfrau für die Musik Meyerbeers“ ehrt mich sehr – tatsächlich würde ich mich selbst aber gar nicht so bezeichnen, denn die Kompositionen Meyerbeers sind so unglaublich vielseitig und vielfältig, dass ich mich gar trauen würde, so einen Titel tatsächlich anzunehmen. Das könnte ich als Einzelperson überhaupt nicht erfüllen…
Sie gelten seit Jahren als ausgesprochene Fachfrau für die Musik Meyerbeers. Was begeistert Sie an der Musik dieses Komponisten? Oh, „Fachfrau für die Musik Meyerbeers“ ehrt mich sehr – tatsächlich würde ich mich selbst aber gar nicht so bezeichnen, denn die Kompositionen Meyerbeers sind so unglaublich vielseitig und vielfältig, dass ich mich gar trauen würde, so einen Titel tatsächlich anzunehmen. Das könnte ich als Einzelperson überhaupt nicht erfüllen…
Was mich an seiner Musik so begeistert, ist dieser Ideen- und Farbenreichtum, genauso wie der Umgang mit den jeweiligen Sprachen, in denen er komponiert hat. Die Sprache färbt seine Musik und entführt einen jeweils in das andere Land. Außerdem mag ich seine in der Musik versteckten „kleinen Frechheiten“, die von einem ganz wunderbaren Humor zeugen, und ich mag seinen Sinn für Instrumente und dramatischen Ausdruck in den Stücken.
Ein Komponist, der Sängern hinterhergereist ist, um zu lernen, wie sie singen und was sie am besten können und dann speziell für sie so komponiert hat, dass sie ihre Stärken präsentieren konnten…Das ist doch traumhaft!

Und immer Meyerbeer: Andrea Chudak und Thomas Kliche, Begründer der neuen Meyerbeer-Gesellschaft/ Foto Alex Adler
Wie sind Sie mit der Musik Meyerbeers in Kontakt gekommen und wodurch wurde für Sie klar, dass die Beschäftigung mit Meyerbeer eine Lebensaufgabe werden würde? Natürlich kannte ich schon aus Studienzeiten die ein oder andere Meyerbeer-Opernarie, aber so richtig bin ich erst über Carl Maria von Weber zu Giacomo Meyerbeer gekommen. Ich hatte mich mit Liedern zur Gitarre von C.M. v. Weber beschäftigt und entdeckte dann die Freundschaft zu Meyerbeer. Die beiden hatten mit Joseph Abbé Vogler den gleichen Lehrer in Mannheim. Und die kleinen Anekdoten, die ich zuerst fand, machten mich sehr neugierig. Ich durfte dann 2013 Thomas Kliche, den Berliner Meyerbeerforscher, kennenlernen, der mich mit den ersten schwer zu findenden Notenmaterialien versorgte und mir für meine schnell auftauchenden Fragen gerne Rede und Antwort stand. Inzwischen habe ich 4 CDs mit Meyerbeers Musik herausgebracht, und auf jedem Album sind Weltersteinspielungen „verschollen“ geglaubter Stücke. Dadurch sind inzwischen über 40 davon in meinen Projekten wieder hörbar geworden.
Ich selbst bezeichne mich als eine sehr neugierige Künstlerin und da es bei Meyerbeer noch so viel zu entdecken und so viele Schätze zu heben gilt, vergrößert sich die Aufgabe ja quasi regelmäßig von ganz alleine. Alles, was ich dazu finde, macht mich noch neugieriger. Allerdings wird mir das als „Lebensaufgabe“ gerade erst durch Ihre Frage bewusst. Darüber hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.
Am 05. September fand in der Deutschen Oper der Gründungsakt für die Meyerbeer Gesellschaft e.V. statt. In der Folge ist viel über diese Gründung berichtet worden. Sie selbst sind Mitglied des Vorstands dieser neuen Gesellschaft und sind für die „Künstlerische Arbeit“ zuständig. Was kann man sich darunter vorstellen? Diese Gesellschaft formierte sich Ende des letzten Jahres durch das Engagement von Thomas Kliche.
Diesem Komponisten muss einfach dringend wieder zu seinem Recht verholfen werden und mit Hilfe dieser Gesellschaft und der gemeinsamen Anstrengung darin und dafür werden sich viele Irrtümer und Fehlinformationen zu diesem Komponisten hoffentlich endlich ausräumen lassen. Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich eine der ersten war, die mit von dieser Initiative erfuhr und bin ganz selbstverständlich gerne ein Teil der Giacomo-Meyerbeer-Gesellschaft e.V.
Ich darf in meiner Funktion dort den Kontakt zu künstlerisch Ausübenden herstellen und pflegen und auch musikalisch und programmatisch dort dem bekanntesten Komponisten des 19. Jahrhunderts unter die Arme greifen.

Konzert und Aufnahmen in Berlin zu „Meyerbeer:vocal“: Andrea Chudak, Tobias Hagge, Martin Netter, Irene Schneider/ Foto Alex Adler
Wie kam es zu der personellen Zusammensetzung des aktuellen Vorstands der Meyerbeer-Gesellschaft? Unter welchen Gesichtspunkten wurden die Mitglieder ausgewählt? Wir hatten im letzten Jahr eine Gründungs-Versammlung – coronabedingt via ZOOM –, zu der sich 21 Menschen ganz unterschiedlicher Bereiche versammelten. Darunter sind Lehrer, Studenten, Anwälte, Musikwissenschaftler, Musiker, Journalisten, Rentner, Konzert- und Operngänger u.v.m.; also eine wirklich „bunte Mischung“ von Menschen, die sich einsetzen möchten. Wir haben uns in dieser Gruppe alle miteinander bekannt gemacht und uns ausführlich berichtet, warum wir eine solche Gesellschaft wichtig finden, was die eigenen Gründe für das Beitreten dafür sind und wie wir zu Meyerbeer gefunden haben bzw. welche Kontakte es mit seinem Leben und Werk für uns bereits gab. So konnte man viele Informationen bekommen und die Vorstandsmitglieder wurden gemäß ihrer jeweiligen Stärken alle einstimmig gewählt.
Natürlich erfüllt es uns auch mit stolz, dass Dietmar Schwarz, der Intendant der Deutschen Oper Berlin, keine Sekunde zögerte und auf die Anfrage von Thomas Kliche sofort die Schirmherrschaft übernahm.
Unsere Giacomo-Meyerbeer-Gesellschaft e.V. soll jedem offen stehen, der sich interessiert und einsetzen möchte.

Andrea Chudak: Aufnahmen zu „Ave Maria“ 2019/ Foto Alex Adler
Was konkret ist vonseiten der Meyerbeer-Gesellschaft geplant, um das Œuvre Meyerbeers zu fördern? Wir haben viel vor und müssen doch erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Geplant sind neben Vorträgen, musikalischen Ereignissen wie eigene Konzerte oder Opernbesuche auch Vorträge und Stadtspaziergänge auf den Spuren Meyerbeers und seiner Familie. Nicht zu vergessen die Zugänglichmachung eines Archives, in dem auf Bücher, Schriften, Manuskripte, Notenmaterialien und Veröffentlichungen auch zu dem so großen Netzwerk Meyerbeers und der damals sehr blühenden Salonkultur Meyerbeerscher Familienmitglieder hingewiesen wird. Wir haben es ja auch mit einer Familie zu tun, die nicht nur im Bereich der Musik Großartiges geleistet hat sondern auch im Bereich der Literatur und der Astronomie.
Auch ein angemessenes Denkmal Giacomo Meyerbeers in Berlin, der von dieser Stadt viel zu stiefmütterlich behandelt wird, steht auf der „To-Do-Liste“.
Mein persönlicher Wunsch ist es auf jeden Fall, auch andere Musiker auf die „vergessenen“ Werke in der Sakral- und Kammermusik, der Festmusik, der Chorliteratur und der sinfonischen Werke hinzuweisen und ich würde mich sehr freuen, wenn sich viel mehr Sänger und Instrumentalisten mit dieser Musik beschäftigen würden.
Kann man sagen, dass das jüngste Album „MEYERBEER:vocal“, welches Sie zusammen mit bekannten Kolleginnen und Kollegen aufgenommen und bei Antes Edition veröffentlicht haben, eine Initialzündung für die Gründung der Meyerbeer-Gesellschaft gewesen ist? Nein, das hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Der gemeinsame Nenner, der beide Ereignisse auf den gleichen Tag bringt, ist schlichtweg Meyerbeers 230. Geburtstag, der sowohl der Gesellschaft als auch mir als Produzentin des Doppel-Albums „MEYERBEER: vocal“ ein wichtiges Datum war, um den Komponisten zu ehren.
Was natürlich eine schöne Beigabe ist, ist, dass sowohl bei der Gründungsveranstaltung als auch mit der Veröffentlichung der CDs neue Meyerbeer-Interessierte und -Fans gewonnen werden konnten.

Andrea Chudak & Friends; „Meyerbeer:vocal“/ Foto Alex Adler
Wie kam es zu der Werkauswahl, die ja nicht nur überraschend divers ist, sondern vor allem auch ausgesprochene Raritäten zum ersten Mal überhaupt zu Gehör bringt? Inmitten des Corona-Lockdowns reifte in mir die Idee dieses neuen Meyerbeerprojektes. Überlegungen gab es zwar schon davor, aber ich konnte für so ein neues und risikoreiches Unterfangen bislang nicht genug Mut aufbringen. Im Oktober 2020 fasst ich dann aber den Entschluss und fing an, mich mit Meyerbeerforschenden weltweit auszutauschen und bekam dabei so viele schöne Erkenntnisse, Gedankenanstöße und gefundene Notenmanuskripte zu den bei mir schon über die Jahre vorher gesammelten Materialien, dass aus einer einfachen CD sogar eine Doppel-CD wurde. Ich bin so unglaublich dankbar für diesen reichen Schatz, der mir neben Thomas Kliche (Berlin) auch von Prof. David Faiman (Israel) und Prof. Robert Letellier (England) u.a. geschenkt wurde. Nicht zu vergessen: die wichtigen Hilfestellungen, die ich von Prof. Dr. Sabine Henze-Döhring, Prof. Dr. Sieghart Döhring und Michael Pauser bekam. Die Noten wurden von mehreren Leuten in Deutschland und den USA aufbereitet, sodass sie für uns nutzbar wurden.
Und ich bin mehr als glücklich, dass mir 15 Musiker vertraut haben und mit mir diese Musik wieder zum Leben erweckt haben: Werke, die über 200 Jahre im Dornröschenschlaf lagen und nun endlich wieder Gehör finden.
Alles vokale Kammermusik bzw. Sakralmusik für Solostimmen: 22 Weltersteinspielungen, 11 Ersteinspielungen in der Originalbesetzung und 2 Ersteinspielungen in der Originalsprache. Ich bin wirklich stolz auf das, was da von allen Seiten durch Recherche und Beschäftigung in dieses Projekt floss und nun veröffentlicht werden konnte.
Der Werkkatalog Meyerbeers scheint unerschöpflich zu sein, ständig scheinen neue Werke aufzutauchen. Gibt es denn wenigstens eine Ahnung, wie viele Werke Meyerbeer in seinem Leben komponiert hat? Wir haben sogar in der Arbeit an dem aktuellen CD-Projekt wieder neue Werke finden können. Wie viele es noch genau gibt, kann ich gar nicht sagen. Klar ist aber, dass in Meyerbeers Tagebüchern noch mindestens 15 Lieder erwähnt sind, die noch nicht wieder gefunden wurden. Aber es tauchen ja auch immer wieder noch Stücke auf, von denen in den Tagebüchern und Briefen nichts zu lesen ist. Meyerbeer hatte offenbar einen endlos scheinenden Einfallsreichtum – was mich natürlich sehr freut, denn ich kann davon gar nicht genug bekommen! Und bei jedem Stück entdecke ich neue Facetten des Meisters.
Meyerbeer gilt vor allem als einer der einflussreichsten Opernkomponisten seiner Zeit und war der große Star der französischen Grand Opéra. Wie kam es eigentlich dazu, dass aus dem Berliner Jakob Meyer Beer der große Opernstar in Frankreich wurde? Er war ja nicht nur der große Opernstar in Frankreich – er war es ja auch in Deutschland, Italien usw.
Ein wirklicher Europäer mit einem sehr offenen Geist, der in all den Ländern mit seiner Musik größte Erfolge feierte und mit seinen Werken den Opernhäusern ausverkaufte Plätze garantierte. Die Uraufführung der Oper Il crociato in Egitto in Venedig verschaffte ihm nationale und internationale Anerkennung, er war Preußischer Generalmusikdirektor und Begründer der Gattung Grand Opéra. Er war Star in ganz Europa, dessen Musik und dessen Neuerungen nicht nur den Zeitgeist trafen sondern auch für ein wahnsinnig gut beherrschtes Handwerk sprechen, mit dem er meisterhaft umgehen konnte. In Berlin ließ er mithilfe der Gasbeleuchtung auf der Bühne die Sonne aufgehen, in Paris brachte er den Glaubenskrieg als politisches Thema auf die Bühne…er ging überall Wagnisse ein und spiegelte dabei auch sein Publikum.

Giacomo Meyerbeer: sein Grabmal auf dem Jüdischen Friedhof Berlin/ Foto Wikipedia
Denken Sie, dass Meyerbeers Popularität im Opernfach dazu beigetragen hat, dass seine Beiträge zu anderen Genres heute praktisch vergessen sind? Oder hat das ganz andere Gründe? Nein, ganz und gar nicht! Seine Lieder, Kantaten, Kammermusiken…all diese Werke brachten den damaligen Verlagen beim Druck satte Einnahmen. Meyerbeer verkaufte sich überall gut. Dass diese Beiträge heute so vergessen sind, ist glaube ich eine Mischung aus der Tatsache, dass nicht nur Robert Schumann, Hugo Wolf und Richard Wagner ihren Teil dazu beigetragen haben, dass sich bestimmte bösartige Sätze einfach im allgemeinen menschlichen Gedächtnis festgesetzt haben und dann später die Werke des Juden Meyerbeer in der Nazizeit verbrannt und vernichtet wurden sondern auch das heutige Bild von Meyerbeer darin gefördert wird, dass er fast ausschließlich als Opernkomponist wahrgenommen wird. Das ist vielleicht noch eine wichtige Aufgabe für die Musikwissenschaft.
Sie scheinen im Rahmen Ihrer Karriere eine Vorliebe für selten aufgeführtes Repertoire zu haben. Neben Meyerbeer haben Sie sich in den letzten Jahren auf Alben vor allen Operetten-Raritäten von Johann Strauß gewidmet sowie Ihrem aufsehenerregenden „Ave Maria“-Projekt, bei dem Sie auf fünf CDs 68 „Ave Maria“-Vertonungen aus sieben Epochen eingesungen haben. Ich finde das bewundernswert, aber haben Sie da nicht die Befürchtung, dass man irgendwann von Veranstaltern als „Raritäten-Sängerin“ abgestempelt wird? Die Befürchtung als Raritätensängerin zu gelten, habe ich nicht. Ich bin einfach neugierig und ich finde es wichtig, als Sängerin…ja als ausübende Künstlerin…im Dienst der Komponisten zu stehen. Nur wenn Werke erklingen, ist es Musik. Und dabei möchte ich mich gar nicht festlegen auf nur Romantik, nur Klassik, nur Neue Musik, nur Barock… Ich finde ja auch, dass sich das alles gegenseitig befruchtet. Genauso wie ich finde, dass es z.B. keine Unterscheidung zwischen Lied- und Opernsängern geben darf: die Komponisten schrieben ja auch nicht getrennt. Das gehört alles zusammen und braucht einander. Und es ist auch wichtig, Risiken – selbstverständlich auch im Repertoire – einzugehen. Kunst und Musik ohne Risiko ist ja nur halbherzig.
Welche Veranstaltungen und Aktivitäten plant die Meyerbeer-Gesellschaft in der nächsten Zeit und wie kann man sich als interessierter Meyerbeer-Musikliebhaber daran beteiligen? Wir stehen wirklich jedem offen. Unter der Webseite: www.meyerbeer-gesellschaft.de kann man auch Auskunft zu den geplanten Aktivitäten finden. Auch diese Seite ist wie wir selbst im Aufbau und wird ständig erweitert. Dort kann man übrigens auch den Antrag auf Mitgliedschaft finden…
Die nächste Aktivität ist ein Stadtspaziergang in Berlin auf Meyerbeers Spuren. Konzerte und Lesungen folgen. Und wir haben dort auch schon mal eine kleine Zusammenfassung für alle Meyerbeer-Neulinge erstellt, sodass man einen Eindruck bekommen kann, wie viele Themen die Beschäftigung mit Giacomo Meyerbeer so auftut.
Welche Aktivitäten planen Sie in der kommenden Zeit, wo kann man Sie z.B. auf der Bühne hören, soweit das unter den bestehenden Corona-Regularien schon wieder möglich ist? Da gibt es gerade eine ganz große Bandbreite: ich singe bei der Eröffnung des Greizer Theaterherbstes gemeinsam mit der Vogtland Philharmonie, darf mich im sächsischen Langenbernsdorf als Lieschen in der „Kaffeekantate“ präsentieren, werde Musik des Berliner Komponisten Max Doehlemann in Bingen uraufführen, bin in barocken Gewändern bei den Berliner Residenz Konzerten mit virtuosen Barockarien zu erleben, darf den Solopart in Beethovens 9. Sinfonie übernehmen und habe natürlich schon wieder die nächsten Notenfunde auf meinem Schreibtisch, die in Musik umgesetzt werden wollen. Und ja…ich arbeite an weiteren Konzertterminen mit Musik von Giacomo Meyerbeer.
(Wer mag, kann sich über diese Aktivitäten auch gerne auf meiner Webseite: www.sopranissimo.de erkundigen.) Das Interview führte René Brinkmann
Giacomo Meyerbeer (1791-1864): Vokale Kammermusik & Sakralmusik für Solostimmen
mit Andrea Chudak, Dorothe Ingenfeld, Tobias Hagge, Yuri Mizobuchi, Martin Netter, Irene Schneider, Matthias Badczong, Ekaterina Gorynina, Polly Ott, Oliver Vogt, Oliver Wunderlich; Programm: Fuga (Psalm 24); 6 Canzonette; 6 Ariette italiane; Hymne an Gott; La Mere grand; La Luna in ciel risplende gla; Kindergebet; 2 Religiöse Gedichte; 7 Geistliche Gesänge; Der Wanderer an die Geister an Beethovens Grabe; An den Neugeborenen; Le Ranz des Vaches d’Appenzell; Dominus vobiscum; La Lavandiere; Des Schäfers Lied; Des Dichters Wahlspruch; Neben dir; Mirza-Schaffy an Suleika; O sähst du die Holde; Uv’nucho yomar; 2 CD Antes/Bella Musica BM1490101








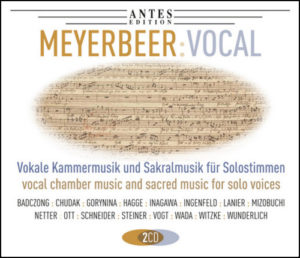 Sie gelten seit Jahren als ausgesprochene Fachfrau für die Musik Meyerbeers. Was begeistert Sie an der Musik dieses Komponisten?
Sie gelten seit Jahren als ausgesprochene Fachfrau für die Musik Meyerbeers. Was begeistert Sie an der Musik dieses Komponisten? 






 „Man hat nur ein einziges Leben.
„Man hat nur ein einziges Leben. „
„ Das galt sicher auch in Hinsicht auf ihre
Das galt sicher auch in Hinsicht auf ihre  Auch die großen Sopranrollen bei Richard Strauss (inklusive der Mezzo-Partie des Komponisten in „Ariadne auf Naxos“) sowie wichtige Partien aus dem slawischen Bereich, vor allem den Opern Tschaikowskys, zählten zum ausgedehnten Repertoire dieser außerordentlichen Singdarstellerin, die mit ihnen auch auf der Hörbühne der Schallplatte ausführlich dokumentiert ist. Auch mit einer Partie, die als „Reise in die Heimat“ verstanden werden kann und zugleich ihre stimmliche Bandbreite zeigt: die meist von Altistinnen und Mezzosopranen interpretierte Judit(h) in Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ (etwa in einer Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskau als Blaubart). Im vorliegenden CD-Konvolut aus Anlass ihres achtzigsten Geburtstags werden zudem einige ihrer Ausflüge ins Land der Raritäten dokumentiert, etwa zu
Auch die großen Sopranrollen bei Richard Strauss (inklusive der Mezzo-Partie des Komponisten in „Ariadne auf Naxos“) sowie wichtige Partien aus dem slawischen Bereich, vor allem den Opern Tschaikowskys, zählten zum ausgedehnten Repertoire dieser außerordentlichen Singdarstellerin, die mit ihnen auch auf der Hörbühne der Schallplatte ausführlich dokumentiert ist. Auch mit einer Partie, die als „Reise in die Heimat“ verstanden werden kann und zugleich ihre stimmliche Bandbreite zeigt: die meist von Altistinnen und Mezzosopranen interpretierte Judit(h) in Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ (etwa in einer Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskau als Blaubart). Im vorliegenden CD-Konvolut aus Anlass ihres achtzigsten Geburtstags werden zudem einige ihrer Ausflüge ins Land der Raritäten dokumentiert, etwa zu  Ab 1999/2000 wirkte sie als Professorin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, unterrichtete auch am Opernstudio der Staatsoper Unter den Linden. Seit 2012 ist sie zudem als Gastprofessorin an der Hochschule für Musik in Karlsruhe tätig. Als Lehrerin gab und gibt sie weiter, was ihr in ihrer aktiven Bühnenzeit, wie bereits erwähnt, selbstverständlich schien: Die völlige Beherrschung der Gesangstechnik als Voraussetzung für jede Art von Expression. Die Kunst des ausdrucksvollen Gesangs fängt ja ihrer Überzeugung nach bei der souveränen, nicht mehr von technischen Unwägbarkeiten beeinträchtigten Führung des vokalen Instruments an. Womit sie die Grundbedingungen klassischer Gesangskunst und technisch makellosen Singens anspricht, die auch ihre Stärken waren: Möglichst vollendetes Legato, bruchloses Messa di voce sowie eben größtmögliche stimmliche Biegsamkeit.
Ab 1999/2000 wirkte sie als Professorin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, unterrichtete auch am Opernstudio der Staatsoper Unter den Linden. Seit 2012 ist sie zudem als Gastprofessorin an der Hochschule für Musik in Karlsruhe tätig. Als Lehrerin gab und gibt sie weiter, was ihr in ihrer aktiven Bühnenzeit, wie bereits erwähnt, selbstverständlich schien: Die völlige Beherrschung der Gesangstechnik als Voraussetzung für jede Art von Expression. Die Kunst des ausdrucksvollen Gesangs fängt ja ihrer Überzeugung nach bei der souveränen, nicht mehr von technischen Unwägbarkeiten beeinträchtigten Führung des vokalen Instruments an. Womit sie die Grundbedingungen klassischer Gesangskunst und technisch makellosen Singens anspricht, die auch ihre Stärken waren: Möglichst vollendetes Legato, bruchloses Messa di voce sowie eben größtmögliche stimmliche Biegsamkeit.

 Mit Lukas Cranachs Zeitgenossen und Kollegen Mathis
Mit Lukas Cranachs Zeitgenossen und Kollegen Mathis 

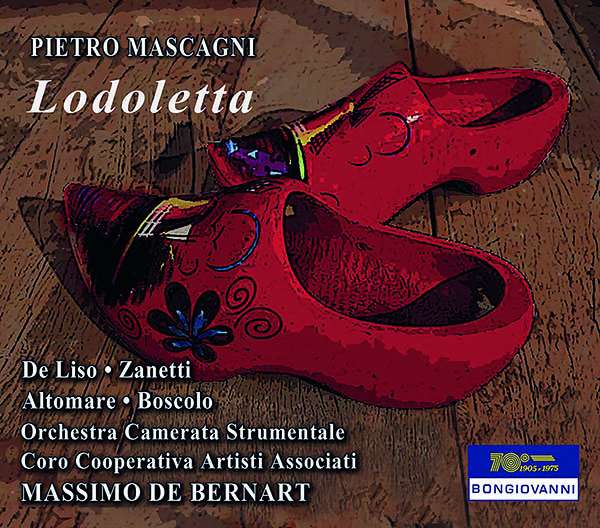


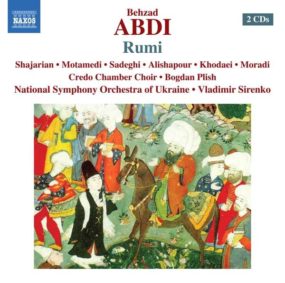 Der bezwingende Ton wiederholt sich in ihrer zweiten Begegnung, deren mystischer Zug durch den anschließenden rituellen Shema unterstrichen wird, der eine Element der spirituellen Trancetänze ist. In der letzten Szene schlagen Rumi und seine Anhänger, denen der Geist des tanzenden Shams erschienen war, die mongolischen Feinde durch ihren Tanz in die Flucht – „As if the weapon of these people against the enemy is the message of love of the God and their power looks fiercely for the enemy“ – und Rumi verkündet seine Botschaft „Let us gild this world of dirt with gold /Come! Let us be the early spring of Love!“. Abdi gelingen geradezu plastische theatralisch Szenen, bei den er auch auf seine Erfahrungen als Filmkomponist zurückgreifen kann, die auch naive Hörer unmittelbar anzusprechen vermögen.
Der bezwingende Ton wiederholt sich in ihrer zweiten Begegnung, deren mystischer Zug durch den anschließenden rituellen Shema unterstrichen wird, der eine Element der spirituellen Trancetänze ist. In der letzten Szene schlagen Rumi und seine Anhänger, denen der Geist des tanzenden Shams erschienen war, die mongolischen Feinde durch ihren Tanz in die Flucht – „As if the weapon of these people against the enemy is the message of love of the God and their power looks fiercely for the enemy“ – und Rumi verkündet seine Botschaft „Let us gild this world of dirt with gold /Come! Let us be the early spring of Love!“. Abdi gelingen geradezu plastische theatralisch Szenen, bei den er auch auf seine Erfahrungen als Filmkomponist zurückgreifen kann, die auch naive Hörer unmittelbar anzusprechen vermögen. Das gleiche Erfolgsrezept wendete Abdi auch bei seiner nächsten Oper
Das gleiche Erfolgsrezept wendete Abdi auch bei seiner nächsten Oper 