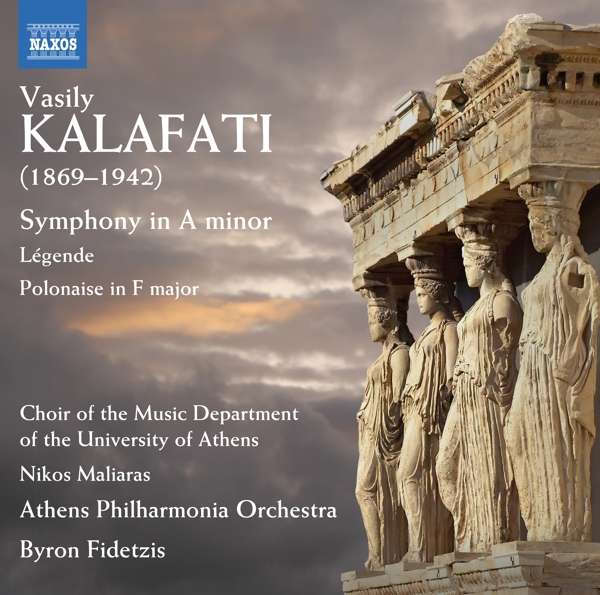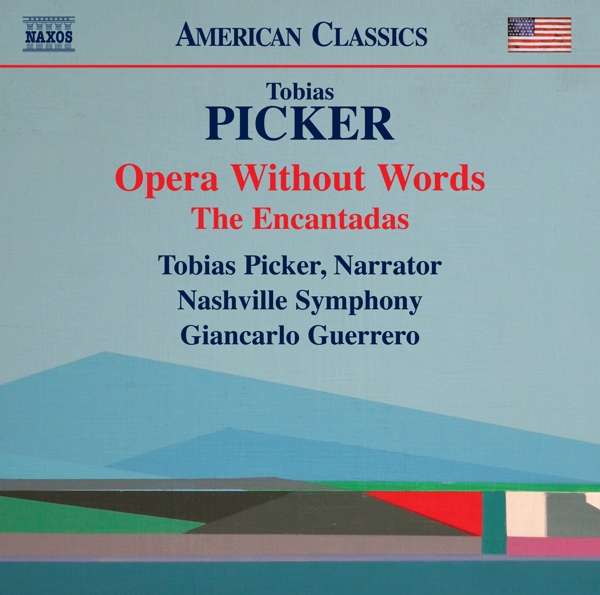26
Viele Gedanken hat sich Ermonela Jaho über ihre erste Recital-CD gemacht und sie in dem informationsreichen Booklet dazu auch zu Papier gebracht. Anima Rara nennt sich die CD und um Opera Rara, vielmehr opere rare kümmert sich seit langem das Label gleichen Namens. Der Hörer kann also einmal nicht eine Liste bekannter oder sogar allzu bekannter Arien erwarten, sondern darf sich mit den Opern auseinandersetzen, die der lyrische Sopran Rosina Storchio sang, zu einem großen Teil zur Uraufführung brachte. Die Toscanini nicht nur künstlerisch, sondern auch privat verbundene Sängerin war nicht nur für die Perfektion ihres Gesangs, sondern auch für ihre intensive Darstellungskunst berühmt, und auch die albanische Sängerin unserer Tage bekennt sich dazu, dem reinen Schöngesang abhold, dem Ganz-in-einer-Rolle-Aufgehen jedoch verpflichtet zu sein. Der Verismo, aus dem die meisten Titel stammen, bietet sich natürlich besonders dafür an, beeinflusst nicht nur die Optik, sondern natürlich auch, wie auf der CD zu hören, den akustischen Eindruck einer Darbietung (weiter nachstehend). Ingrid Wanja
 Wir fanden die Konzeption dieser neuen CD von Opera Rara ebenso wie Ingrid Wanja so bedeutend, dass wir hier den Artikel von Ditlev Rindom aus dem beiliegenden Booklet zur CD einschieben, der die Kunst der Rosina Storchio und ihre Wichtigkeit für die Komponisten der Zeit untersucht. Dankenswerter Weise hat uns Opera Rara und der Autor diesen Beitrag überlassen, den Daniel Hauser für uns aus dem Englischen übersetrzte und somit auch einer nicht unbedingt englischkundigen Leserschaft zugänglicht macht. Im Anschluss daran fährt Ingrid Wanja mit ihrer Rezension fort. G. H.
Wir fanden die Konzeption dieser neuen CD von Opera Rara ebenso wie Ingrid Wanja so bedeutend, dass wir hier den Artikel von Ditlev Rindom aus dem beiliegenden Booklet zur CD einschieben, der die Kunst der Rosina Storchio und ihre Wichtigkeit für die Komponisten der Zeit untersucht. Dankenswerter Weise hat uns Opera Rara und der Autor diesen Beitrag überlassen, den Daniel Hauser für uns aus dem Englischen übersetrzte und somit auch einer nicht unbedingt englischkundigen Leserschaft zugänglicht macht. Im Anschluss daran fährt Ingrid Wanja mit ihrer Rezension fort. G. H.
Ditlev Rindom: Die Kunst der Rosina Storchio „Und so will mich mein Schmetterling, mein leidenschaftlicher kleiner, verlassen?“, schrieb Giacomo Puccini in einem Brief an die Sopranistin Rosina Storchio kurz nach der Weltpremiere von Madama Butterfly im Jahre 1904. „Es scheint mir geradezu so, als würden Sie mit Ihrem Abgang den besten, den poetischsten Teil meiner Arbeit mit sich nehmen. Oder, um mich besser auszudrücken: Ich denke, dass Butterfly ohne Rosina Storchio ein Ding ohne Seele wird.“ Die Premiere im Mailänder Teatro alla Scala war für Puccini ein demütigender Misserfolg gewesen, aber seine Bewunderung für die Storchio war unerschütterlich. Selbst diejenigen Kritiker, die Madama Butterfly als uninspirierte Wiederholung der früheren Werke des Komponisten verurteilten, waren sich in einer Sache einig: Storchios exquisit musikalische Darstellung der Titelrolle war ein weiterer Triumph für die Sängerin.

Rosina Storchio und Edoardo Garbin in „Zaza“ Leoncavallos/ Künstlerpostkarte/ Ipernity (namentlich die Sammlung Bialystok-Stavenuiter ist auf dieser hochinteressanten website für historische Fotos bemerkenswert)
Die Storchio ist heutzutage vor allem aufgrund ihrer Verbindung zu Puccinis Werken bekannt, die sie während ihrer langen Karriere in Städten wie Madrid, Paris, Buenos Aires und New York aufführte und 1923 sogar als Butterfly in Barcelona ihren Abschied gab. Doch Puccini war bei weitem nicht der einzige, der Storchios Talente bewunderte. Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano und Pietro Mascagni suchten die Storchio für Weltpremieren ihrer Opern auf und ehrten sie mit den Eröffnungsabenden von La bohème (1897), Zazà (1900), Sibiria (1903) und Lodoletta (1917). Hochgeschätzte Dirigenten wie Arturo Toscanini, Cleofonte Campanini, Leopoldo Mugnone und Ettore Panizza zählten bei prestigeträchtigen Anlässen in Italien und im Ausland ebenfalls auf die Storchio, beeindruckt von ihrer hervorragenden Technik, ihrem nuancierten Schauspiel und ihrer Ausdruckskraft.
Die in Venedig geborene Storchio zeichnete sich schon in jungen Jahren durch ihr herausragendes Talent aus. Als Kind zog sie in die Lombardei und ließ sich am Mailänder Konservatorium ausbilden. Auch als Studentin erhielt sie das Lob der Mailänder Presse. „Sie hat ihr Studium noch nicht abgeschlossen“, bemerkte die Corriere della sera, „aber sie ist bereits ziemlich reif für die Herausforderungen der Bühne.“ Bald wurde ihr Arbeit an kleineren Theatern in Mailand angeboten; 1892 gab sie ihr professionelles Debüt als Micaëla in Bizets Carmen (1875) am Teatro dal Verme. In den ersten Jahren ihrer Karriere übernahm sie Rollen in mehreren inzwischen vergessenen Werken – darunter Filippo Brunettos La sagra di Valaperta (1895) und Dario de Rossis Fadette (1895) – und debütierte 1895 an der Scala als Sophie in Massenets Werther (1887). Es folgte rasch eine beeindruckende Auswahl an Partien, wobei zwei Weltpremieren für Leoncavallo neben Werken von Massenet, Mascagni, Puccini und Giordano ihren Zeitplan füllten.

Rosina Storchio sang die Uraufführung von Umberto Giordanos „Siberia“ 1903 an der Scala/ Foto Grandi Voci alla Scala/ Teatro alla Scala/ Ricordi
Zu Beginn des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts hatte sich die Storchio als Primadonna an der Scala etabliert, wo sie eine wichtige künstlerische Partnerschaft (sowie eine romantische Beziehung) mit dem Dirigenten Arturo Toscanini pflegte. Kritiker lobten immer wieder ihre Kommunikationskraft und Vielseitigkeit, was sie zur geborenen Kollaborateurin führender italienischer Komponisten machte. Die Premiere von Madama Butterfly sicherte ihren Platz in der Operngeschichte, aber Storchios Repertoire erweiterte sich weiter, als sie Tourneen an Opernhäuser in Spanien, Deutschland, Frankreich, Monaco und Südamerika unternahm. Die Storchio, vor allem als Manon, Violetta und Butterfly bekannt, sang schließlich neben ihren Verismo-Kreationen auch in Werken von Mozart, Rossini, Auber, Bellini, Donizetti, Meyerbeer, Gounod und Thomas sowie in Neuheiten wie Webers Euryanthe (1823) und Humperdincks Hänsel und Gretel (1893). Ihre dramatische Bandbreite erstreckte sich außerdem von der Susanna in Mozarts Le nozze di Figaro (1786) bis zur Maddalena in Giordanos Andrea Chénier (1896). Während ihre Stimme häufig als klein – wenn auch von überraschender Intensität – beschrieben wurde, ermöglichte ihr ihre unübertroffene Kombination aus Pathos und Charme, in einer Vielzahl von Rollen zu triumphieren, selbst als sie sich die zerbrechlicheren Verismo-Heldinnen unauslöschlich zu eigen gemacht hatte.
Aufgrund ihres Weltenbummler-Profils verstärkte die Karriere der Storchio in vielerlei Hinsicht vertraute Vorstellungen über diese Periode der Operngeschichte. Wie ihr gelegentlicher Bühnenpartner Enrico Caruso, war sie eine Sängerin, die im frühen 20. Jahrhundert die künstlerischen und finanziellen Möglichkeiten in Europa und Amerika nutzte, um etablierte Repertoire-Werke aufzuführen, nahezu ausschließlich in italienischer Sprache. Ab 1904 spielte Lateinamerika eine entscheidende Rolle in der Karriere der Storchio: Sie trat bis zu ihrem Rückzug von der Bühne in ganz Argentinien, Brasilien, Kuba, Venezuela, Peru und Uruguay auf. Eine kleine Anzahl kommerzieller Aufnahmen zeigt auch ihr Interesse daran, Interpretationen klassischer Arien während der frühen Jahren der Grammophon-Industrie zu bewahren.

Rosina Storchio als Madama Butterfly an der Scala 1904/ Foto Opera Rara
Die Zusammenarbeit der Storchio mit lebenden Komponisten ist aber auch eine Erinnerung an den anhaltenden Einfluss von Opernkünstlern auf neue Musikwerke zu einer Zeit, als immer weniger italienische Opern ins Repertoire aufgenommen wurden und der Opernkomponist anscheinend immer mehr Autorität über die Sänger hatte als zu Beginn des 19. Jahrhunderts. George du Mauriers Bestseller Trilby (1895) – ein Meilenstein, der in den ersten Jahren von Storchios Karriere veröffentlicht wurde – verdichtete in vielerlei Hinsicht Jahrzehnte negativer Stereotypen rund um Operndiven mit der Fabel, dass eine stimmlich begabte (aber passive) Sängerin von einem männlichen Svengali kontrolliert werde: Weibliche Kreativität hatte sich als Illusion herausgestellt. Storchios enge Beteiligung an Rollen wie Butterfly, Zazà und Lodoletta lässt jedoch auf ein ganz anderes Szenario schließen. Ohne die Storchio wären diese Partien möglicherweise erheblich anders gewesen oder hätten überhaupt nicht existiert.
Fast ein Jahrhundert nach ihrem Rückzug ist die Zeit reif für eine Neubewertung des einzigartigen Beitrags der Storchio zur Operngeschichte. Anstatt eine gehorsame musikalische Dienerin zu sein, war die Storchio eine wichtige kreative Vertreterin, die künstlerische Konventionen in Repertoire-Opern wie La traviata (1853) etablierte und sich für zeitgenössische Werke einsetzte. Ihre stimmliche Vielseitigkeit erinnert auch daran, wie sich die Kategorisierung von Sängern seit ihrer Zeit verschoben hat, als sich die Rollenkonventionen noch nicht verschärft hatten und die Unterscheidung zwischen lyrischen und dramatischen Rollen weniger klar war. Aufbauend auf der Wiederentdeckung von Leoncavallos Zazà durch Opera Rara in Zusammenarbeit mit der Sopranistin Ermonela Jaho, werden in diesem Recital weitere Kernaspekte von Storchios Repertoire untersucht, die von einer der überzeugendsten Operninterpretinen der Gegenwart umgesetzt werden. Die Wiederentdeckung der Kunst der Rosina Storchio ist eine Gelegenheit, in diese vergessene Musiklandschaft einzutauchen, in der neue italienische und französische Werke mit kreativen Neuinterpretationen der Vergangenheit koexistieren. Ditlev Rindom; Übersetzung: Daniel Hauser

Rosina Storchio: Ermonela Jaho und der Dirigent Andrea Battistoni bei der Aufnahme/ Foto Opera Rara
Und nun weiter die Rezension der Opera-Rara-CD Anima rara: Rosina Storchio war die erste Butterfly und zwar nicht nur die der Urfassung von 1904, die unter dem Hohngelächter des Publikums über die Bühne ging, sondern auch der auf drei Akte erweiterten und um eine Tenorarie bereicherten Uraufführung der zweiten und nunmehr allein gültigen Fassung. So bilden denn auch zwei Arien aus der Puccini-Oper den Rahmen für die Trackliste. In „Un bel di, vedremo“ lässt der Sopran hören, was er mit „only a naked soul can do this“ meint, nämlich das Publikum zum Weinen bringen, was ihm, glaubt man den Kritiken, gerade mit dieser Partie immer wieder gelingt. Man hört in dieser Arie aus dem zweiten Akt keine Mädchenstimme, sondern ein leidgetränktes Timbre, dem am Schluss, bei Abschied von dem Kind, der erotisch flimmernde Glanz abhanden gekommen ist. Dazu beeindrucken die wie aus dem Nichts herbei schwebenden Pianissimi, die unangestrengten, weich angesetzten Höhen.
Rosina Storchio hat viele Versimo-Opern aus der Taufe gehoben, so auch Leoncavallos La Bohéme, dessen Mimi sie 1897 war und aus der die Jaho sowohl eine Arie der Mimi wie eine der Musetta, die anders als bei Puccini im Mittelpunkt steht, singt. Als Mimi, die den Charakter der Freundin beschreibt, verleiht sie der Stimme selbst viel civetteria und viel fresco tintinnire, so dass man den Sopran kaum wiedererkennt. Als Musetta beweist sie, dass die beiden Figuren Leoncavallos einander sehr vielmehr ähneln als die Puccinis.
Rosina Storchio sang auch Mascagnis Iris, der sie in ihrer großen Arie im zweiten Akt unendlich viele Facetten vom fast nicht mehr hörbaren Flüstern bis zum angstvollen Ausbruch im Forte verleiht. Zwei weitere Opern Mascagnis sind mit L’amico Fritz und mit Lodoletta vertreten, die Storchio als Erste sang. Zauberhaft frisch klingt die Susel, als öffne sich die Stimme wie eine der besungenen Blüten, während der Schluss von Lodoletta den Stimmungswechsel eindrucksvoll zum Ausdruck bringt, die Stimme die Orchesterfarben annimmt und die Oper mit einem schönen Verlöschen des Gesangs enden lässt.
Nicht ganz unbekannt dem heutigen Opernpublikum, aber doch leider selten gespielt sind Boitos Mefistofele und Catalanis La Wally. „L’altra notte“ der Margherita besticht durch bruchlose Crescendi, durch das Durchschimmern des Wahnsinns durch die herzzerreißenden Töne, die besonders im so trost- wie farblosen „Pietà“ gipfeln. Eine zarte Ausgabe der Wally verabschiedet sich mit ihrem „Ebben? Né andrò lontana“. Ganz neu für das Publikum dürfte die Arie der Stephana aus Giordanos Siberia sein, in der einst La Storchio und nun la Jaho „fiori e amor“ erblühen ließ/lässt.
Das französische Repertoire ist mit Massenet, nicht nur mit seiner naiv und leicht parfümiert klingenden Manon, sondern auch doppelt mit seiner Sapho vertreten, die nichts mit der griechischen Poetin auf der Insel Lesbos zu tun hat. Feine Pianogespinste, ein kapriziöser Verführungsversuch und inniges Piano-Flehen machen den Anfang, später beweist ein raffiniertes Vorspiel zum 5. Akt, dass auch das Orquestra de la Comunitat Valenciana unter Andrea Battistoni mit diesem Repertoire vertraut ist.
Nur kurz kommt Verdi zu Wort und zwar bezeichnenderweise mit einem verismonahen Track, dem „Teneste la promessa“ mit anschließendem „Addio del passato“, so dass stilistisch kein Bruch entsteht, vor allem auch, weil man diese Arie selten so expressiv gehört hat. So lässt man sie sich selbst mit der Callas‘ Einwand im Hinterkopf auch gern zweimal gefallen (Opera Rara/ Warner ORR253). Ingrid Wanja

Ditlev Rindom/ University of Cambridge
Der Autor: Ditlev Rindom st Postdoktorand der British Academy am King’s College London. Er vervollständigt derzeit ein Buch über die Verbreitung der italienischen Oper zwischen Italien und Amerika um 1900 und arbeitet an einer kritischen Ausgabe von Puccinis La rondine, die von Ricordi veröffentlicht werden soll. Er studierte an den Universitäten von Oxford, Yale und Cambridge sowie am Royal Northern College of Music und hat im Journal der Royal Musical Association, im Cambridge Opera Journal und im Opera Quarterly Publikationen veröffentlicht.
(Übersetzung aus dem Englischen Daniel Hauser; wir danken dem Autor und Opera Rara/ Moe Faulkner/Macbethmediarelations für die Erlaubnis zur Übernahme des Artikel aus dem Booklet der neuen Opera-Rara-Aufnahme „Anima rara“. Foto oben: Rosina Storchio/ Iprnity)