Mit großen Bedauern hören wir vom Tode der französischen Sopranistin Christiane Eda-Pierre, sie starb am 5. September 2020 in Paris. Nachstehend wiederholen wir unsere Hommage an sie vom Dezember 2014.
Persönliche Erinnerungen: Unvergessen bleibt mir ihre Vitellia in der berühmten Hermann-Inszenierung der Clemenza di Tito in Brüssel – eine gebieterische, hochgewachsene Frau wirft in der ersten Szene wild und undiszipliniert mit ihren Schuhen um sich und malträtiert ihren grünangemalten Liebhaber (Alicia Nafé), verbreitet Chaos und wunderbaren, cremigen und ganz eigenartig timbrierten Gesang, nur um in der letzten Szene („Non più di fiori“) domestiziert ihre vielen Schuhe angepasst-ordentlich aufgereiht am Bühnenrand aufzustellen, wärend sie diese lange Arie voller Abschied und Resignation singt, diese voller Zwischentöne und voller Geheimnis in der warmen, etwas rauchigen dunklen Sopranstimme. Von da an liebte ich Christiane Eda-Pierre und suchte sie in Paris so viel wie möglich zu hören, auch in London für das Konzert des Benvenuto Cellini. Immer hinterließ sie bei mir einen nachhaltigen Eindruck. Und auch ihre wenigen Musikdokumente sammelte ich, die Gretry- und Philidor-LPs, die Clemenza als LP-Schachtel und später als DVD. Auch der Benvenuto Cellini unter Davis, wo sie eine ebenso kesse wie beseelte Teresa gibt, im Londoner Konzert noch persönlicher als auf der LP/CD. dazu auch eine Entführung mit ihr ebenfalls unter Davis. Live gibts zudem die schöne Jolie fille de Perth von Bizet und einen Docteur Miracle. Umso größer ist die Freude, bei der Decca France auf die Wiederausgabe ihrer beiden ehemaligen Philips-LPs (Airs d´Opéras Comiques: Grétry et Philidor)als gerade herausgekommenen CDs im Doppelpack (4807700, nicht im deutschen Programm der Decca, aber als Import bei Amazon zu haben). Anlässllich dieser Wiederveröffentlichung bei Decca führte der renommierte französische Kollege Christophe Capaci das nachfolgene Interview mit der Sängerin in Paris 2014. G.H.
 Die Neuauflage bei Decca ist vor allem eine Gelegenheit, Ihrem Liederabend wiederzubegegnen, der André-Ernest-Modeste Grétry (1741 – 1813) und François-André Danican Philidor (1726 – 1795) gewidmet ist, zwei Komponisten der Opéra comique, die bis vor kurzem ziemlich vernachlässigt wurden. Das Album, das zu seiner Zeit große Medienresonanz erzielte, wurde nie auf CD aufgenommen und die Liebhaber haben es schließlich als die Arlesienne der Opernplatten angesehen. Es war tatsächlich eine lange Abwesenheit, die ich mir nicht erklären kann. Umso mehr als die erste Erscheinung Aufsehen erregt hat und wir mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten haben.
Die Neuauflage bei Decca ist vor allem eine Gelegenheit, Ihrem Liederabend wiederzubegegnen, der André-Ernest-Modeste Grétry (1741 – 1813) und François-André Danican Philidor (1726 – 1795) gewidmet ist, zwei Komponisten der Opéra comique, die bis vor kurzem ziemlich vernachlässigt wurden. Das Album, das zu seiner Zeit große Medienresonanz erzielte, wurde nie auf CD aufgenommen und die Liebhaber haben es schließlich als die Arlesienne der Opernplatten angesehen. Es war tatsächlich eine lange Abwesenheit, die ich mir nicht erklären kann. Umso mehr als die erste Erscheinung Aufsehen erregt hat und wir mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten haben.
In einer Zeit, als die großen lyrischen Soprane nur Mozartarien aufgenommen haben, ein Komponist, den Sie übrigens auch vor allem gesungen haben, warum diese ungewöhnliche Wahl von Grétry und Philidor? Zweifellos aus Liebe zur französischen Sprache. Ich gehöre zu einer Generation, die alles auf Französisch gesungen hat. Meine westindischen Wurzeln, der singende Akzent von La Martinique… Bei uns liebt man es zu „sprechen“. In seinem Reisebericht „Das Lied des Ozeans“ sagt Olivier de Kersauson, dass man auf die Antillen gehen muss, um Französisch zu hören! Man kann uns sehr gut als das „alte Frankreich“ bezeichnen, das der Fortdauer der Sprache verbunden ist: Das bleibt ein schönes Kompliment.
Meine Sprache war ein Kampf und eine Leidenschaft während meiner ganzen Karriere und auch darüber hinaus auch bei meiner Arbeit am Pariser Konservatorium. Ich habe meinen Schüler immer gesagt: „Lernt zuerst französisch zu singen! Erst wenn ihr eure eigene Sprache, die schwer zu singen ist, beherrscht, könnt ihr euch an das fremdsprachige Repertoire wagen.“ Und zwar leichter, wie ich glaube. Grétry oder Philidor? Als ich diese Anthologie vorgeschlagen habe, haben viele die Nase gerümpft. Ist das wirklich Musik? Diese „Musiquette“? Aber nein, das ist ein wichtiges Repertoire, das ist das klassische Fundament (die klassische Gründung) der Opéra comique und das sind meine musikalischen Wurzeln. Meine Ausbildung kommt von hier. Es gibt in diesen Arien eine erstaunliche vokale Länge, ich wage es sogar zu sagen, dass sie generell dynamischer sind als manche von Mozart und dass sie unerhörte musikalische Schwierigkeiten beinhalten. Mit der Hilfe von Roger Blanchard – er hatte die Partitur von Carnéval de Vénise von Campra eingerichtet, den ich beim Festival von Aix-en-Provence im Jahr 1975 gesungen habe – , wurden wichtige Forschungen in der Nationalbibliothek angestellt, um diese Arien von Grétry und Philidor auszugraben. Das war etwas Besonderes, das war kein Mozart-Liederabend mehr.
Welche Erinnerungen haben Sie an die Aufnahme in London? Ein sofortiges Verständnis mit Neville Marriner! Am ersten Tag haben wir zusammen am Klavier gearbeitet. Dann mit dem Orchester, alles ging sehr rasch, in drei Tagen waren alle Arien „im Kasten“. Kaum so etwas wie eine Probe, um die Tempi festzulegen! Man muss dazu sagen, dass die Academy of St Martin in the Fields ein Ensemble von außerordentlicher Schmiegsamkeit ist, mit warmen Klängen, und die Musiker haben instinktiv die Farbe und den französischen Stil dieser Musik erfühlt. Ist es nicht erstaunlich, dass ich gerade mit Neville Marriner und Colin Davis so viele französische Platten aufgenommen habe? Auf dieser Seite des Ärmelkanals war Michel Plasson ein wenig allein gelassen, aber er hat zumindest das französische Repertoire für die Platte „gemacht“!

Christiane Eda-Pierre: Antonia Paris 1977/Decca/ „Foto Colette Massé Collection privée avec l´aimable autorisation de Madame Eda-Pierre“
Ihr Instrument? Der Reichtum eines lyrischen Soprans, seine Wärme und Rundheit, aber eine enorme Koloratur weite, eine ungewöhnliche Beweglichkeit…. Aufeinanderfolgend, aber auch gleichzeitig Lakmé und Antonia, Konstanze und Elettra, Rosina und Imogene aus dem Pirata von Bellini! Eben während dieses Pirata beim Festival von Wexfort im Jahr 1972 rief der italienische Dirigent Leone Magiera aus: „Aber was hast du für eine Stimme, Eda?“ Was Manuel Rosenthal betrifft, so sagte er, dass mein Instrument „undefinierbar“ sei. Eine natürliche Biegsamkeit? Eine eigenständige Gestaltung, die ich teilweise der Höhe meines Gaumens verdanke? Die Tiefe wie die Höhe waren klar und warm, das stimmt. Das hatte nichts zu tun mit der angeblich „schwarzen“ Stimme der Leontyne Price, die ich verehre: Es ist eine Frage der Morphologie, die Backenknochen, die Nasenhöhlen, das, was den Ton macht eben! Weder ich noch Shirley Verrett hatten diese Farbe.
Ihr Repertoire? Von Rameau und Campra zu Messiaen und Chaynes, vom Barock zur Zeitgenössischen, aber auch Händel, Mozart, der romantische Belcanto, die Opéra comique, eine Vielzahl von Oratorien aller Epochen… Persönliche Neugier! Ich hatte vor allem immer viel Glück, ich war immer von Musikern umgeben, die mir Entdeckungen ermöglicht haben. Erinnern Sie sich an Elisabeth Brasseur: Sie leitete den Studentenchor des Konservatoriums von Paris. Wir waren vierzehn in der Klasse, alle Stimmlagen waren vertreten, und wir konnten das gesamte Repertoire machen. Wir konnten den Roi David von Honegger in Angriff nehmen. Gabriel Dussurget engagierte unsere Gruppe für die Produktionen des Festivals von Aix.
Und der große Charles Panzéra! Ich bin seinem Unterricht zuerst in Privatstunden, von 1951 bis 1954, dann bis 1957 am Konservatorium mit Leidenschaft gefolgt: Man hat seinen Einfluss in der französischen Melodie nicht vergessen, aber wussten Sie, dass er seine Pariser Schüler Mahler singen ließ zu einer Zeit, wo das bei uns nicht einmal publiziert war? Er bekam die Partituren aus Deutschland. Ein anderer Bariton, bei dem ich am Konservatorium Kurse gemacht habe, sagte mir: „Du bist anders, kultiviere diese Andersartigkeit! Du bist groß, sei noch größer, wachse!“ Er hatte eine sehr eigenwillige Art, er ließ uns mit dem Rücken zum Publikum singen und forderte dabei noch mehr Intensität, als würden wir nach vor singen: „Ich will alles auf eurem Rücken lesen und hören.“ Was das Repertoire betrifft, wie meine ganze Karriere im Allgemeinen, glaube ich, dass ich gemacht habe, was ich machen wollte, nicht das, was man von mir wollte. Ich bin ein Handwerker des Gesangs. Der Bezug zum Zeitgenössischen war andererseits zumindest zögerlich: „ Mit Ihrer hübschen Stimme singen Sie Zeitgenössisches?“ Aber man kann sich die Stimme auch mit dem klassischen Repertoire ruinieren! Es gibt eine extreme Freiheit in der Gestaltung, ein Fehlen von Anhaltspunkten, die enthemmen. „Der heilige Franz von Assisi“ von Messiaen und „Erzsebet“ von Chaynes, die Pariser Oper hat mir diese Werke angeboten.

Christiane Eda-Pierre: Lucia di Lammermoor an der Opéra-Comique/ Decca „Foto Michel Petit/ Collection privée avec l´aimable autorisation de Madame Eda-Pierre“
Die Opéra-Comique, die Pariser Oper, Aix-en-Provence, London, Salzburg, Wien, Moskau und andere berühmte Orte. In den Vereinigten Staaten Chicago, San Francisco und in New York die Met, wo damals wenige französische Sänger eingeladen wurden… Sir Georg Solti wollte, dass ich seine Contessa in Le Nozze di Figaro war für die Amerika-Tournee der Pariser Oper im Jahr 1976. Um mich darauf vorzubereiten, musste ich die Rolle in der Produktion von Giorgio Strehler im Palais Garnier proben: Die wunderbare Margaret Price war in Paris für acht Vorstellungen vorgesehen, und mit unendlicher Großzügigkeit überließ sie mir vier davon und schickte mir ein herzliches Telegramm für die Premiere! So konnte ich danach an der Met debütieren. Ich wurde weiter eingeladen für Konstanze in Die Entführung aus dem Serail und Gilda in Rigoletto, zwei Produktionen, die von James Levine dirigiert wurden, schließlich Antonia in Hoffmanns Erzählungen beim Debüt von Riccardo Chailly.
Das amerikanische Leben war nichts für mich, aber die Met… Jimmy Levine, was für ein Dirigent! In der Entführung, in einer Interpretation, die der von Karl Böhm in Paris sehr nahe war. Wir standen ungefähr dreihunderttausend Personen gegenüber bei einem Rigoletto im Central Park. Der Star war Luciano Pavarotti, das Publikum machte aus diesem Abend einen großen Karneval. Levine beruhigte mich: „Sing! Wir sind da, wir machen Musik, das ist alles.“ Ich gab mein Bestes und das Publikum begrüßte mich mit immensem Geschrei: Pavarotti nahm mich an der Hand und führte mich nach vorne in Richtung Publikum. In Les Contes d´Hoffmann in New York liebte ich das Unprätenziöse von Plácido Domingo. Ja, ich hatte dieses Glück… Dennoch ist Abstand nötig, man muss sich selbst finden können, um besser weitermachen zu können. Man kann sich im Operngesang verlieren. Wenn Sie die Bühne verlassen haben, bleiben oft nur ein Hotelzimmer und Einsamkeit. All das ist vergänglich. Was mich betrifft, so wollte ich nie auf der Bühne sterben.

Christiane Eda-Pierre: Erzsebet von Charles Chaynes an der Pariser Oper 1983/ Decca „Foto Colette Masson/ Collection privée avec l´aimable autorisation de Madame Eda-Pierre“
Welche Dirigenten haben Sie geprägt? In der Komischen Oper Jésus Etcheverry. Die (gewerkschaftlich festgelegten!) drei Stunden täglicher Arbeit mit ihm waren viel mehr wert, das war intensiv. Er gab mir Kraft, er hat mich gelehrt, mit meiner Verwundbarkeit umzugehen – dass ein Problem auftaucht und ich nicht mehr singen kann… Serge Baudo: ein großer Dirigent, eine außerordentliche Menschlichkeit! Papagena in Aix. Konstanze in Paris und so viele Konzerte ( La Damoiselle élue von Debussy in Versailles!). So viele Oratorien, die man heute nicht mehr hört. Und auch Sylvain Cambreling, mit dem ich auch Vitellia in La clemenza di Tito in Brüssel gesungen habe, begleitete mich in Pour un monde noir von Charles Chaynes. Georg Solti natürlich. Ich erinnere mich an eine 9. Symphonie von Beethoven mit dem Pariser Orchester: Ich liebte es, die Noten von oben zu produzieren, das erspart, die Noten von unten zu nehmen, das stützt das Zwerchfell. Aber das war offensichtlich nicht nach dem Geschmack unseres Dirigenten: „Nein, nein, Christiane, singen Sie, wie soll ich sagen, à la Martinique!“ Seine Art, mir zu sagen: „Keine Konsonanten!“ Mit Karl Böhm, ein Glückszustand, ein außerordentlicher Moment, den ich Rolf Liebermann verdanke. Ohne Klavierprobe stürzte ich mich in „Ach, ich liebte“ der Konstanze direkt mit dem Orchester: Am Beginn verstand ich nicht viel von seinem Schlag, und ich glaube, er war absichtlich ein wenig vage, um mich auf die Probe zu stellen; danach ein Wonnemond! Colin Davis war im Studio ein wenig das Gegenteil von Böhm, und das war sehr gut. Bei Berlioz, der sein großes Projekt war, hatte er sehr genaue Ideen. Während der Aufnahme von Benvenuto Cellini konnte er mehr als eine Stunde mit einem Takt mit Nicolai Gedda verbringen! Eine Gesamtaufnahme von großem Format, das Fernsehen übertrug übrigens Teile davon.

Christiane Eda-Pierre, Botschafterin ihrer Heimat Martinique/franceantilles.mobi
Meine einzige versäumte Begegnung war die mit Karajan. Wir sollten uns für eine Entführung in Salzburg treffen, aus verschiedenen Gründen kam es nicht dazu. Ich hätte gern mit ihm gearbeitet. Ich fühlte die absolute Leichtigkeit, die er seinen Solisten vermittelte. Schließlich habe ich mit Levine in Salzburg in Jean-Pierre Ponnelles Inszenierung von Hoffmanns Erzählungen gesungen.
Das Gespräch wurde von dem französischen Musikjournalisten Christophe Capaci im Théâtre National der Opéra-Comique, Paris, am 20. März 2013 geführt, der Autor war so liebenswürdig, uns diesen Artikel zu überlassen. Dank an Ingrid Englitsch für die Übersetzung. Und Dank auch an Edoaurd Brane von der Universal France für seine Hilfe. Die so gekennzeichneten Fotos von Colette Masson und Michel Petit stammen aus dem Booklet der wiederveröffentlichten Decca-CDs und sind dem Privatbesitz der Sängerin entnommen, auch dafür Dank.
Zur Person ein Auszug aus Wikipedia: Christiane Eda-Pierre (born March 24, 1932) is a French lyric coloratura soprano of Martiniquan origin, who sang in a wide variety of roles, from baroque to contemporary works. Eda-Pierre was born in Fort-de-France, Martinique, and came to France to study at the Paris Conservatory, where she was a pupil of J. Decrais and Charles Panzéra. She graduated with honors in 1957. The same year, she made her professional debut in Nice, as Leïla in Les pêcheurs de perles. She made her debut at the Opéra-Comique in 1958, as Lakmé, at the Aix-en-Provence Festival in 1959, as Papagen, and at the Palais Garnier in 1960, as Lucia di Lammermoor. She sang there the standard lyric coloratura roles of the French and Italian repertories. She also won great acclaim in Mozart roles, especially, as well as the Countess in Le nozze di Figaro, Donna Anna and Elvira in Don Giovanni, The Queen of the Night. Eda-Pierre was much appreciated in French baroque opera, particularly the works of Jean-Philippe Rameau, including Les Indes galantes, Zoroastre, Les Boréades, and Dardanus. She was also very active on French Radio where she sang in little performed works, such as Rossini’s Le siège de Corinthe, Bellini’s Il pirata, Bizet’s La jolie fille de Perth, as well as Berlioz’s Béatrice et Bénédict and Benvenuto Cellini. She created many contemporary works, such as Capdeville’s Les amants captifs (1973), Chaynes’s Pour un monde noir (1979), and Erszebet (1983). In 1983 she also created the role of the Angel in Olivier Messiaen’s Saint François d’Assise. At the Opéra. Eda-Pierre also appeared to great acclaim internationally, including Lisbon, London, Wexford, Berlin, Hamburg, Vienna, Salzburg, Moscow, Chicago, and New York. She made her Metropolitan Opera debut in 1980 as Konstanze, and went on to sing other roles there: Antonia in Les contes d’Hoffmann and Gilda in Rigoletto. She became a teacher at the Paris Conservatory in 1977, while continuing her career in opera and in concert. The possessor of a beautiful, rich and agile voice, which enabled her to succeed in a wide variety of roles, Eda-Pierre can be heard on several recordings, her three most famous being on the Philips label, as Konstanze in Entführung aus dem Serail and Teresa in Benvenuto Cellini, both under Sir Colin Davis, and an album of arias from the French opéra-comiques of Grétry and Philidor, under Sir Neville Marriner. For the Bizet centenary in 1975 she participated in BBC studio recordings of La Jolie Fille de Perth and Le Docteur Miracle. (Foto oben: Christiane Eda-Pierre: Konstanze in Paris 1977/Decca/ „Foto Colette Massé Collection privée avec l´aimable autorsation de Madame Eda-Pierre“)

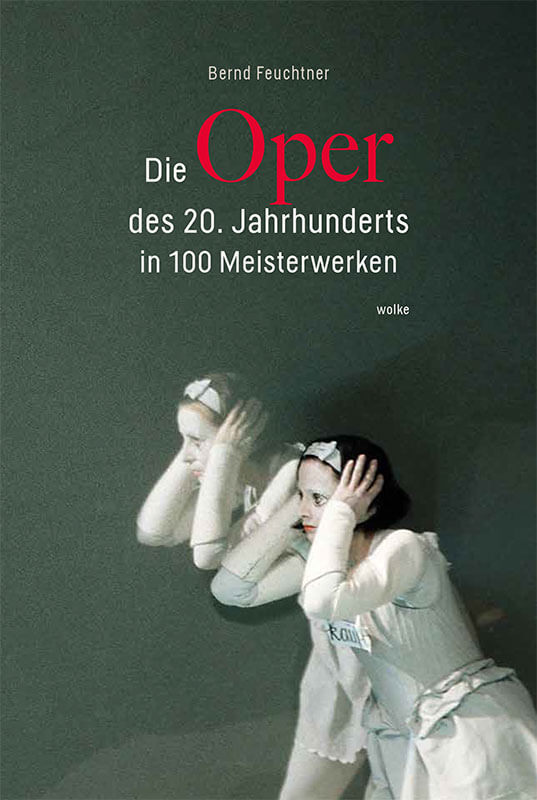



 Die Neuauflage bei Decca ist vor allem eine Gelegenheit, Ihrem Liederabend wiederzubegegnen, der André-Ernest-Modeste Grétry (1741 – 1813) und François-André Danican Philidor (1726 – 1795) gewidmet ist, zwei Komponisten der Opéra comique, die bis vor kurzem ziemlich vernachlässigt wurden. Das Album, das zu seiner Zeit große Medienresonanz erzielte, wurde nie auf CD aufgenommen und die Liebhaber haben es schließlich als die Arlesienne der Opernplatten angesehen.
Die Neuauflage bei Decca ist vor allem eine Gelegenheit, Ihrem Liederabend wiederzubegegnen, der André-Ernest-Modeste Grétry (1741 – 1813) und François-André Danican Philidor (1726 – 1795) gewidmet ist, zwei Komponisten der Opéra comique, die bis vor kurzem ziemlich vernachlässigt wurden. Das Album, das zu seiner Zeit große Medienresonanz erzielte, wurde nie auf CD aufgenommen und die Liebhaber haben es schließlich als die Arlesienne der Opernplatten angesehen. 













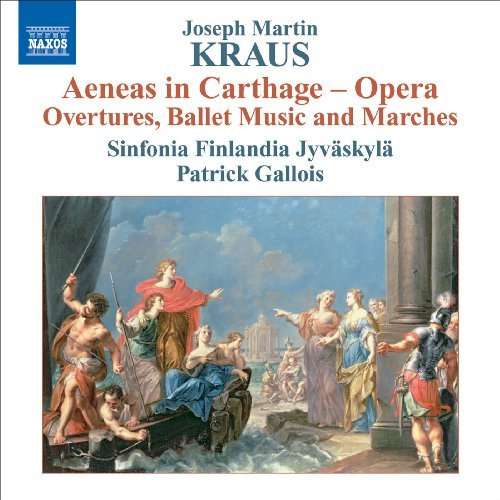

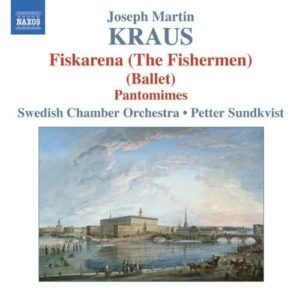 Eine weitere CD
Eine weitere CD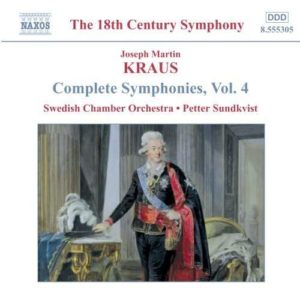 Von den mehr als 60 Liedern in sechs verschiedenen Sprachen von
Von den mehr als 60 Liedern in sechs verschiedenen Sprachen von  Vol. 2
Vol. 2 Eine weitere CD
Eine weitere CD 






 Das Zürcher Unternehmen
Das Zürcher Unternehmen  30Viele Melomanen erinnern sich gerne an die Kompilationen von Ouvertures, die in den goldenen Jahren der Schallplatte ihre Herzen erfreuten. Ob von einem einzigen Komponisten wie Beethoven und Rossini oder von unterschiedlichen Tonsetzern, stets freute man sich über Musikstücke, die selten im Konzertsaal oder auf LP und später auf CD zu hören waren. Waren es Opernouvertüren, dann waren diese Zusammenstellungen eine willkommene Einführung zu Bühnenwerken, die auf keinem Spielplan standen. In gewisser Hinsicht überahmen solche Platten dieselbe Funktion wie Übertragungen für ein zwei- oder vierhändiges Klavier im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Seit einiger Zeit sind solche Platten aus der Mode gekommen, vielleicht auch weil viele Theater inzwischen regelmässig Raritäten bieten.
30Viele Melomanen erinnern sich gerne an die Kompilationen von Ouvertures, die in den goldenen Jahren der Schallplatte ihre Herzen erfreuten. Ob von einem einzigen Komponisten wie Beethoven und Rossini oder von unterschiedlichen Tonsetzern, stets freute man sich über Musikstücke, die selten im Konzertsaal oder auf LP und später auf CD zu hören waren. Waren es Opernouvertüren, dann waren diese Zusammenstellungen eine willkommene Einführung zu Bühnenwerken, die auf keinem Spielplan standen. In gewisser Hinsicht überahmen solche Platten dieselbe Funktion wie Übertragungen für ein zwei- oder vierhändiges Klavier im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Seit einiger Zeit sind solche Platten aus der Mode gekommen, vielleicht auch weil viele Theater inzwischen regelmässig Raritäten bieten.