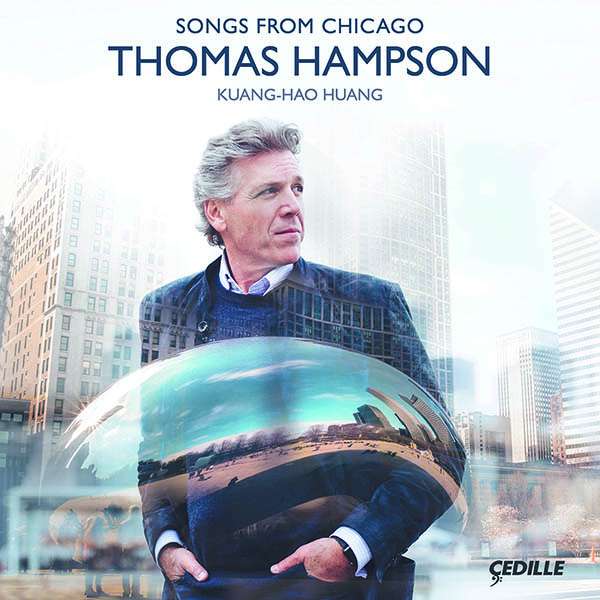.
Pierre Gaveauxs (1761 – 1825) Oper Léonore ou l’Amour conjugal von 1798 galt und gilt als der Trittstein für Beethovens Leonore/Fidelio, und kaum je einer hat sie gehört. Nur in Bonn spielte man sie 1989 in einer Studentenaufführung (das Kölner Opernstudio und die Camerata musicale Bonn 1989 im Rahmen der Veranstaltungen zum „200. Sturm auf die Bastille“, hierzu gab es eine Ausstellung des Beethoven-Hauses zu „Beethoven und Politik“ im Rathaus, und in diesem Rahmen auch Szenen der Oper). Auf youtube zeigen sich ein paar Clips der Aufführung in New York 2017 (s. unten), eine Pollacca aus Le Trompeur trompé (1800), Regina Resnik singt „Dieu d’Israel“ aus der Oper L’enfant prodigue von Gaveaux (1811, sehr ähnlich der großen Arie aus Mehuls Joseph), auf einer alten CD „La Revolution en Chansons“ gibt es ein schwungvolles Sextet de la Cité „Le réveil du peuple contre les terrorites“ (1795) mit der Musik von Gaveaux, mehr nicht. Dabei hat der Mann meterweise Bühnenwerke komponiert, beinahe ausschließlich heiteren Genres.
.

Der Librettist der „Leonore“: Jean-Nicolas Bouilly/ Wiki
Aber eigentlich ist der Ruf von Léonore ou l’Amour conjugal mythischer als ihre Musik, die durchaus in die Kategorie der üblichen Opéra Comique der Revutionszeit (1798 in Paris zur Zeit von Robespierres Schreckensregime premiert) fällt und etwa den Deux Journées oder dem Joseph von Mehul nahekommt. Ich hatte mir – ehrlich gesagt – viel mehr erwartet und war doch enttäuscht. Schon Mehul oder Auber haben ihre Schwächen, aber Gaveaux (selber Tenor und der erste Jason in Cherubinis Médée) bleibt glatt-galant und nicht wirklich memorabel. Einzig das wirklich dichte Vorspiel und die Szene des Florestan zu Beginn des zweiten Aktes bleiben mir in Erinnerung, denn es gibt nun endlich ein lang ersehntes Dokument der Oper. Naxos hat als DVD eine im Februar 2017 mitgefilmte Aufführung von der rüstigen und auf dieses Repertoire spezialisierten Opéra Lafayette in New York herausgebracht (ohne deutsche Untertitel!), die der künstlerische Direktor des Organisation, Ryan Brown, mit Schwung dirigiert und die durchaus ordentliche Stimmen aufbieten kann. Kimy McLaren will mir in der Hosen tragenden Titelrolle etwas blass erscheinen, aber Tenor Jean-Michel Richer macht mit hervorragender Diktion wett, was der Stimme vielleicht an Heroischem fehlt. Dazu kommen munter Pascale Baudin als Marceline, Keven Geddes als Jacquino, dazu der dräuende Dominque Coté hervorragend als Pizarro sowie Tamislave Lavoie als Vater Roc (sic!). Alexandre Sylvestre schließlich gibt den ausgleichenden Minister. Man sieht schon an den Namen, dass das benachbarte Kanada die Solisten gestellt hat, und das mit vor allem sprachlichem Gewinn.

Gaveaux: „Léonore“ in der Aufnahme der Lafayette Opéra bei Naxos Bluray
Optisch ist Léonore ou l’Amour conjugal ebenso solide Ware, eher recht niedlich-bürgerlich-hübsch in den Sets von stilistisch-historischen Set/ Kostümen von Laurence Mongeau in der ebenso munteren, spielfreudigen Inszenierung von Oriel Tomas. Die meiste Wirkung geht an die hervorragende und szeneschaffende Beleuchtung von Julia Basse, der die Videoverfilmung von Jason Starr geschickt folgt. Alles in allem also eine werkdienliche Wiedergabe, kein Euro-Trash-Regietheaterschrecken, wofür man der Lafayette Opéra dankbar ist.
Dennoch, eine CD hätte es vielleicht auch getan, denn es geht im Wesentlichen um das Kennenlernen einer musikalischen Bearbeitung des Librettos (von Jean-Nicholas de Bouilly/ 1763 – 1842), das in einer anderen Fassung eben eine solche Furore gemacht hat. Die Handlung ist die gleiche wie bei Beethovens Sonnleithner (ab 1805), aber hier bei Gaveaux wirkt sie eben galanter, unterhaltsamer, weniger wichtig, belangloser, austauschbarer. Und angesichts anderer Rettungsopern wie Cherubinis Lodoiska (1791) und Les deux journées (1800, Libretto ebenfalls Bouilly) oder auch Paers wie Mayrs Leonora/L´amor conjugale (1804 bzw. 1805) wenig später ist dies doch leichtere Kost.
Die Ausstattung der Naxos-DVD ist ordentlich, gut getrackt und mit schönen Aufführungsfotos, dazu ein Artikel in der Beilage (nur Englisch) von Julia Doe von der Columbia University New York, den wir nachstehend in der Übersetzung von Daniel Hauser wiedergeben, um die Erstbegegnung mit Léonore en travestie zu würdigen (Naxos DVD 2.110591). G. H.
.

Gaveaux: „Léonore“ an der Opéra Lafayette/ Szene/ Foto wie auch oben Louis Forget
Léonore, ou L’Amour conjugal, mit einem Libretto von Jean-Nicolas Bouilly und Musik von Pierre Gaveaux, ist eines der bekanntesten Stücke des Opern-Theaters, von dem praktisch niemand aus dem heutigen Publikum jemals Notiz genommen hat. Diese opéra comique, die im Jahre 1798 ihre Premiere am Pariser Théâtre Feydeau feierte, ist sinnbildlich für eine hartnäckig vernachlässigte Kategorie des dramatischen Repertoires – die Dialogoper der Epoche der Französischen Revolution. Sie ist freilich auch der Ursprung für ein Objekt weitverbreiteten Ansehens und anhaltenden wissenschaftlichen Interesses: Fidelio, die einzige überlebende (und vielfach überarbeitete) Oper von Ludwig van Beethoven. Léonore von Bouilly und Gaveaux ist daher ein Werk mit einer einzigartigen gegabelten Identität. Auf der einen Seite sind ihre Handlung und ihr musikalisches Idiom eng verbunden mit der Zeit und dem Ort ihrer Entstehung; sie verrät eine klare Verpflichtung an die Konventionen der opéra comique der klassischen Ära und der spezifischen politischen Umstände der späten 1790er Jahre. Auf der anderen Seite sind die abstrakten und umfassend verallgemeinerbaren Themen – von der Stärke ehelicher Hingabe und der Notwendigkeit von Rebellion gegen ungerechte Verfolgung – außerordentlich anpassungsfähig, was sich anhand der anhaltenden Einflusses auf die Vorstellung des Volkes im Frankreich und im gesamten Europa des 19. Jahrhunderts zeigt.

Gaveaux: Grabstätte auf dem Pariser Friedhof Pierre Lachaise
Léonore wurde von ihrem Librettisten als eine „fait historique“, eine historische Tatsache beschrieben. Die Bezeichnung bezieht sich auf eine Unterkategorie der französischen Oper, die sich in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts entwickelte und Handlungen aufwies, die von den Schlagzeilen angeregt wurden oder anderweitig auf zeitgenössischen Heldentaten beruhten. In seinen (zuweilen unechten) Memoiren propagierte Bouilly – ein Jurist, der zum Dramatiker wurde – das Werk durch die Hervorhebung seiner Wahrhaftigkeit. Er behauptete, dass dieses Drama durch eine wahre Begebenheit inspiriert sei, die sich während der revolutionären Terrorherrschaft ereignet habe. Als er als Zivildiener in Zentralfrankreich angestellt war, sei er Zeuge geworden einer „großartigen Tat von Tapferkeit und Ergebenheit durch eine der Damen von Touraine, bei deren noblen Anstrengungen ich die Freude hatte mitzuwirken“. Die Details dieses durchaus glaubwürdigen Vorfalls zu verifizieren ist unmöglich. Und es sollte beachtet werden, dass der eigene Ruf des Autors in Verbindung mit dem seines Doppelgängers aus dem Theater von Nutzen war – wenn er die Bemühungen einer echten Léonore unterstützte, implizierte Bouilly, dass er selbst als Vorbild für das eigentliche Symbol von Gerechtigkeit und Autorität im Libretto diente, den wohlwollenden Minister Don Fernand. Wenn Léonore eine Spur historischer Wahrheit enthält, veranschaulicht dies außerdem (und eher zweckdienlich) viele der beliebten Handlungstypen des zeitgenössischen französischen Theaters. Das Thema der dramatischen Rettung aus der Gefangenschaft war in den Jahren nach dem Sturm auf die Bastille – wenig überraschend – allgegenwärtig, ebenso wie die dramatische Verurteilung der willkürlichen Tyrannei. (Gefängnisszenen kommen häufig vor in den Werken jener Zeit, von Monsignys Le Déserteur bis zu Dalayracs Raoul, sire de Créqui. Der böse Dourlinski in Cherubinis Lodoïska ist ein offenkundiger Vorgänger des mächtigen Bösewichts in Léonore, Dom Pizare.)
.

Gaveaux: „Léonore“ an der Opéra Lafayette/ Szene/ Foto Louis Forget
Gaveauxs Partitur für Léonore wendet sich sowohl rückwärts als auch vorwärts und vermischt klangvolle Idiome des Ancien Régime mit komplizierteren Nummern, welche die sich rasch entwickelnde Ästhetik der 1790er Jahre widerspiegeln. Die Stilsprache von Roc, Marceline und Jacquino bleibt weitgehend innerhalb der Konventionen des vorrevolutionären Zeitalters. Diese komischen Figuren äußern sich in einem rustikalen Dialekt und in einer Reihe populär geprägter strophischer Formen. Ein typisches Beispiel ist Marcelines eröffnendes Liebeslied „Fidélio, mon doux ami“, bestehend aus Reimen in Moll-Tonart, mit einem Refrain in Dur. Gaveaux hat aber auch die Entwicklungen des revolutionären Jahrzehnts gründlich aufgegriffen, was sich insbesondere in seinem weitreichenden Umgang mit Chormusik und in der Einbeziehung von Stilen zeigt, die aus dem Bereich der lyrischen Tragödie stammen. (Gaveaux war sowohl Komponist als auch Stardarsteller am Théâtre Feydeau. Dies hatte seine Ursache in den Hauptrollen mehrerer Prüfsteinwerke der damaligen Zeit, darunter Cherubinis Lodoïska und Medée wie auch Steibelts Roméo et Juliette; dies vermittelte ihm die neuesten Trends in der modernen Opernkomposition aus erster Hand.) Was ihn anbelangt, ist gerade das Ensemble, das den ersten Akt der Oper beschließt („Que ce beau ciel“), bemerkenswert; es wird von männlichen Gefangenen gesungen, die nach und nach die Bühne füllen, und ist ein klares Modell für den berühmten „Gefangenenchor“ („O welche Lust“) im parallelen Moment in Beethovens Fidelio. Innovativ sind auch das ernste Obligato-Rezitativ und die Romanze, die Florestan zu Beginn des zweiten Aktes aufführt. Der deklamatorische Gesangsstil, die dunkle c-Moll-Tonalität und die wachrufenden Orchestereffekte erzeugen eine düstere Vorahnung, die an die tragédie lyrique erinnert. (Gaveaux fordert vom Horn, „Glocke zu Glocke“ zu spielen – eine Technik, die Gluck verwendete, um die Klanglandschaft der Unterwelt in seiner Pariser Alceste darzustellen.) Tatsächlich waren die Gefängnisszenen von Léonore so düster, dass sie drohten, die Identität des komischen Genres zu gefährden; ein Kommentator stellte fest, dass es sich um einen „seltsamen verbalen Missbrauch“ handle, wenn man die Arbeit von Bouilly und Gaveaux als opéra comique einstufe.
Léonore wurde nach ihrer Pariser Premiere von der Kritik begeistert aufgenommen. Dem Journal de Paris fiel es schwer, sich an eine weitere Oper zu erinnern, die „einen solch vollständigen und allumfassenden Erfolg“ erzielt habe, während der Censeur dramatique die „erstaunlichen“ musikalischen Effekte und die „nuancierte“ und „verdeckte“ dramatische Konstruktion der Titelfigur hervorhob. Die Popularität des Werkes führte bald zu einer Reihe von Adaptionen für den Export ins Ausland. Ferdinando Paer und Johann Simon Mayr brachten 1804 bzw. 1805 Übersetzungen ins Italienische heraus; Beethoven legte eine deutsche Fassung des Librettos von Bouilly seinem eigenen Werk im selben Jahr in Wien zugrunde. (Er sollte seine Oper noch einmal 1806 und 1814 überarbeiten und mit verändertem Text unterlegen.) Was an Léonore vielleicht am bemerkenswertesten ist, das ist die Art und Weise, in der ihre Themen sukzessive und breit umgestaltet wurden, getrennt von den sehr spezifischen historischen und geographischen Umständen der ursprünglichen Konzeption. Die Oper von Bouilly und Gaveaux entstand nach der radikalsten Phase der Französischen Revolution, dem Terror der Jahre 1793/94. Ihre Metaphern der Befreiung sollten daher nicht auf das gestürzte Regime der Bourbonen-Monarchie abzielen, sondern richteten sich an Robespierre und die Jakobiner. (Das Théâtre Feydeau hatte den Ruf, royalistischen Gefühlen nahezustehen, und Gaveaux war der Autor einer bekannten Hymne, die sich gegen den Terror richtete: Le reveil du peuple.) Um 1814 hatte die endgültige Fassung des Fidelio von Beethoven eine völlig neue politische Resonanz gefunden: Die Handlung wurde größtenteils als Vorbild für den Sturz Napoleons betrachtet und das überschwängliche Finale als Zeichen für die Wiederherstellung der europäischen Stabilität auf dem Wiener Kongress. Für beide (und auch spätere) Interpretationen von Léonores Grundthemen ist das zentral, was der Historiker Paul Robinson als „rechtwinklige Geschichtsauffassung“ bezeichnet hat, einen Übergang von der alten Ordnung zu einer neuen, die nur durch Kampf erreicht werden kann. Darin steckt viel vom dauerhaften – und inspirierenden – Reiz. Julia Doe, Assistenzprofessorin für Musik, Historische Musikwissenschaft, Columbia University/ Übersetzung Daniel Hauser
.
.

Gaveaux: „Léonore“ an der Opéra Lafayette/ Szene/ Foto Louis Forget
Zur Oper fügt der Wiener Musikwissenschaftler Gerrit Weidelich, der im Sommer 2016 in Berlin einen Vortrag über Bouillies Libretto anlässlich der Neuproduktion des Fidelio an der Berliner Staatsoper hielt, hinzu: Die Sopranistin Julie-Angélique Scio hatte in der Uraufführung der Médée von Luigi Cherubini einen außerordentlichen Erfolg mit der Titelfigur (Medée) erzielt und brannte darauf, in weiteren Rollen zu brillieren. Gegenstand der Medée war ja die Schilderung einer Ehe-Katastrophe – Jason hatte sie ja nicht aus Liebe geheiratet –, da war es keine Frage, dass sich als nächstes Opern-Projekt ein komplementäres Sujet besonders gut eignete. Auf die Scio soll also der Vorschlag zurückgehen, dass man für sie eine Hosenrolle schaffen möge. Es bot sich an, die an der Produktion der Medée beteiligten Kollegen anzusprechen, etwa ihren Tenor-Partner Pierre Gaveaux, der den Jason dargestellt hatte. Gaveaux war ein erfahrener Opernkomponist und ließ sich gern auf das von Jean-Nicolas Bouilly vorgeschlagene Sujet über den „Triumph der ehelichen Liebe“ ein.

Gaveaux: „Lénore“/ Titelblatt des Librettos/ Wiki
Mit der von Bouilly vorgeschlagenen Geschichte hatte es eine besondere Bewandtnis: Bouilly war in Tours auf komplizierte Weise in eine politisch heikle Affäre verwickelt, die er erst 1836/37 in seiner dreibändigen Autobiographie Mes Récapitulations offenlegte, so dass keiner der insgesamt vier Komponisten, die sein Libretto vertonen sollten, davon etwas erfuhr.
Vor 1789 noch Royalist, wurde Bouilly in der Revolution zum Anhänger der Republikaner und übernahm 1793 sogar die Aufgabe, in einem Prozess als Ankläger gegen seinen konterrevolutionären Jugendfreund Semblancay (das Vorbild für die Rolle des Florestan) aufzutreten. Die Sache der Republikaner betrieb Bouilly so wenig aktiv, dass der Prozess gegen seinen Jugendfreund derart verzögert wurde, dass es dessen Kerkermeister gelingen konnte, die Frau des Semblancay, als Bäuerin verkleidet, in das Gefängnis einzuschmuggeln, um dem Häftling die Flucht zu ermöglichen, was jedoch nicht gelang.
Inzwischen war ein erklärter Feind des Semblancay (das Pendant des Pizarro) aktiv geworden und versuchte, diesen im Gefängnis zu erstechen, wobei dies in Gegenwart einer Reihe anderer Insassen geschehen sollte. Darunter befand sich auch die Ehefrau des Opfers, die sich schützend vor ihn warf und den mordlustigen Radikalisten Carrier mit einer Pistole bedrohte. Bouilly gelang es in der Folgezeit, den Prozess gegen seinen Freund bis zum Sturz Robespierres weiter zu verzögern, worauf der Gefangene seine Freiheit wiedererlangte. Sein Widersacher wiederum war am Sturz Robespierres beteiligt, dies kam Bouilly und seinem Schützling Semblancay gelegen.
Sobald sich die politischen Verhältnisse wieder änderten und die Monarchie neuerlich zur Staatsform erkoren wurde, gab Bouilly seine politischen Aktivitäten auf und wirkte nunmehr als Theaterdichter und Librettist. Bouilly erzählte seine Erlebnisse offenbar derart fesselnd und in der Art eines Theatersujets, dass die Sängerdarstellerin Scio so begeistert war, dass Bouilly und Gaveaux ihr binnen Jahresfrist die Rolle der Leonore auf den Leib schrieben. Anfang 1798 kam die gemeinsam geschaffene Oper (wie die Médée) im selben Theater Feydeau heraus und sie war so erfolgreich, dass sie zigmal wiederholt wurde.
.
.
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.










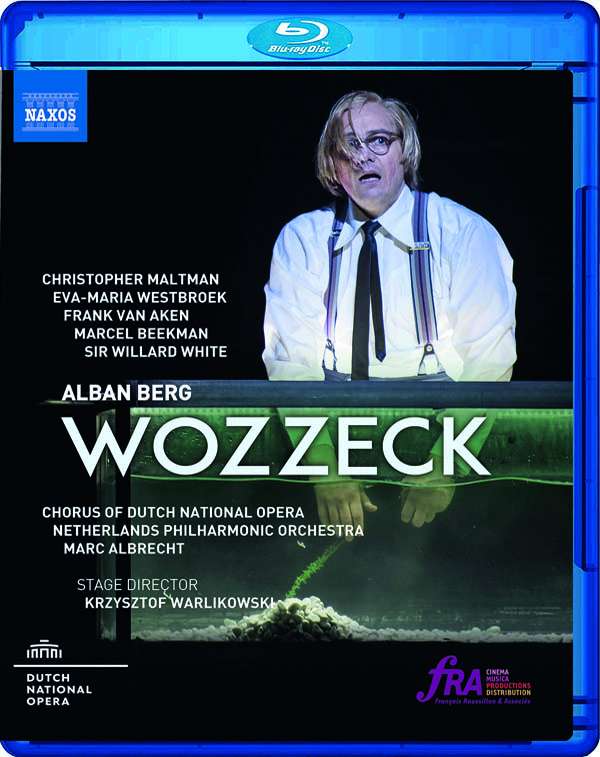
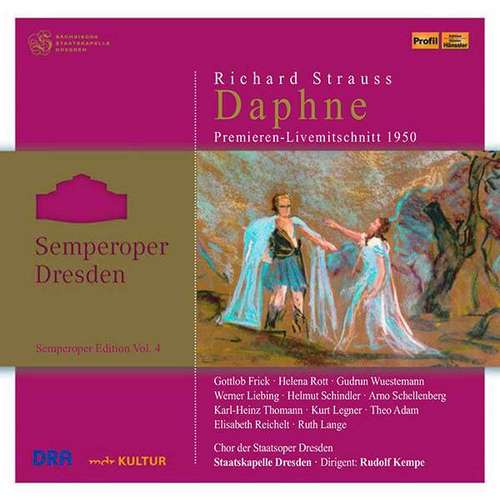









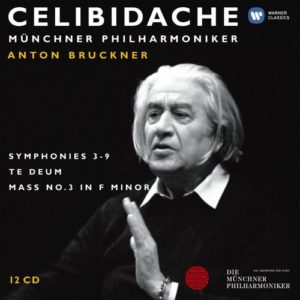


 Die Bedeutung New Yorks, von der Bernstein sagte, „Diese Stadt fesselt mich noch immer. Kein Wunder, dass ich dauernd Musik über sie schreibe“, für amerikanische Komponisten, Songwriter und Theatermacher von der Tin Pan Alley über die Gershwins und den Immigranten Weill bis zu Bernstein untersucht
Die Bedeutung New Yorks, von der Bernstein sagte, „Diese Stadt fesselt mich noch immer. Kein Wunder, dass ich dauernd Musik über sie schreibe“, für amerikanische Komponisten, Songwriter und Theatermacher von der Tin Pan Alley über die Gershwins und den Immigranten Weill bis zu Bernstein untersucht Das ist alles andere als ein
Das ist alles andere als ein