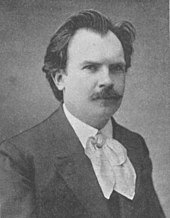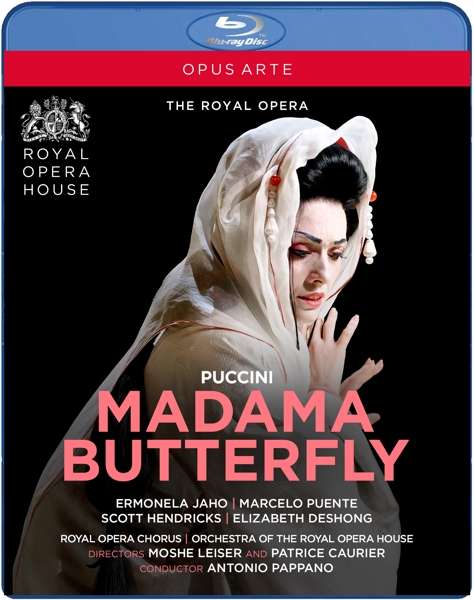Die Karriere des Tenors Reiner Goldberg, Jahrgang 1938 und lange Jahre Startenor der Berliner Staatsoper, begann 1967 in Dresden. Seine Markenzeichen waren das leuchtende Timbre, die glänzende Tonhöhe und die intensiver Gestaltungskraft. International bekannt wurde er schlagartig als Parsifal. Die Erato-Aufnahme von 1981 war der Soundtrack zum Film, den Hans-Jürgen Syberberg nach dem letzten Werk Wagners drehte. Danach folten viele internationale Gastspiele und Opernaufnahmen. Selbst heute ist er noch in kleineren Partien zu bewjundern. Mit Rainer Goldberg Goldberg sprach Michael Stange. R. W.
Ein paar Worte zum Beginn ihrer Laufbahn. Ich bin im Oberlausitzer Bergland in Crostau in der Nähe von Bautzen geboren worden. In unserer Gegend waren die Menschen sehr arm. Musik hat mich schon als Kind begeistert. In unserer Kirche haben wir eine Orgel, die im 16. Jahrhundert von dem berühmten Orgelbauer Gottfried Silbermann gebaut wurde. So lange ich mich erinnern kann, habe ich Stunden in der Kirche zugebracht und der Orgel zugehört. Mein Vater spielte neben seiner Arbeit Trompete. Seine Brüder waren auch sehr musikalisch, sein Bruder Otto spielte Posaune am Stadttheater Bautzen und der Bruder Rudolf Klavier. Ich war auch sehr früh Mitglied in einem Posaunenchor, wo ich zuerst Waldhorn und dann Trompete spielte. Mein erstes Opernerlebnis war der Don Giovanni in Dresden 1955. Musik und Aufführung haben auf mich einen unglaublichen Eindruck gemacht. Don Giovanni war Arno Schellenberg und Leporello sang Theo Adam. Mit unserem Posaunenchor haben wir zu einem Geburtstag gespielt. Einer der Gäste sagte: „Mensch Reiner, sing doch was.“ Ich sang „O sole mio“ auf Deutsch, und die Gäste waren aus dem Häuschen. Damit waren die Würfel für mich gefallen.
Arno Schellenberg war Ihr Lehrer in der Musikhochschule. Meine stimmliche Ausbildung hat aber sehr lange gedauert. Große Schwierigkeiten machte die Atemtechnik. Die ersten Jahre ging es überhaupt nicht voran. Ich wollte aufhören. Mit einem Mal sah ich im Fernsehen einen Meisterkurs Gesang mit dem berühmten Kavaliersbariton der dreißiger Jahre Willy Domgraf-Fassbaender. Er erklärte seinen Schülern: „Ihr müsst locker sein, bis in die Zehenspitzen. Ruhe in den Körper und in den Atem bringen.“ Ich hatte das so noch nie gehört. Es klang einfach, den Mund locker und unverkrampft lassen, und die Stimme mit dem Atem führen. Nach einigem Probieren zu Hause gelang es mir, und plötzlich ging die Stimme wie eine Rakete in die Höhe.

In dieser New Yorker Produktion der Deutschen Grammophon sang Reiner Goldberg den Siegfried. Der erste Anlauf auf die Rolle war 1983 in Bayreuth nicht zustande gekommen/ daraus oben ein Ausschnitt/ Foto Met Opera Archive/ DG.
Sie schätzen Aufnahmen von Sängern der Vergangenheit. Gerade für das Erlernen der Atemtechnik ist das Hören alter Schallplatten unglaublich wichtig, weil diese Sänger davon viel mehr verstanden als wir heute. Ich spiele meinen Schülerinnen zum Beispiel Platten von Elisabeth Rethberg vor. Bei Ihrer Aufnahme der Arie „L’amerò saro costante“ aus Il re pastore hört man, wo sie den Atem setzt. Sie macht das so geschickt, dass sie dadurch die Schwierigkeiten der Arie viel besser meistert und sich nicht überanstrengt. Das ist für eine wortdeutliche und technisch gute Interpretation wichtig.
Was waren Ihre ersten Rollen in Radebeul und Dresden? Im Jahr 1965 neigte sich meine Ausbildung dem Ende entgegen, und ich wollte mich in Radebeul vorstellen. Ich wurde engagiert und debütierte als 1. Geharnischter in der Zauberflöte. Nun war ich ganz kurz im Ensemble als der Erste Tenor kündigte. Daher wurde ich gefragt, ob ich im Sommer auf der Felsenbühne Rathen den Simon im Bettelstudent singen kann. Das habe ich natürlich gemacht. Nach der ersten Vorstellung habe ich mich wie Caruso gefühlt. Das ging dann so weiter mit Puccinis Mantel bis zum Max im Freischütz. So kam es zum Gastspiel als Max in Dresden, wo ich seit 1969 gastweise und seit 1972 fest engagiert wurde. Hinzu kam im gleichen Jahr (Ost-)Berlin.
An der Spitze der Staatsoper stand Hans Pischner. Der war ein Theatermann der alten Schule. Er kannte jedes seiner Ensemblemitglieder ganz genau, gab ihnen Tipps für die weitere Entwicklung, wusste wo er sie einsetzen und wie er sie fördern konnte und schuf eine familiäre gute Atmosphäre. Er hielt zu Regisseurinnen wie Ruth Berghaus, von denen er überzeugt war, und zu seinen Sängerinnen und Sängern. Er hatte sehr konkrete und praktische Ideen, was er machen wollte und wie er seine Ziele umsetzen konnte, ohne sich den Staat zum Feind zu machen. Pischner liebte Webers Oberon. Bald nachdem ich in Berlin anfing, sagte er mir, dass er mich als Hüon wolle. Kurz nach seinem hundertsten Geburtstag habe ich Pischner noch einmal getroffen, und er hat mich sofort erkannt, mich umarmt und gerufen: „Ach mein Hüon.“ Im Wagnerfach hat er mich auch gesehen, aber er hat mir geraten, mir viel Zeit zu lassen und mich in Ruhe darauf vorzubereiten.

„Mit dem Aaron habe ich vielleicht einen Weltrekord erreicht. Diese Rolle habe ich mindestens 59mal gesungen“, so Goldberg. Moses und Aron wurde noch in der DDR unter Herbert Kegel eingespielt.
Den Siegmund sangen Sie um 1972 in Dresden. Haben Sie sich mit Rollenvorgängern wie Ernst Gruber oder anderen ausgetauscht? Das war ein Zufall, weil ein Kollege ausgefallen war. Damals lag mir die Rolle ein wenig zu tief, und ich fand sie auch zu dramatisch. Aber die Vorstellungen mussten ja stattfinden, und so habe ich das dreimal gemacht. Komischerweise war das nach dem Freischütz auf Anstellung in Dresden meine zweite Rolle. Dazu muss ich eine Geschichte erzählen, weil Sie Ernst Gruber ansprechen. Ich habe die Walküre das erste Mal in Dresden 1959 gehört. Mein Onkel hatte Karten besorgt, Ernst Gruber – den ich noch heute sehr bewundere – sang den Siegmund und es war das zweite oder dritte Mal, dass ich eine ganze Oper hörte. Es war auch mein erster Wagner. Nun wurde ich im ersten Akt ein wenig unruhig, weil es mir zu lange dauerte und im zweiten Akt bin ich eingeschlafen. Meine Einstellung hat sich natürlich später gewandelt, aber denken muss ich an dieses erste Wagner-Erlebnis sehr oft. Seltsamerweise bin ich Ernst Gruber nur einmal Mitte der siebziger Jahre begegnet. Wir stellten uns mit großem Brimborium und gegenseitigen Respektbezeugungen einander in der Kantine der Staatsoper vor. Dann erzählte ich ihm aber die Geschichte meiner ersten Walküre mit ihm, wir haben Tränen gelacht.
Der große Schritt ins Wagnerfach war 1978 der Tannhäuser in Dresden mit Harry Kupfer. Diese Rolle hatten Sie länger als die berühmten Tenöre der dreißiger Jahre Max Lorenz und Lauritz Melchior im Repertoire. Da muss man sich doch nur die Noten ansehen, wieviel Piano und Pianissimo dort drin steht. Natürlich kommen auch Stellen, wo es richtig losgeht. Davon lebt ja die Musik, von den Kontrasten. Den Tannhäuser kann man stimmlich als Fortsetzung des Max oder Stolzing anlegen. Man darf keinesfalls brüllen, sondern muss in der Gesangslinie bleiben und die dramatischen Ausbrüche entsprechend gestalten. Dann erschließt sich auch das Spannungsfeld der Rolle und das Leiden des Tannhäuser an seiner Zerrissenheit. Letztlich habe ich meine ursprüngliche Gesangslinie im Tannhäuser nie verlassen, aber auch von meinem Metall und der Durchschlagskraft in der Höhe profitiert. Die Stimme muss mitmachen. Ich brauchte viel Zeit, um die Rolle zu verinnerlichen und sie weiter zu entwickeln. Insofern ist das erste Mal nur ein Versuch. Man steht am Fuße des Berges und braucht lange zum Gipfel. Man braucht aber auch gute Partner, um eine stimmige Gesamtleistung zu erreichen. Meine Stimme wurde über die Jahre runder und dunkler. Trotzdem habe ich weiter lyrische Rollen auf der Bühne und im Rundfunk gesungen und bin auch den Oratorien treu geblieben. Mit dem Tannhäuser bin ich um die Welt gereist. Die Rolle habe ich in Ungarn, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland Russland, den USA und anderswo unzählige Male gesungen. Diese Partie war sicher eine der Rollen meines Lebens.

Partien von Wagner, Beethoven und Weber versammelt diese Schallplatte, die noch von der DDR-Firma Eterna produziert wurde und auch im Westen erschien.
In den achtziger Jahren begann die große internationale Karriere. Mein erstes Auslandsgastspiel war im Frühling 1973 mit Bergs Wozzeck in Paris. Ich hatte den Tambourmajor erst in einigen Vorstellungen gesungen, aber die Rolle lag mir sehr gut. Das war natürlich eine riesige Sache. Als DDR- Bürger drei Wochen in Paris, das hätte ich nie zu träumen gewagt. Ich habe dort viermal den Tambourmajor gesungen. Als ich das erste Mal in Berlin die Rolle singen sollte, mussten wir für mich im Fundus ein Kostüm suchen. Zunächst fanden und fanden wir nichts. Auf einmal kam die Kostümbildnerin mit einer Jacke. Oben drin fand sich ein Name. Max Lorenz, der hatte das Tambourkostüm auch schon getragen. Nun erbte der kleine Goldberg von Lorenz Rolle und Kostüm, und das habe ich als sehr gutes Omen angesehen, das sich auch bewahrheitete. Den Tambourmajor habe ich noch 34 Jahre später in Barcelona gesungen. Für meine weitere Karriere waren zwei Gastspiele in Italien und England besonders wichtig. In Perugia habe ich 1980 Rienzi gesungen. Im Jahr davor sang ich mit Edda Moser dort in Beethovens Leonore. Wir kannten uns, weil ich auch in der drei Jahre zuvor entstandenen einer Plattenproduktion mitgewirkt habe. Als ich dort also den Florestan sang, hat ihr das so gut gefallen, dass sie mir sagte: „Sie haben so eine schöne Stimme. Ich muss das dem Karajan erzählen, der soll Sie mal anhören.“ Etwas ähnliches passierte mir in London. Ich sang in Covent Garden den Stolzing in den Meistersingern 1982 gemeinsam mit Lucia Popp. Wir haben so gut harmoniert, dass sie mich Bernhard Haitink empfahl und wir gemeinsam in München die Daphne aufnahmen.
In Salzburg wirkten Sie 1982 unter Karajan im Fliegenden Holländer als Erik mit. Herbert von Karajan war einer der Glücksfälle meines Lebens. Wir kamen sehr gut zu recht. Wenn ich mit ihm allein war, war er wie ein alter gütiger Vater. Ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich wurde eingeladen in die Philharmonie nach Berlin, weil Karajan sich wohl auf den Rat von Edda Moser selbst ein Bild von meiner Stimme machen wollte. Ich sang ihm also einiges aus dem Holländer vor und Christian Thielemann, der damals sein Assistent war, begleitete. Irgendwann wurde Karajan unruhig und kam auf die Bühne. „Singen Sie mir doch einmal die Romerzählung.“ Thielemann kannte das natürlich alles auswendig und begleitete bis mich Karajan bei der Stelle: “ … ein Engel hatte ach den übermütigen“ unterbrach: „Herr Goldberg, stellen Sie sich mal vor, ein Eeengel.“ Das wiederholte ich, und er kam dann zu mir, legte seine Hand auf meinen Arm und sagte: „Na Herr Goldberg, wollen wir es miteinander versuchen?“ Seine gütige Art hat mich fast erschlagen. Ich konnte kaum sprechen vor Freude.

„Lucia Popp hatte die Seele in der Stimme und ist für mich eine der schönsten deutschen Stimmen.“ Reiner Goldberg erinnert sich gern an die Zusammenarbeit mit der Sängerin bei dieser Produktion.
Sie wurden ja früh für Bayreuth engagiert. Meine ersten Kontakte mit Bayreuth waren 1981 das Vorsingen bei Georg Solti für den Siegfried im 1983 geplanten Ring. Auch Wolfgang Wagner war anwesend und Solti kam auf die Bühne und fragte: „Wollen Sie mein Siegfried sein?“ Er liebte meine Stimme und hat auch später noch gesagt: „Der Goldberg hat mir Proben gesungen, da ist mir das Herz aufgegangen.“ Die Rolle funktionierte musikalisch sehr gut. Schwierig war es mit Peter Hall, dessen Regieanweisungen ich wegen der Sprachbarriere oft nicht so schnell umsetzen konnte, wie er sich das wünschte. Hinzu kam, dass das Bühnenbild für den Siegfried durch einen Wasserteich sehr ungünstig war und ich darin während der Proben öfter ausgerutscht bin. Stimmlich war bis zur Hauptprobe alles in Ordnung. Den Siegfried hatte ich mir auch mit Soltis Hilfe so gut erarbeitet, dass ich fest überzeugt war, der Herausforderung des Rollendebuts in Bayreuth gewachsen zu sein. Leider bekam ich aber, wie auch in anderen wichtigen Momenten meiner Karriere, eine Halsentzündung und wurde in der Generalprobe heiser. So musste ich den dritten und vierten Akt der Generalprobe heiser durchsingen. Das hat bei Wolfgang Wagner und Solti zu so großer Nervosität geführt, dass sie mich hinauswarfen, obwohl ich bis zur Premiere wieder fit gewesen wäre und ihnen das auch gesagt habe. Über diesem Bayreuther Ring 1983 lag nun in vielerlei Hinsicht ein Fluch. Die Effekte, die sich Peter Hall ausgedacht hatte, funktionierten oder wirkten nicht. Solti ist erheblich mit den Musikern bei den Proben aneinander geraten.
Mit Wolfgang Wagner und Bayreuth ging es aber weiter? Nur zwei Jahre später inszenierte er in Dresden die Meistersinger, und wir trafen uns wieder. Natürlich war ich immer noch wütend, aber die Zusammenarbeit klappte gut, und ich war gut bei Stimme. Wolfgang Wagner war ein sehr herzlicher Mensch und ein wandelndes Lexikon. In Dresden setzte er sich nach den Proben in der Kantine oft zu uns, und er konnte auf jede Frage spannende Antworten geben. Nach dem Bayreuth-Debakel habe ich zwei Jahre später im Frühjahr 1985 Gelegenheit gehabt, als Siegfried in Barcelona zu debütieren. Das ging sehr gut, und das habe ich ihm natürlich erzählt. Da wurde er hellhörig. Wenig später erhielt ich eine Einladung nach West-Berlin, um ihm und Daniel Barenboim im Theater des Westens für den Bayreuther Ring 1988 vorzusingen. In seiner grantigen Art sagte er: „Keine Zugaben. Können Sie mir den Tannhäuser und den Stolzing 1986 covern?“ Natürlich war ich noch sehr böse, aber mich reizte auch die Herausforderung. Also habe ich zugesagt. In den ersten zwei Wochen war ich in Bayreuth. Ich hatte meine Eltern mitgenommen. Ein Einspringen in Bayreuth war nicht nötig, und wir fuhren zurück in die DDR. Plötzlich kam dann aber der Anruf: „Kommen Sie schnell, Sie müssen morgen den Tannhäuser singen.“ Ich fuhr rasch nach Bayreuth, hatte aber noch keine Probe mit Giuseppe Sinopoli gehabt. Der hatte am Abend meines Eintreffens auch keine Zeit, so dass wir uns erst 90 Minuten vor der Vorstellung zur ersten Probe trafen. Sinopoli war ein wunderbarer Musiker, aber er hatte eigene Vorstellungen. Wir haben also vor jedem Akt die Rolle des Tannhäuser in der Pause durchgenommen. An jenem Abend habe ich den Tannhäuser also zweimal gesungen, aber dafür einen Riesenapplaus erhalten. Nach der Vorstellung kam Wolfgang Wagner mit einem riesigen Blumenstrauß auf die Bühne und sagte zu mir: „Reiner, wir betrachten das jetzt mal als reinigendes Gewitter.“ Damit beerdigten wir unseren alten Krach. 1987 habe ich dann in Bayreuth den Stolzing in den Meistersingern gesungen. Im Jahr 1988 folgten Stolzing und Siegfried in Götterdämmerung und 1989 beide Siegfriede und Tannhäuser.

Leidenschaftlicher Streiter für die Oper: Reiner Goldberg in einer Diskussionsrunde. Foto Youtube
Kommen wir zu Richard Strauss. Die zentralen Partien waren für mich der Bacchus in Adriane, der Kaiser in Frau ohne Schatten und später der Herodes. Begonnen hatte es Ende der siebziger Jahre in Berlin mit der Frau ohne Schatten. Ziemlich bald kam 1983 die Bitte, in einer konzertanten Aufführung des Guntram unter Eve Queler in New York mitzuwirken. Sie war eine der ersten sehr berühmten Dirigentinnen in den USA und brachte mit ihrem Orchester immer konzertant seltene Opernwerke heraus. Wir haben noch 1992 gemeinsam Rienzi gemacht. Eine weitere wichtige Partie war der Apollo in Daphne mit Lucia Popp, die wir unter Bernhard Haitink in München aufgenommen haben. Lucia Popp hatte die Seele in der Stimme und ist für mich eine der schönsten deutschen Stimmen. Eine der Strauss-Opern, die mich musikalisch stark begeistert haben, ist Die Liebe der Danae. Die haben wir 1984 in Paris gemacht. Der Herodes ist eine Partie, die mich besonders lange begleitet hat und die ich auch auf CD eingesungen habe. Musikalisch sind die Rauschhaftigkeit und der Glanz der Musik von Richard Strauss für mich immer ein Erlebnis gewesen. Mit seinen Werken bin ich in unbekannteren Partien und in Glanzrollen um die Welt gereist, und die Aufführungen sind mit einer Vielzahl glücklicher Erinnerungen verbunden.
Sie beherrschen ein Repertoire von mehr als 70 großen Rollen in Oper, Operette und Konzert. Partien wie Lohengrin 1997 haben Sie vom Blatt, in Italienisch oder Englisch gesungen. Woher kommt diese Fähigkeiten zur Aneignung eines so vielfältigen Repertoires? Mir ist es schon ganz früh leicht gefallen, mir Musik vom Gehör, von den Noten und vom Wort anzueignen. Viele Rollen wie Guntram, Apollo oder Rienzi habe ich gelernt, weil ich die Musik geliebt habe. Oft war klar, dass es sich um ein einmaliges Konzert handelt. Auch dort ist das Lernen der Partie aber ein wichtiger Teil des Übens des Umgangs und des Verinnerlichens von Musik. Die Möglichkeit, die Noten während der Vorstellung vom Blatt zu singen macht es leichter, ein Stück zu singen. Eine Auseinandersetzung mit der Rolle ist aber trotzdem nötig. Opern auf der Bühne zu singen wie Moses und Aaron, erfordert natürlich viel mehr Vorbereitung. Allein der schwierige Text und dann der Ausdruck. Besonders im Schlussdialog von Moses und Aaron. Das ist so schwer. Mit dem Aaron habe ich vielleicht einen Weltrekord erreicht. Diese Rolle habe ich mindestens 59mal gesungen. Das Werk wurde in Japan mit Siegfried Vogel und mir 1994 erstmals halbszenisch aufgeführt. Das war unglaublich. Der japanische Dirigent Kazuyoshi Akiyama dirigierte das, als ob es „Hänschen klein“ sei. Die japanischen Sänger und der Chor haben das mit unglaublicher Hingabe und Schönheit gemacht. Den Lohengrin hatte ich bereits Anfang der achtziger Jahre studiert. Ich konnte die Rolle vollständig vom Blatt singen und bin aber nie gefragt worden, die Partie auf der Bühne zu singen. Dann ergab es sich 1997, dass der Lohengrin der Premiere in Berlin krank geworden war und ich vier Tage vorher gebeten wurde, die Rolle von der Seite zu singen. Dazu war ich gern bereit und das hat gut funktioniert. Den Lohengrin habe ich dann auch 2002 auf der Bühne in Turin gesungen. Bei Peter Grimes haben mich einfach die Rolle und das Schicksal interessiert. Ich spreche ja kein Englisch und musste alles phonetisch lernen, aber es hat gut geklappt und viel Arbeit erfordert. Es war aber auch eine tolle Produktion mit Philippe Jordan in Graz. Am schwersten erschien mir das Studium des Siegfried. Nach dem Rienzi in Perugia 1980 und dem Vorsingen bei Herbert von Karajan war mir klar – und meine Agentin hat mich auch darauf hingewiesen -, dass bald dicke Brocken kommen könnten. Also habe ich mir nach dem Parsifal und dem Vorsingen bei Solti auch die Noten vom Siegfried angesehen und mit meinem Korrepetitor hineingerochen. Nach dem ersten Schreck über die Flut der Noten, die Länge der Rolle und die Schwierigkeiten der Partie habe ich sie wieder weggelegt. Dann hat mich die Rolle aber nicht mehr los gelassen. Sie ist musikalisch so vielfältig. Ich habe sie dann bald darauf intensiv studiert. Diese Dramatik des ersten Akts, die Poesie des Waldwebens und auch Siegfrieds Lernen der Furcht im dritten Akt ließen mich nicht mehr los und haben mich emotional unglaublich stark berührt. Später habe ich den Siegfried unter James Levine 1988 bis 89 in New York eingespielt und auf der Bühne häufig gesungen.

Entspannt und gelassen: Reiner Goldberg privat. Foto: Wikipedia
Ihnen gelingt es, Emotionen im Tonfall widerzuspiegeln. In den zerrissenen Partien wie Tannhäuser, Pedro, Max und Herodes wirken Sie am stärksten. Ich kann das nicht genau erklären. Bei vielen Rollen habe ich mich natürlich sehr intensiv mit dem Text auseinander gesetzt. Beim Moses sind mir bei den Proben viele Lichter aufgegangen, und wir haben das mit Harry Kupfer intensivst erarbeitet. Ähnlich war es mit dem Tannhäuser. Das haben wir lange daran gefeilt und über die Perspektiven der Rolle diskutiert. Im Tannhäuser war ich so tief drin, dass ich nicht mehr gemerkt habe, was Realität und was Bühne ist und während vieler Aufführungen unglaublich gelitten. In vielen Situationen des Zweifelns oder der Unsicherheit habe ich mich an eigene Erlebnisse erinnert. Das gilt auch für den Pedro im Tiefland. Als er Martha sieht und sich fragt, ob er ihr wohl gefallen wird, ist das wie im dem richtigen Leben. Das hatte ich dann auch im Kopf. Der Herodes ist ja nur vordergründig ein geiler alter Mann. Er ist aber auch in seiner Todesfurcht Opfer seiner Angst und seiner Krankheit. Harry Kupfer war für mich ein Segen, weil wir eigentlich alle wichtigen Rollen einmal oder mehrfach intensiv in langen Proben und Gesprächen erarbeitet haben. Er ist unglaublich sensibel und kann die Dinge, die ihn bei seiner jeweiligen Deutung bewegen, phantastisch darstellen. Das hat mir bei meinen Interpretationen sehr geholfen, weil die Darstellung auf der Bühne aus dem inneren des Künstlers kommen muss, um gut zu wirken. Gleichzeitig konnte ich, obwohl ich ja Tenor bin, mit eigenen Ideen kommen und die wurden, wenn sie uns beiden plausibel erschienen, umgesetzt. Der Text ist von zentraler Bedeutung. Der Sänger muss verstanden werden. Schon in der Hochschule, aber später auch bei Harry Kupfer hieß es: „Erzähle den Leuten das Stück.“ Das geht natürlich nur über den Text und die Musik. An der Wortdeutlichkeit zu arbeiten, ist ein entscheidender Punkt. Nur dann können sich Wort und Musik verbinden und die nötige dramatische Wirkung vermitteln. Auch für das Publikum ist das doch von entscheidender Bedeutung. Je mehr es den Text versteht und je überzeugender die Darstellung ist, desto mehr kleben die Zuschauer an den Lippen des Sängers. Michael Stange (Das im Original wesentlich längere Interview erschien zuerst im April 2018 auf der Website des Kulturmagazins Ioco und wurde für operalounge.de stark gekürzt. Red. Rüdiger Winter; wir danken Michael Stange für den Abdruck.)
Das große Foto oben zeigt Reiner Goldberg als Siegfried in einem Ausschnitt des Covers der Plattenproduktion der Deutschen Grammophon. Sie erregte damals großes Aufsehen bei Publikum und Kritik und ist noch immer im Handel. Für die Fans des Heldentenors gilt sie als eine seiner zentralen Aufnahmen.