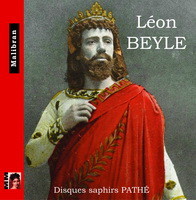..
Zehn Jahre Donizetti Opera: Das Festival in Bergamo feiert mit Roberto Devereux, Zoraida di Granata und Don Pasquale. Bergamos Donizetti Festival feiert sein zehnjähriges Bestehen. Unter neuer Zeitrechnung und mit dem Titel Donizetti Opera. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man sich in Bergamo unter dem Titel Donizetti Renaissance der unbekannten Werke Donizettis annehmen, ab 1982 nannte sich ein ähnliches Unterfangen Donizetti e il suo tempo und ich kann mich gut an Raritäten wie Sancia di Castiglia und Gemma di Vergy erinnern.
Anders als alle Vorgänger versucht Donizetti Opera neben den philologisch skrupulösen Editionen von Donizettis Werken die gesellschaftliche Relevanz des Komponisten, seine Modernität und Aufgeschlossenheit zu betonen, sowie, laut des künstlerischen Leiters Francesco Micheli, „Donizettis revolutionäre Theatralik mit der Gegenwart verbinden, da wir glauben, dass kein Theater so zeitgemäß, vital und notwendig ist wie das von Donizetti“. Ob das gelungen ist oder gelingen kann, sei dahingestellt. Auf jeden Fall entfach das Festival ein Spektakel, das auf einer Piazza unweit des Opernhauses mit LU OpeRave beginnt, einer in Anlehnung an Lucia di Lammermoor benannten Veranstaltung, in der Donizettis Musik „meets electronics and new trends“. Dazu das obligate Vermittlungsprogramm aus Familien-, Kinder- und Jugendangebot, offenen Proben, Gesprächen und Serien. Die Karten-reservierungen übertrafen die des Vorjahres, Sponsoring und Spenden waren bedeutend. Donizetti ist in der Stadt in aller Munde. Das ist gut so.

Bergamo Donizetti Festival 2024/Foto Gianfranco Rota/“Roberto Devereux“/Szene
Das Programm ist die Mischung, die sich über die letzten Jahre bewährt hat: Das Hauptinteresse liegt dabei auf dem #donizetti200-Projekt, den vor exakt 200 Jahren uraufgeführten Opern Donizettis, also der 1824 in einer zweiten, völlig umgekrempelten Fassung an Roms Teatro Argentina erstmals aufgeführten Zoraida di Granata, deren Uraufführung zwei Jahre zuvor im gleichen Theater erfolgt war. Die Eröffnung bildet der auf mirakulöse Weise wieder international ins Repertoire zurückgekehrte Roberto Devereux, das Glanzstück aus Donizettis Spätphase (Neapel 1837). Zuletzt dann Don Pasquale (Paris 1843), ein Meisterwerk der komischen Oper und Donizettis letztes Werk, das sich dauerhaft im Repertoire behaupten konnte.
.
Der Tod tanzt mit. Ein keckes Gerippe, das aus den dunklen Ecken aufraucht und die gleichen Gewänder wie die Königin trägt. Den düsteren Schlusspunkt der im 16. Jahrhundert spielenden Tudor-Kapitel, die Donizetti vom frühen Castello di Kenilworth über Anna Bolena und Maria Stuarda erzählte, bildet Roberto Devereux nach einem Libretto von Salvatore Cammarano. Das Werk entstand in düsterer Zeit, in der Donizettis dritter Sohn die Frühgeburt nur eine Stunde überlebte und seine Frau Virginia kurz darauf starb. Am Ende der Tetralogie bricht Elisabeth I., die bei allen Werken im Hintergrund immer mitgedacht werden muss, nach der Hinrichtung ihres letzten Liebhabers zusammen. Im Vorjahr hatte das Theatre de la Monnaie die Renaissance-Thriller in Anspielung an Elisabeths uneheliche Geburt unter dem Titel Bastarda üppig aufgeputzt und findig auf zwei Abend komprimiert und konzentriert – Elisabeth war die uneheliche Tochter von Heinrich VIII., ihre Mutter war die von Heinrich VIII. zum Tode verurteilte Anne Boleyn, ihre Kusine Maria Stuart. So erfolgreich das Brüsseler Verfahren offenbar war, verbietet sich eine solche Fassung für Bergamo. In Bergamo hatte man zuletzt das erste Auftreten der Elisabeth in Donizettis Schaffen 2018 mit Il Castello di Kenilworth gefeiert, nun also der entsagungsvolle Schlusspunkt mit Roberto Devereux in der kritischen Edition von Julia Lockhart.

Bergamo Donizetti Festival 2024/Foto Gianfranco Rota/“Roberto Devereux“/Szene
Wieder ist Jessica Pratt Elisabeth I. von England, wieder steht der musikalische Leiter des Festivals Riccardo Frizza am Pult, der erklärte Roberto Devereux sei seine Lieblingsoper von Donizetti. Fürs britische Flair ist Stephen Langridge zuständig, der in dieser Zusammenarbeit mit dem Theater in Rovigo mit seiner irischen Kollegin Katie Davenport einen Hauch der elisabethanischen Ära nach Bergamo brachte. Elisabethanisch sind vor allem die steifen Halskrausen des Chores, den wackeren Choristen dell‘Acccademia Teatro alla Scala, die entsprechend ihrer wenig handlungsrelevanten Stichwort-Aufgaben hinter Holzbalustraden zum dekorativen Rahmen verkommen. Für Langridge und Davenport ist Donizettis letzte Elisabeth-Tragödie ein einziges Memento mori, ein szenisches Sinnbild für irdische Vergänglichkeit, wie sie die auf einem Tisch aufgebauten Stillleben inklusive Stundenglas und Totenschädel und die verblühten Blumensträuße an der Rampe symbolisieren. Mehr noch das tanzende Gerippe, das unschwer als Doppelgänger der Königin zu erkennen ist. Immer noch scheint es fleischlichen Gelüsten nicht abgeneigt, umgarn einen jungen Mann, wirft ihn aufs große Bett der Königin und umfasst ihn. Das tanzende Skelett ruft Ekel, Abscheu und Grauen der Königin hervor, die ihr Ende gespiegelt sieht. Es ist ein intimes Stück, das zwischen Elisabeth und ihrem halb so alten Geliebten Leicester spielt, der sich in Sara, die Gattin seines Freundes, des Herzogs von Nottingham, und die engste Vertraute der Königin verliebt hat. Düster und beklemmend ist die Atmosphäre in Westminster und in den Gemächern der Herzogin. Hinter dem Rahmen aus Leuchtröhren, die manchmal blendend aufleuchten und die Handlung einfrieren, entwickelt Frizza das Stück mit dem Orchestra Donizetti Opera akribisch und langsam, verzichtet in der kritischen Edition auf das wirkungsvolle God save the Queen-Zitat, das Donizetti erst ein Jahr nach der Uraufführung in die Sinfonia einbaute, und vertraut auf einen flüsternden, raunenden Ton. Das wirkt rasch etwas spannungslos, vor allem, da man den Eindruck gewinnt, dass die Sänger die lange Anlaufzeit des ersten Aktes zum Einsingen nutzen. Ab dem zweiten Akt gewinnt die Aufführung nach der Pause deutlich an Dramatik. Das liegt auch an Jessica Pratt, deren Sopran für diese Partie vermutlich zu leicht, zu einfarbig und ausdrucksarm ist. Dennoch entwickelt die australische Sopranistin ab dem großen Terzett im zweiten Akt mit Roberto und Nottingham das leidenschaftliche Porträt einer verletzten Frau. Das ist spannend, auch wenn manch Phrasen etwas gewollt und vulgär oder flach und quasi gesprochen geraten, doch insgesamt ist Pratts Stimme von einheitlich sanfter Qualität. Das Finale, die bedeutende „Vivi, ingrato“-Szene und die Aria finale, geraten Pratt packend, erreichen die rechte Mischung aus Atemlosigkeit, Hysterie und Verzicht. Auch John Osborn klingt als Titelheld anfangs etwas verhalten, zeigt sich in seiner großen Szene in der Gefängniszelle aber als der überlegene Stilist und technisch formidable Sänger, der „Come uno spirto angelico“ atemstockend über unendliche Piano-Phrasen langsam zu großer Dramatik steigert. Die kalabrische Mezzosopranistin Raffaella Lupinacci beeindruckt als Sara durch einen hellen, sopranklaren und beweglichen Mezzosopran, Simone Piazzola bringt für den Herzog von Nottingham die Qualitäten eines routinierten Verdi-Baritons mit. Auffallend der litauische Bassbariton Ignas Melnikas, der Elisabeths Vertrauten Raleigh markant bassbaritonales Profil verlieh (15. November 2024).
.

Bergamo Donizetti Festival 2024/Foto Gianfranco Rota/“Zoraida di Granata“/Szene
Es war ein weiter Weg bis zu diesem musikalisch ausbalancierten und dramaturgisch mustergültigen verdichteten Seelendrama, wie wir am nächsten Abend am Beispiel der modernen Wiederaufführung der Zoraida eindringlich erleben (16. November). Allerdings sind die Dimensionen einer – inklusive Pause – fast 3 ¾ endlose Stunden dauernden Seria auch dazu angetan, den Zuschauer in einen komatösen Zustand zu versetzten. Zoraida di Granata war einer der ersten unangefochtenen Erfolge Donizettis, der sich damit auf dem Gebiet der altmodischen Opera seria profilierte. Das Libretto von Donizettis Mitschüler und späterem Scala-Direktor Bartolomeo Merelli, der Verdi zur Nabucco-Vertonung drängte, basiert auf dem Roman Golzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise des Dichters Jean-Pierre Claris de Florian (1755-94), der sich einen Namen durch seine Fabeln machte. Luigi Romanelli (1751-1839) hatte daraus das Libretto für Giuseppe Nicolinis (1762-1842) 1805 an der Mailänder Scala uraufgeführte Abenamet e Zoraide gemacht. Zoraida di Granata beinhaltet die typischen und ermüdenden Seria-Verstrickungen, bei denen sich irgendwann niemand mehr dafür interessiert, ob noch eine Kerkerhaft oder Hinrichtung droht, ob noch ein unerkannter Ritter oder böser Tyrann naht.
Die Handlung spielt im maurisch beherrschten Granada im späten 15. Jahrhundert. Als neuer König von Granada begehrt Almuzir, der den früheren Herrscher gestürzt und getötet hat, dessen Tochter Zoraida zur Frau. Zoraida liebt bereits Abenamet, Almuzirs Generals und Überhaupt des edlen maurischen Geschlechtes der Abencerragen. Almuzir wirft Abenamet zunächst ins Gefängnis, schickt ihn dann aber auf Drängen seiner Anhänger in die Schlacht gegen die Spanier mit dem ausdrücklichen Befehl, die mitgeführte Fahne wieder zurückzubringen. Abenamet siegt, kehrt aber ohne die Fahne des Königreichs nach Granada zurück, worauf ihn Almuzir des Verrats beschuldigt und zum Tode verurteilt. Nun kommt Zoraida ins Spiel, die einwilligt Almuzir zu heiraten, wenn er Abenamet am Leben lässt. Nach seiner Freilassung trifft Abenamet nochmals Zoraida und erkennt, welchem Opfer er sein Leben verdankt. Das Treffen wird von Almuzirs Vertrauten Ali belauscht, worauf Zoraida des Verrats beschuldigt und zum Tode verurteilt wird, es sei denn ein Ritter kämpfe im Duell für ihre Unschuld. Ein unbekannter Ritter erscheint und trägt die vermisste Fahne mit sich. Er verwundet Ali, der auf Befehl Almuzirs die Fahne ins spanische Lager schmuggelte, um Abenamet zu beschuldigen. Der Fremde ist kein anderer als Abenamet. Das Volk fordert Rache für die Missetat des Königs, doch Abenamet kennt kein süßeres Vergnügen als die Verzeihung und vergibt ihm großmütig, worauf der von dieser noblen Haltung überwältige Almuzir auf Zoraida verzichtet und sich die Freunde versöhnen. Wie stets werden alle Verwicklungen am Ende ganz rasch geklärt und Abenamet kann im finalen Rondo jubilieren, „Da un eccesso di tormento“.

Bergamo Donizetti Festival 2024/Foto Gianfranco Rota/“Zoraida di Granata“/Szene
In der zweiten Fassung versuchte Rossinis Aschenputtel-Librettist Jacopo Ferretti eine Verbesserung des Textes, denn auf Wunsch des Impresarios Giovanni Paterni revidierte Donizetti zwei Jahre später die Oper und erweiterte vor allem die Partie des Abenamet, die von der bedeutenden Rossini-Altistin Rosmunda Pisaroni übernommen wurde. In dieser musikalisch weitgehend neu gefassten Fassung vom 7. Januar 1824 wurde Zoraida di Granata jetzt im Teatro Sociale in Bergamo erstmals wiederaufgeführt. Im Gegensatz dazu hatte das Wexford Festival, mit dem die Koproduktion von Bruno Ravellas Inszenierung zustande kam, die erste Fassung aufgeführt; aus Wexford stammt auch der Almuzir des südkoreanischen Tenors Konu Kim, der 2019 in Bergamo den Leone di Casaldi in L’ange de Nisida. Für beide Fassungen wird die kritische Ausgabe von Edoardo Cavalli benutzt. Stärker noch als in Donizettis frühen komischen Opern drücken die Schablonen der Zeit, ersticken geradezu jeden individuellen Zugriff. Der Ton ist, wenn auch nicht wirklich unverkennbar, schon typisch Donizetti, statt des klassizistischen Ebenmaß eines Rossini, dessen Vorbild einen übermächtigen Schatten wirft, vernimmt man in der orchestralen Verdichtung und Verfeinerung den Klang der Romantik, beispielsweise in Zoraidas süßlich sentimentaler Romanze im zweiten Akt „Rose, che un di spiegaste“, während die Cavatine im ersten Akt kaum über formelhafte Figuren hinausreicht. Dagegen ist der finale Rondo-Jubel des Ritters Abenamet wie eine Fortsetzung von Angelinas „Nacqui all’affanno“. Vermutlich hätten sich Cecilia Molinari und ihr kleiner leichter Mezzosopran in den Cenerentola-Regionen auch wohler gefühlt als in der Rüstung des Ritters, die eine ganz andere vokale Statur und letztlich auch darstellerische Präsenz verlangt. Zusana Markova sang mit sauberem Sopran und stabiler Höhe eine lyrisch verinnerlichte Zoraida, Kanu Kim war mit grell gellendem, fast charaktertenoralem Tenor, dem er Höhen abzwang, mit denen er Maries Tonio Konkurrenz machen könnte, ein finster wütender Almuzir. Der sehr junge Valerio Morelli überraschte in der Bravourarie des Ali zu Beginn des 2. Aktes mit einem gravitätischen Koloraturbass von Format, auf die Arie für die Nebenfigur Ines (Lilla Takács) hätte man gut verzichten können. Alberto Zenardi versuchte mit dem auf Originalinstrumenten spielenden Orchestra Gli Originale einen wachen Klang zu erzeugen, wurde aber von den langen Seccorezitativen ausgebremst. Es sängen die Herren des Coro dell’Accademia Teatro alla Scala. Regisseur Bruno Ravella hat das kriegerische Stück um die muslimischen Mauren in das muslimisch geprägte Sarajewo zur Zeit des Bosnienkrieges verlegt. Genauer in die Vijećnica, in der 1992 während der Belagerung zwei Millionen Bände und Dokumente der Geschichte Bosniens verbrannten. Die Bilder des in diesen Ruinen Cello spielenden Musikers gingen um die Welt. Den im neogotischen, pseudo-maurischen Stil errichteten Bibliotheksraum hat Gary McCann für die zwei Akte der Zoraida di Granata nachempfunden und Daniele Naldi manchmal so interessant beleuchtet, dass die über mehrere Etagen reichenden Säulenreihen und Kreuzgewölbe im Schattenspiel wie von Piranesi entworfen wirkten. Ravella hat das langweilige Geschehen entsprechend langweilig und schmucklos und ohne Bezug zum dekorativen Raum arrangiert. Am Ende – die Vijećnica wurde 2014 wieder rekonstruiert – senkt sich das Glasdach mit den wiederhergestellten bunten Ornamenten über den versöhnten Kriegern herab. Der Applaus für das Melodramma eroico war freundlich.
.

Bergamo Donizetti Festival 2024/Foto Gianfranco Rota/“Don Pasquale“/Szene
Nichts schiefgehen kann bei der letzten Produktion. Don Pasquale ist eine sichere Nummer (17. November). Amélie Niermeyer hat die Tragödie des alternden Mannes 2022 in Dijon, mit dessen Opéra das Dramma buffo koproduziert wurde, geschickt ins Heute geholt und ist den Figuren mit viel Gespür für menschliche Faiblesse auf den Leib gerückt. Die drei Akte spielen vor, neben und hinter Don Pasquales Flachbungalow von Maria-Alice Bahria, wo Pasquale auf der Terrasse vor der großzügig bestückten Bar und zwischen der weitläufigen Sitzlandschaft sportlicher und meditativer Selbstertüchtigung nachgeht und die drei Bediensteten Grünpflanzen abstauben und Getränke servieren. Der unwillige Neffe Ernesto wird aus diesem Paradies vertrieben und kampiert mit seinen Rollkoffern neben den Mülleimern auf der Rückseite des Hauses, wo im Dunkel auch eine Gestalt hockt, die das Trompetensolo zu seiner Arie spielen wird. Auf der anderen Seite hat es sich Norina in der Hoffnung, Ernesto werde seinen Onkel dazu bringen, die Einwilligung zu einer Heirat mit ihr zu geben, in ihrem kleinen roten Auto komfortabel und abrufbereit eingerichtet. In dieser Aufführung ist Norina die Drahtzieherin. Mit ihr und ihren kreischend bunten Freunden stürmen nach der Eheschließung mit Don Pasquale halluzinogene Farben in die saubere Villa der Lego- „Friends“-Welt –. „L‘amore è libero“, „L’amore non ha età“ sowie „L’amore non ha confini“ steht auf ihren Plakaten, womit Donizetti zur Freunde des künstlerischen Leiters einmal mehr seine gesellschaftliche Relevanz unter Beweis stellt. Und mitten drin ein pinker Elefant; man frage nicht, wieso und warum. Nichts wird Norina am Ende aufhalten, sich wieder hinters Steuer zu setzen, auf den gesicherten sozialen Aufstieg zu pfeifen und eine noch bessere Zukunft zu suchen. Niermeyer hat den Freiheitssinn der in grelle und enge Klamotten gewurstelten jungen Frau mit dem großen Herzen schön ausformuliert. Die junge Giulia Mazzola, die bereits in der Arena von Verona die Gilda gesungen hat, ist die rechte Interpretin für das vom benachteiligten Gör zur Ballprinzessin aufgestiegene Aschenputtel mit einem knackigen, reschen Sopran, ausgesprochen quecksilbriger Beweglichkeit, elegant aufblühenden Phrasen und gesanglichem Know-how und Timing, das die Komödie voran- und die Männer vor sich hertreibt. Dieser Sinn für Tempo und Szene fehlt noch dem Mexikaner Iván López-Reynoso, der sich als akkurater Sachwalter schwertat, das Orchestra Donizetti Opera und den Chor der Accademia della Scala zusammenzuhalten. Roberto de Candia ist ein gemütlicher, in sich ruhender Pasquale, der die große Attitüde wie den prägnanten Plappergesang souverän aus dem Ärmel schüttelt. Der Malatesta des Dario Sogos ist ein guter Typ, ein junger Arzt wie aus der Vorabendserie, der vor allem darstellerisch punktet und sich gesanglich noch einiges von dem Alten abschauen kann. Neu übrigens ist in der kritischen Ausgabe von Roger Parker und Gabriele Dotto, deren offizielle Veröffentlichung für 2026 geplant ist, eine erstmals seit 1843 gehörte Passage des Duetts Pasquale/ Malatesta. Den Ernesto singt Javier Camarena noch immer mit sämigem Ton, dessen Goldglanz in der Höhe etwas an Strahl eingebüßt und in der Tiefe an Glanz verloren hat, aber in der Serenata und dem anschließenden Notturno-Duett „Tornami a dir“ hinreichend sinnlichen Pianozauber verströmt. Rolf Fath
.
.
Teatro Regio di Parma: Festival Verdi 2024 mit dem französischen Macbeth sowie La Battaglia di Legnano sowie Un ballo in maschera in Busseto. Hier in Parma können Freunde von CDs und DVDs noch schwelgen. Das Angebot im Foyer des Teatro Regio ist überwältigend. Konzentriert selbstverständlich auf Verdi. Zum Auftakt des diesjährigen Festival Verdi stechen aus heimischer Produktion Macbeth mit Renato Bruson und Ghena Dimitrova ins Auge sowie mit Ludovic Tézier und Silvia Della Benetta. Letzterer als (so annonciert) World Premiere oft the original 1865 Version for Paris.
Im Pandemie-Jahr 2020 konnten die Aufführungen nur konzertant im Parco Ducale stattfinden, zum Auftakt des diesjährigen Festivals wird der französische Macbeth in szenischer Version nicht einfach nur nachgeholt, sondern erstmals szenisch präsentiert; der italienische Macbeth in der Fassung von 1847 stand zuletzt 2018 auf dem Programm. Wie 2020 dirigiert wieder Roberto Abbado, es spielen und singen die Filarmonia Arturo Toscanini und der Chor des Teatro Regio di Parma. Die Besetzung ist jedoch eine andere. Schön, dass der künstlerische Leiter Alessio Vlad, der im Vorjahr Anna-Maria Meo nachfolgte, die dem Festival zu hohem Aufmerksamkeit verholfen hatte, die französische Rarität nachholt, die sich gut an den französischen Le Trouvère in der Inszenierung von Robert Wilson anfügt. Der fand 2018 im spektakulären Ambiente des Teatro Farnese im Komplex des Palazzo Ducale statt. Auf eine derart einzigartige Lokalität kann Vlad nicht hoffen. Erneut weicht er für konzertante Aufführungen des Attila in das 2022 erstmals vom Festival genutzte Teatro Magnani nach Fidenza aus und selbstverständlich bespielt er mit Un ballo in maschera das Teatro Verdi in Verdis Wohnort Busseto.
Die größte Aufmerksamkeit richtet sich bei so viel braver Hausarbeit auf La Battaglia di Legnano, die in Parma zuletzt 2012 gegeben wurde, doch weltweit eine absolute Rarität geblieben ist. Während die Rarität mit geschicktem Kalkül wieder Valentina Carrasco anvertraut wurde, die vor zwei Jahren mit dem auf den Genueser Schlachthof verlegten Ur-Boccanegra von 1857 aufs Heftigste die Gemüter der Besucher erregt hatte, ging man mit Pierre Audi für Macbeth auf Nummer sicher. Wie die Senioren Pier Luigi Pizzi und Yannis Kokkos, die zuletzt die Eröffnungen betreuten oder die kaum jüngeren Hugo de Ana und Cesare Lievi zuvor, repräsentiert Audi einen zweckdienlichen, altmodischen Theaterstil.
Zum 24-mal findet das Festival Verdi statt, doch erst seit 2007 in der bei Touristen immer noch sehr beliebten Zeit von Mitte September bis Mitte Oktober, in die Verdis Geburtstag am 10. Oktober so praktisch fällt. Dann wird das Teatro Regio zum Zentrum der Stadt. Wobei das Festival seit Jahren weit in die Stadt und die Region reicht und mit einer karnevalsumzugsmäßigen Verdi Street Parade die Sammlung von hunderten Verdi Off-Veranstaltungen und Konzerten eröffnet. Nach den jungen Leuten und den obligaten Tanznummern ist es dann endlich so weit.

Der französische „Macbeth“ in Parma 2024/Szene/Foto Roberto Ricci
Macbeth bedeutete ein Wendepunkt in Verdis Schaffen. Hast und Atemlosigkeit, die das Werk durchdringen, strapazierten auch Verdis Gesundheit. Aufgrund eines extremen Erschöpfungs-Zustandes wurde ihm 1846 eine sechsmonatige Erholungspause verordnet, und im Macbeth-Jahr hatte er noch London mit den Masnadieri und Paris mit den zu Jérusalem umgearbeiteten Lombardi zu versorgen, doch dann ging er achtsamer vor. Es ist bekannt, wie intensiv sich Verdi ein Leben lang mit Shakespeare beschäftigte, den er für den Größten hielt, wie unzufrieden er im Hinblick auf Macbeth mit den Versen von Francesco Maria Piave war, wie intensiv er die Auswahl der Sänger betrieb, wie eingehend er an Details der Inszenierung feilte und mit den beiden Protagonisten arbeitete. Immer noch ein wenig unzufrieden mit dem bei der Uraufführung Erreichten, war das Angebot, das ihm Léon Carvalho im März 1864 aus Paris unterbreitete, nicht unwillkommen. Zu den Veränderungen und Modifikationen, welche die französische Bühne ebenso wie die neue Zeit erforderten, gehörten im Wesentlichen im zweiten Akt der Ersatz der altmodisch effektvollen Cabaletta „Trionfai“ der Lady durch ihren Monolog „La luce langue“ sowie am Ende des dritten Aktes der Ersatz der Macbeth-Cabaletta „Vada in fiamma“ durch das Macbeth-Lady-Duett „Ora di morte“. Dazu gehörten auch die Szene der Erscheinungen und das obligate Ballett im dritten Akt, der Anfang des vierten Aktes sowie auf Carvalhos Wunsch ein Schlusschor anstelle der Sterbearie „Mal per me che m’appressai“ des Macbeth, dessen Tod hinter die Bühne verbannt wird. Sicherlich eine Aufwertung der Lady, deren Schlafwandelszene zu den aufregendsten Momenten der ursprünglichen Fassung gehört und deshalb auch unangetastet blieb. Insgesamt ein Werk, das „wenn nicht zur Hälfte, so doch zu einem guten Drittel neu ist“, wie Verdi Tito Ricordi mitteilte. Die neuen Textpassagen verfasste Piave, wobei auch Strepponi und Verdi tätig wurden. Für Paris wurde alles von Charles Nuitter und Alexandre Beaumont ins Französische übertragen. 1874 gelangte diese Fassung an der Scala erstmals in italienischer Sprache zur Aufführung. Sie hat sich seither durchgesetzt.

Der französische „Macbeth“ in Parma 2024/Szene mit Ernesto Petti und Lidia Fridman/Foto Roberto Ricci
Bei den Verdi Festspielen in Parma wurde die „Versione francese, Paris 1865“ jetzt erstmals szenisch gespielt – konzertant, wie erwähnt, zuvor bereits 2020. Pierre Audis Inszenierung ist eine Verlegenheit, wie ich finde, wie es „Theater auf dem Theater“ immer ist, ein eleganter Trick. Natürlich erinnert das Phantastische, Übersinnliche, Geister- und Zauberhafte, das Verdi an Macbeth faszinierte, an Zutaten des französischen Theaters des 19. Jahrhunderts, wie sie Meyerbeer einsetzte, und die tanzenden Sylphen an die Pariser Opéra, doch Audi bleibt mit seiner Inszenierung in Parma, stellt das Logenrund des Teatro Regio auf die Bühne, dessen Seitenwände wie im Barocktheater im Handumdrehen Verwandlungen erlauben, so dass die Lady bereits auf die Bühne kommen kann, kaum dass die Hexen ihr Werk verrichtet haben und sich der Theaterraum schnell in eine rote Einheitsszene verwandelt, was die Rastlosigkeit der Handlung betont. Das ist alles richtig, aber auch ein bisschen arm. Alle Akteure sind in schwarzen strengen Kostümen der Zeit gekleidet, die Herren tragen Zylinder (Kostüme: Robby Duiveman). Dann kommt der Bruch mit dem dritten Akt, ab dem, wie wir gesehen haben, Verdi den Großteil seiner Ergänzungen und Änderungen anbrachte. Audi springt ins moderne Musiktheater. Er sprengt das historische Ambiente, bricht es mit irgendwie „modern“ anmutenden Linien. und Gitterwerk auf (Bühne: Michele Taborelli) und wirft Lady und Macbeth in moderne Gewänder über. Er macht aber dabei so, wie wenn der Macbeth erst ab der Hälfte der große Wurf wäre, der er eigentlich von Anfang an ist, wie Roberto Abbado in seiner peniblen und genauen Leseart darzulegen versucht. Er entwickelt die Story ganz vorsichtig, so als erzähle er sie Unkundigen zum ersten Mal. Tatsächlich klingt vieles sehr neu und frisch, auch stimmungsvoll, wobei Roberto nie die atemstockend nachtschwarze Intensität wie einst Onkel Claudio erreicht. Die Filarmonia Arturo Toscanini scheint nicht ganz mit der gewohnten Klangbreite zu spielen, während der Chor des Teatro Regio nicht nur wegen der betörenden Pianogesängen der Flüchtlinge gefeiert wurde. Lidia Fridmans Lady ist das lebendig gewordene Denkmal einer von Hass und Machtgier zerfressenen Frau, königlich, selbstbewusst und elegant. Mit dem opaken, in der Tiefe dunkel gewichtigen, in den engen Höhen scharfkantigen Sopran übernimmt sie sofort das Zepter, wobei Audi ihrem ersten Auftritt und der Cavatine „L’heure est prochaine“ viel ihrer Wucht nimmt, indem er Macbeth selbst den Brief lesen lässt, in dem die Lady von den Weissagungen erfährt, was in etwa so effektvoll ist, wie wenn Giorgio Gérmont selbst Violetta seinen Brief vorlesen würde und sie somit um das effektvolle Declamato bringen würde. Fridman macht alles sehr überzeugend und gut, doch nicht fesselnd, am besten sicherlich das Brindisi „Par toi, vin généreux“, dessen Feuer sie mit lodernder Brillanz und Kühle erfasst. Der Schlafwandelszene, die Fridman bis zum knappen D gut singt, nimmt Audi wieder viel von ihrer Eindruckskraft, indem er das lange Vorspiel und die Worte zwischen dem Doktor und der Comtesse vor den Vorhang legt und die gesamte Szene viel von ihrer atmosphärischen Magie einbüßt. Es fehlt mir bei der 28jährigen Fridman die Furor und Kraft dieser Figur, auch das stimmliche Durchhaltevermögen. Obwohl diese Fassung alles unternimmt, um die Lady ins Zentrum zu rücken, ist Macbeth die eindringlichste Figur. Ernesto Petti, der mich zuletzt in Stuttgart als Luna nicht wirklich überzeugenden konnte, agiert in Parma viel behutsamer und nachdrücklicher, er singt hier mit leisen und vor allem Zwischentönen und auffallend guter französischer Diktion, gestaltet bezwingende Steigerungen. Die Stimme des 38jährigen Baritons aus Salerno scheint nicht besonders riesig, aber sie packt durch Schönheit und Wärme, sie wird suggestiv eingesetzt, beispielsweise in der Szene mit den Hexen und Erscheinungen im dritten Akt, und obwohl Pettis Macbeths vorerst eine philosophische Dimension noch abzugehen scheint, ist in seinem Monolog im letzten Akt, „Honneurs, respect, tendresse“ großartig. Mit schütterem Bass, aber nobler Linie gab Michele Pertusi den Banquo, Luciano Ganci, dessen grelles Timbre man mögen muss, ist offenbar ein Publikumsliebling und wurde als Macduff nachdrücklich gefeiert. David Astorga, der Tenor aus Costa Rica, war als Macduff ein Gewinn und Rocco Cavalluzzi machte als Médecin nachdrücklich auf sich aufmerksam (26. September 2024).
.

„La battaglia di Legnano“ in Parma 2024/Szene/Foto Roberto Ricci
In keiner Oper hat Verdi sich so dezidiert für die Ideale des Risorgimento stark gemacht wie in La Battaglia in Legnano. Wie setzt man den patriotischen Impetus heute in Szene. Da kapituliert auch die findige Valentina Carrasco. Nach der langen Ouvertüre lässt sie zwischen Rauchwolken in kurzen Videosequenzen in die Augen von Rössern schauen und zeigt durch Matsch stampfende Soldatenbein. Im ersten Akt, mit „Er lebt“, überschrieben, erinnern die Mailänder Bürger und Soldaten des 12. Jahrhunderts stark an die Auseinandersetzungen mit den Habsburgern sechshundert Jahre später. Zu den Opfern der Schlachten und Kriege gehören auch Pferde, die ihren Herren arglos bis in den Tod folgen. Die unwissende Treue der Tiere rührt. Über der Leiche eines Schimmels schwören die Mailänder dem feindlichen Eroberer Rache. Der abgerissene Kopf des Pferdes, den Barbarossa den Stadtvätern von Como entgegenhält und der bis zum Ende der Aufführung auf dem Schlachtfeld liegenbleibt, wird zum Symbol für das zerrissene Land. Entworfen hat die Pferde, von denen zehn als Herde oder nebeneinander aufgereiht die Eyecatcher der Aufführung darstellen, die u.a. als Ronconi-Mitarbeiterin berühmte Margherita Palli. Die Pferde werden gestriegelt, versorgt und gefüttert. Hinter einem Maschendraht schwenkt Carrasco in der Mitte der Aufführung unmerklich aus dem Pseudo-Mittelalter in die Zeit des Ersten Weltkriegs mit den entsprechenden Helmen für die Soldaten und Gasmasken zum Schutz der Pferde.
Von den Opern der Galeerenjahre gehört La Battaglia di Legnano mit der Alzira und dem Oberto vermutlich zu den am selten aufgeführten und unbekanntesten Werken. Immerhin hat es nach 2000, als Domingo an Covent Garden in einer konzertanten Aufführung den Arrigo sang, einige wenige Produktionen in der italienischen Provinz, in Catania, Triest und Piacenza, gegeben; ich erinnere mich an eine von Pizzi hoch pathetisch in Szene gesetzte Produktion mit Mara Zampieri 1983 in Rom, wo die Oper im Januar 1849 auch erstmals über die Bühne gegangen war. Die Battaglia di Legnano ist Ehe- und Dreiecksdrama und patriotisches Gemälde, das den Geist der Aufstände, die seit Januar 1848 von Neapel aus über ganz Italien peitschten und in Mailand die Konfrontation mit den von Radetzky geführten Habsburgern suchten, in der mittelalterlichen Schlacht von Legnano spiegelt, in der Kaiser Barbarossa 1178 der von den lombardischen Städten gebildeten Liga unterlag. Diesem politischen Geist und den Rufen nach einer nationalen Einigung wollte Verdi, der die Ereignisse von Paris aus verfolgte, Rechnung tragen. Seltsam, dass er sich bei der Wahl des Librettos auf Salvatore Cammarano verließ, der ihm seine Inka-Oper Alzira verfasst hatte, die Verdi als „proprio brutta“ abgetan hatte. Cammarano hielt Verdi von einem Rienzi ab und stieß ihn auf die zu napoleonischer Zeit spielende Schlacht von Toulouse des gefälligen Joseph Méry, die er nach Legnano verlegen wollte. Legnano war inzwischen zum nationalen Symbol geworden, das sogar in Geoffredo Mamelis 1847 flugs geschriebenen Fratelli d’Italia Erwähnung gefunden hatte. Also letztlich die richtige Wahl. Am Puls der Zeit. Die Geschichte von dem Mailänder Heerführer Rolando, der im Veroneser Krieger Arrigo seinen totgeglaubten Freund erkennt, der in Gefangenschaft geraten war, und Arrigos einstiger Verlobten Lida, die mittlerweile Rolandos Frau ist, ist als Ehedrama relativ harmlos. Über Lidas Treuebruch ist Arrigo verletzt und schließt sich den Todesrittern an. Lida erfährt davon, bittet ihn um eine letzte Aussprache, die an Rolando verraten wird. Dieser schließt Arrigo im Turmzimmer ein, wodurch der Krieger nicht an der entscheidenden Schlacht teilnehmen kann. Arrigo erträgt diese Schmach nicht und stürzt sich mit dem Schrei „Viva Italia“ aus dem Fenster – Mit „Viva Italia. Ein heiliger Bund vereinigt alle Söhne des Landes“ hatte übrigens bereits der Auftrittschor begonnen. Arrigo überlebt, besiegt Barbarossa, wird aber tödlich verwundet. Diese letzte Begegnung des Arrigo mit seiner einstigen Geliebten findet bei Carrasco im Pferdestall statt, wo Arrigo von dem wütenden Rolando läppischerweise in eine Pferdebox gesperrt wird, aus der er im Handumdrehen entkommt. Der Rest ist ein pathetisches Tableau.
La Battaglia di Legnano hatte einen enormen Erfolg – anfangs musste der letzte Akt bei jeder Aufführung wiederholt werden – doch als Zeugnis einer konkreten Situation schwand ihre Bedeutung und Verbreitung nach 1870, um erst wieder zum 100. Jahrestag der Einigung Italiens 1961 an der Mailänder Scala ausgegraben zu werden. Mir erscheint Battaglia di Legnano wie eine Mischung aus dem Ehedrama Stiffelio und den patriotischen Choropern mit Prozession und Schwurszene („Giuriam d’Italia“) à la Lombardi, Ernani. Jede der drei Hauptfiguren ist bestens versorgt mit Cavatine und Romanze und wechselnden Duetten und Terzetten, die vor allem dem dritten Akt „L’infamia“/ „Die Schande“ eine dichte Struktur geben und nach der Preghiera der Lida in der Gran Scena „Vittoria! Vittoria!“ und dem Hymnus „Per la salvata Italia“/ „Bei der Rettung Italiens“ des sehr kurzen vierten Aktes (mit der Überschrift „Morire per la patria“) gipfeln. Der erst 28jährige Diego Ceretta geht das papierene Werk zu zögerlich an. Da fehlt trotz vieler instrumentaler Details der federnde Sound des frühen Verdi und ein wenig auch der mitreißende Elan seiner Chöre. Vielleicht fühlen sich Chor und Orchester des Teatro Comunale di Bologna auch nicht richtig wohl in Parma. Marina Rebeka war, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, als Lida der Mittelpunkt der Aufführung. Etwas kühl, doch mit technisch formidabel geführten Sopran und schönen silbernen Kern sang sie die Stretta ihrer Auftrittsarie mit Strahlkraft, gab den sprunghaften Linien der Lida eine Form und war bewegend in dem Gebet. Antonio Poli gab den Arrigo mit jungmännlichem Draufgängertum, schraubt die Stimme in der ersten Szene mit schmetternder Emphase und fein gehämmerter Diktion in die Höhe, dabei nicht unsensibel im zarten Flirt mit Lida. Zuverlässig, wie stets, zeigte sich Vladimir Stoyanov auch mit reduzierten Mitteln als großer Stilist und sang den Rolando mit weich geschmeidigem Bariton. Neben der prägnanten Arlene Miatto Albeldas als Imelda blieben Riccardo Fassi als Barbarossa, Alessio Verna als Intrigant Marcovaldo, Emil Abdullaiev und Bo Yang als Konsuln von Mailand unauffällig. Verlegener großer Beifall (29. September).
.

„Un ballo in maschera“ in Parma 2024/Szene/Foto Roberto Ricci
Verdi war froh, dass sein Ballo in maschera ebenfalls in Rom herauskommen sollte, nachdem ihm die Zensur in Neapel, für das die Oper ursprünglich geschrieben war, so viel Ärger bereitet hatte. Der Erfolg war groß und blieb dem Werk im gesamten 19. Jahrhundert treu und machte es zu einem der beliebtesten in Verdis Werkkanon. Als Fabio Biondi jetzt (27. September) die Aufführung im Teatro Verdi in Busseto dirigierte, war der immense Reichtum dieser Musik zu spüren, ihre Originalität, ihre Tiefe, mit der sie Figuren beschreibt und Situationen einfängt, der Wechsel zwischen Komik und Tragik, nicht zuletzt die Überfülle der Melodien. Der junge Mann neben mir wolle unbedingt wissen, welche mir die liebste aller Verdi Opern sei und bestand darauf, dass der Ballo die bei weitem Schönste sei. Biondi und das Orchestra Giovanile italiana legten mit Schärfe und Präzision die Nerven der Figuren bloß, zeigten die Mechanik der von Scribe ursprünglich eingefädelten Handlung und ihre gnadenlose Stringenz und entfesselten gleichzeitig ein Gesangstheater, das Sänger und Zuhörer im Lauf des Abends mehr und mehr mitriss. Die jungen Sänger, meist so um die 30, brauchten die stimulierende Geste des Dirigenten. Giovanni Sala, der Sänger mit der größten Bühenerfahrung, ist vermutlich kein Verdi-Tenor, dazu fehlt es an Squillo, doch wahrscheinlich ein sehr guter Mozart-Tenor. Die verzierten Passagen des Riccardo lagen ihm sehr schön, er gewann zunehmend auch an dramatischer Überzeugungskraft, an Elan und dunkler Färbung und gestalte die Partie locker tändelnd und packend. In einem größeren Haus würde das nicht so gut funktionieren. Lodovico Filippo Ravizza ist ein Stimmbesitzer, der das Publikum als Renato mit seiner selbstverständlichen Klangfülle im Sturm eroberte, Caterina Marchesini, die sich als Kammerfrau der Lady in Frankfurt demnächst erstmals auf eine deutsche Bühne vortastet und bereits Liu, Donna Anna und Mimi gesungen hat, ist eine helle energische, etwas unausgewogene Amelia mit schlanker und sehr sicher sitzender Höhe, Licia Piermatteo ein koloraturfeuriger Oscar und Danbi Lee eine dunkel orgelnde Ulrica von Format. Als Opernregisseur ist Daniele Menghini ein Zögling des Festivals, wo er seine ersten Schritte im Rahmen des Verdi Off-Programms machte und Assistent von Graham Vick und Jacopo Spirei war. Für den Tagträumer Riccardo haben Menghini und sein Ausstattet Davide Signorini eine Phantasielandschaft in seiner Bostoner Residenz erschaffen, in der alle Höflinge und Freunde das Spiel des Conte di Warwick und Gouverneurs mitmachen und nur der Richter, Tom und Samuel und sein ihn liebevoll schützender Freund Renato in offizieller Kleidung erscheinen. Das Leben ist ein Fest. Der Gouverneur schlüpft in Verkleidungen, trägt anfangs und am Schluss eine Robe wie eine Tudorkönigin und wirft sich für den Besuch bei der Wahrsagerin behände die Klamotten eines Fischers über. Entsprechend locker und ausschweifend geht es in der Residenz des Gouverneurs mit lasziven Jünglingen und lockenden Gestalten zu, der Thron wird zum Sarg und zum Schädelberg. In diese Mischung aus Grusel- und Horrorkabinett, Geisterbahn und Gothic-Party bringt der abschließende Ballo keinen zusätzlichen Kitzel. Menghinis Inszenierung, die im kommenden Jahr auch nach Bologna zieht, ist eine schwülstig überladene Zustandsbeschreibung, der es an Feinzeichnung fehlt. Rolf Fath
.
.
35. Musikfest Bremen 2024: Musikalische Sternstunden. Zu den gastierenden Künstlern, die zur Hansestadt eine enge Beziehung haben und seit 30 Jahren immer wieder zurückkommen, um im stimmungsvollen Konzertsaal Die Glocke aufzutreten, gehört Marc Minkowski, Träger des Musikfest-Preises Bremen von 2005. 2018 hatte er mit seinem Ensemble Les Musiciens du Louvre Offenbachs Opéra fantastique Les Contes d’Hoffmann zu einem aufregenden Musiktheaterabend gestaltet. In diesem Jahr widmete er sich Johann Strauß und dessen Hauptwerk Die Fledermaus, die vor 150 Jahren in Wien ihre Uraufführung erlebt hatte. Nach seinem irritierenden Hoffmann bei den diesjährigen Salzburger Festspielen erlebte man hier Minkowski at his best. Denn in Bremen stand er nicht vor den Wiener Philharmonikern, sondern vor seinem Orchester, das er 1982 gegründet hatte – den Musiciens du Louvre. Schon die Ouvertüre hatte Schmiss, Walzerseligkeit und eine rasante Steigerung am Schluss, war ein hinreißender Auftakt dieses Abends, der immer wieder Begeisterungsstürme beim Publikum entfachte. Die konzertante Aufführung hatte Witz, Spannung und Tempo – dank einer illustren Besetzung, die mit szenischen Aktionen und mimischen Gesten eine Bühnenatmosphäre zu suggerieren vermochte. Minkowski wartete nach dem schwelgerisch ausgebreiteten Ensemble „Brüderlein und Schwesterlein“ mit einer veritablen Überraschung auf, dirigierte als Einlage die „Russische Marsch-Fantasie“ von Strauß – eine Komposition von straffem Duktus und geballter Energie Und danach ließ er es sich natürlich nicht nehmen, auch die Polka „Unter Donner und Blitz“ zu bringen und dabei ein Feuerwerk an zündenden Klängen zu entfachen.

In Bremen: „Die „Fledermaus“/ Marc Minkowski,_Alina Wunderlin, Rachel Willis-Sørensen, Christoph Filler/ Foto ©Patric Leo
In der Besetzung gab es gesanglich keinen Schwachpunkt, lediglich die Wortverständlichkeit bei den gesprochenen Dialogen müsste bei einigen Interpreten verbessert werden. Dominierend war Rachel Willis-Sørensen als Rosalinde mit einem prunkenden Sopran von betörendem Timbre und satter Fülle. Hinreißend ihr Auftritt im 2. Akt mit einer silbern glitzernden, wie auf den Leib gegossenen Robe – das perfekte Outfit für ihre Darbietung des Csárdás, der vor Temperament sprühte und mit seiner Sinnlichkeit Aufsehen erregte. Sie leitete mit ihrem dominierenden Sopran auch das Schluss-Ensemble „Champagner hat´s verschuldet“ ein, dem der euphorische Beifall des Publikums folgte, was mit einem Da capo der Polka belohnt wurde. Ein stimmiger Kontrast zu ihr war Alina Wunderlin als quirlige Adele, die für ihre Couplets gefeiert wurde, die sie munter und koloraturgewandt servierte und mit Extremtönen schmückte. Glänzend der österreichische Bariton Christoph Filler als Eisenstein mit substanzreicher Stimme und einnehmender szenischer Präsenz. Ein Versprechen für die Zukunft gab der junge deutsche Tenor Magnus Dietrich ab. Sein Alfred strahlte in der Höhe, gefiel mit lebendigem Spiel und hatte auch keine Probleme, aus seiner Gefängniszelle Passagen des Lohengrin und Cavaradossi zu schmettern. Für Marina Viotti, die wegen eines Unfalls absagen musste, übernahm Annelie Sophie Müller den Orlofsky. Der strenge, androgyne Mezzo mit ordinären tiefen Tönen gab der Rolle en travestie glaubhaftes Profil. Dominic Sedgwick mit schmeichelndem Bariton als Dr. Falke, Michael Kraus mit autoritärem Bariton als Gefängnisdirektor Frank und der Wiener Manfred Schwaiger als Frosch ergänzten hochrangig die Besetzung (6. 9. 2024).
.

In Bremen: „Missa Solemnis“/René Jacobs, B’Rock Orchestra, Zürcher Sing-Akademie/ Foto (c) Joshua Krüger
Auch in diesem Jahr war das Musikfest wieder zu Gast in Orten der Umgebung, bespielte Kirchen, Schlösser und Museen, so am 5. 9. 2024 den prachtvollen Dom zu Verden an der Aller. Unter Leitung von René Jacobs erklang Beethovens Spätwerk Missa solemnis D-Dur op. 123. Der Dirigent, ist mit dem Werk, das er 2021 für harmonia mundi auch einspielte, eng vertraut, bot mit dem B´Rock Orchestra eine Interpretation von erhabener Größe, die sich bereits bei den ersten Takten des Kyrie ankündigte. Jacobs reizte die dynamischen Kontraste der Komposition bis zum Äußersten aus, betonte die Modernität der Musik, ihre avantgardistische Kühnheit. Der Einbruch des Chaos am Ende des Agnus Dei, wenn donnernde Fanfaren und Pauken eine kriegerische Atmosphäre suggerieren, war dafür ein treffliches Beispiel. Links und rechts neben dem Orchester war der geteilte Chor der Zürcher Sing-Akademie aufgestellt, womit eine enorme Klangfülle erzielt wurde. Machtvoll ertönte der Jubel im Gloria, gewaltig das Credo – eine Chorvereinigung der Sonderklasse.
Exzellent das Solistenquartett, angeführt von der Norwegerin Birgitte Christensen mit leuchtendem, auch in der Extremhöhe unangefochtenem Sopran. Mit herbem, doch potentem Mezzo kontrastierte Sophie Harmsen, obertonreich klang der Tenor von Thomas Walker und beschwörend der Bariton von Johannes Weisser in seinem Solo zu Beginn des Agnus Dei. Mit der „Bitte um innern und äussern Frieden“ (Beethoven) endete‚ das Werk. Nach gebührender Ergriffenheit des Publikums gab es Ovationen für alle Mitwirkenden, besonders für René Jacobs, der nach dem Konzert im Domherrenhaus zu Verden den Musikfest-Preis Bremen 2024 empfing. Bernd Hoppe
.
.
Salzburger Festspiele 2024: Morde aller Arten. Es ist eine lieb gewordene Tradition bei den Salzburger Festspielen, dass eine Produktion der Pfingstfestspiele in das Sommerprogramm übernommen wird. Cecilia Bartoli kann dadurch ihre Interpretation beim Pfingstfestival im Sommer wiederholen und vielleicht vertiefen. In diesem Jahr gab sie im Haus für Mozart ihr szenisches Debüt als Sesto in Mozarts La Clemenza di Tito – ein wenig spät, möchte man meinen, doch die Aufführung am 13. August 2024 bewies, dass ihre szenische Präsenz und das darstellerische Engagement noch immer genügend stark sind, um eine Figur glaubhaft zu vermitteln.

Daniel Behle sang den Tito in Salzburg 2024/Foto Marco Borelli
Dabei muss sie in dieser Inszenierung von Robert Carsen gar keinen pubertierenden Jüngling abgeben, denn der Regisseur behauptet in einem Einführungstext im Programmbuch, dass man in einer Zeit der Gendervielfalt Sesto und Annio nicht mehr als Hosenrollen behandeln könne. Beide sind nun als Frauen geführt, was zu zwei Paaren mit homoerotischen Neigungen führt. Ausstatter Gideon Davey freilich kleidet sie in Anzüge, was doch optisch dem klassischen Modell der Hosenrollen entspricht. Das Rezitativ vor „Parto, parto“ gestaltete Bartoli mit expressivem Furor, die große Aria selbst mit dunklem, gutturalem Ton und leidenschaftlicher Empathie. Noch immer funktionieren die Koloraturläufe perfekt, wie auch im Rondò „Deh, per questo istante solo“ zu vernehmen war. Dessen Schlussteil formulierte sie in höchster Erregung zu einem packenden Moment der Aufführung.
Die Inszenierung siedelt Carsen ganz im Heute an, was zum einem im Bühnenbild sichtbar wird, das einen grauen Sitzungssaal mit Schreibtischen, Fernsehmonitoren und Fahnen zeigt, von ihm und Peter Van Praet kalt ausgeleuchtet. Politiker im Business-Look mit Laptops und Smartphonen agieren geschäftig bis hektisch. Nach dem Brandanschlag auf das römische Kapitol zeigt die Szene ein Bild der Verwüstung. Unnötigerweise blendet Thomas Achitz noch aktuelle Videoaufnahmen vom Sturm auf das Gebäude in Washington ein. Schließlich verweist auch die Darstellung der Vitellia als Ebenbild von Giorgia Meloni auf heutiges Zeitgeschehen. Die französische Sopranistin Alexandra Marcellier singt sie mit Entschlossenheit und Nachdruck, steigert sich in ihrem Rondò „Non più di fiori“ zu großer Form mit durchschlagenden Spitzentönen und gefährlich-hintergründigem Ausdruck. Da der Regisseur das lieto fine des Werkes nicht umsetzen wollte, ist sie am Ende die Gewinnerin. Nach dem infamen Mord an Tito sitzt sie siegesbewusst auf dem Regierungssessel.

„La Clemenza di Tito“ in Salzburg 2024/Szene/Foto Marco Borelli
Glaubhaft und sympathisch besetzt ist das junge Paar mit Anna Tetruashvili als Annio und Melissa Petit als Servilia. Die israelische Mezzosopranistin lässt eine jugendliche Stimme von schöner Substanz und reizvollem Timbre hören. Die französische Sopranistin kann mit leuchtenden Tönen in ihrer Aria „S`altro che lagrime“ gegen Ende ds 2. Aktes gefallen. Prachtvolle tiefe Klänge mit imponierender Autorität bringt Ildebrando D´Arcangelo als Publio ein. Mit jedem noch so kurzen rezitativischen Einwurf zog er alle Aufmerksamkeit auf sich.
Die Aufführung adelte Daniel Behle als Titelheld mit idiomatischem, makellos geführtem Tenor. Die in ihrer Prägung sehr unterschiedlichen Arien absolvierte er souverän – „Del più sublime soglio“ mit bestechender Kultur, „Ah, se fosse intorno al trono“ mit viriler Attacke und glanzvollen eingelegten Spitzennoten, „Se all´impero“ mit beherztem Entschluss und perfekter Koloratur. Der Chor Il Canto di Orfeo (Einstudierung: Jacopo Facchini) sang klangvoll und engagiert. Das Orchester Les Musiciens du Prince – Monaco musizierte unter Gianluca Capuano mit Verve und Dramatik – von der martialischen Aggressivität in der Ouverture über die kühnen Dissonanzen beim Anschlag auf den kaiserlichen Palast bis zum furiosen Finale – eine Interpretation voller Sturm und Drang, die vom Publikum begeistert aufgenommen wurde.
.
Traditionell gibt es in jedem Jahr auch konzertante Opernaufführungen, welche sich beim Publikum großer Beliebtheit erfreuen wegen der oft selten zu hörenden Werke und der stets hochkarätigen Besetzungen. Eine solche war am 19. August 2024 in der Felsenreitschule bei Ambroise Thomas´ Oper Hamlet zu erleben. In der Titelrolle bewies der französische Bariton Stéphane Degout seinen Ausnahmerang in diesem Repertoire Sein Prinz war gezeichnet von grüblerischer Neurotik, meditativem Nachsinnen, existentieller Zerrissenheit und vehementen Ausbrüchen bis zur Raserei. Sein eloquenter, absolut idiomatischer Gesang mit einer prachtvollen, prägnant artikulierenden Stimme gipfelte im schwungvollen Trinklied („Ô vin, dissipe la tristesse“), der packenden Schilderung des Mordes und im Monolog „Être ou ne pas être“. Neben ihm glänzte die Amerikanerin Lisette Oropesa in der Bravourpartie der Ophélie. Längst kein Geheimtipp mehr, ist sie heute Star auf den Bühnen der Welt. Ihr melancholisch getönter Sopran mit flutenden hohen Tönen und herrlichen Steigerungen sorgte in der berühmten Wahnsinnsszene für eine mirakulöse Sternstunde. Barfuß mit entrücktem Blick und tieftraurigem Ausdruck ließ sie keinen Moment die Szene vermissen. Ihr makelloser Gesang mit perfekten Trillern und staccati, mit sicheren Tönen bis in die Extremlage endete in Verklärung, im Saal mit Jubelstürmen.

Ève-Maud Hubeaux sang die Königin Gertrude im „Hamlet“ in Salzburg 2024/ Foto Marco Borelli
Ein differenziertes Porträt von Hamlets Mutter Gertrude gab Ève-Maud Hubeaux. In herrscherlicher Attitüde der Königin, aber auch zerrissen als Mitschuldige am Tod ihres Gatten, faszinierte sie mit expressivem Vortrag ihres streng vibrierenden Mezzos. Spannend gestaltete sich die erregte Auseinandersetzung mit ihrem Sohn, in der sie mit dramatischer Vehemenz aufwartete. Jean Teitgen als König Claudius und Jerzy Butryn sorgten für profunde Basstöne, die von Clive Bayley als Spectre aus den Arkaden klangen gebührend fahl. Unbedingt erwähnenswert der französische Tenor Julien Henric als Laerte wegen seiner potenten Stimme und dem nachdrücklichen Vortrag.

Stéphane Degout sang den Hamlet in Salzburg 2024/ Foto Marco Borelli
Der Philharmonia Chor Wien (Einstudierung: Walter Zeh) imponierte schon im machtvollen Eingangschor, dann im großen Ensemble am Ende des 2. Aktes und im ergreifenden Finale der Oper. Bertrand de Billy ist ein Spezialist in diesem Genre, was er mit dem Mozarteum Orchester Salzburg einmal mehr bewies. Die Verve der Eingangsszene, das schwermütige Motiv bei Hamlets erstem Auftritt, die düsteren Stimmungen in der Szene mit dem Geist von Hamlets Vater, die festlichen Rhythmen beim abendlichen Fest – den ganzen Reichtum der Musik brachte der Dirigent zum Klingen. Im diesjährigen Gesamtkonzept der Festspiele überraschte diese Werkwahl zwar, doch erwies sie sich – gemessen an den langen stehenden Ovationen des Publikums – als ein Geschenk.
.
Morde aller Arten (2): Eine der zentralen Neuproduktionen des Festspielsommers war die Inszenierung von Mieczyslaw Weinbergs Oper Der Idiot in der Regie von Krzysztof Warlikowski in der Felsenreitschule. Der Pole, Stammgast in Salzburg, sorgte in der Vergangenheit für diverse Eindrücke an der Salzach. Mit dieser Arbeit gelang ihm ein durchschlagender Erfolg, weil er sich mit manieristischen Eigenwilligkeiten zurücknahm, sich ganz auf die Titelfigur, Fürst Myschkin, konzentrierte, der sich wegen seines naiven Charakters, seines Glaubens an das Gute im Menschen in der verlogenen Gesellschaft von St. Petersburg fremd fühlt. Der polnische Komponist vertonte 1986/87 das Libretto von Alexander Medwedew nach Fjodor Dostojewskis Roman, 1991 wurde das Werk in einer Kammerversion in Moskau uraufgeführt. Erst 2013 folgte die erste szenische Realisierung der kompletten Fassung in Mannheim, die der 1996 verstorbene Komponist nicht mehr erlebte.

Szene aus Weinbergs „Idiot“/ Foto Bernd Uhlig
Ausstatterin Malgorzata Szczesniak, regelmäßige Mitstreiterin des Regisseurs, verwandelte die archaische Felsenreitschule in einen holzgetäfelten Raum mit einer roten Sitzgruppe auf der rechten Seite, die als Zugabteil fungiert, wo Myschkin auf der Heimreise aus einem Sanatorium in der Schweiz Ragoschin und Lebedjew kennenlernt. Ersterer erzählt ihm von seiner leidenschaftlichen Zuneigung zu der unter schlechtem Ruf stehenden Nastassja, Letzterer entpuppt sich in Folge als Kommentator der Geschichte. Ragoschins und Nastassjas Welt ist in einer kleinen Kammer zur Linken angesiedelt, die mit Ikonen und Folklore-Stickerei geschmückt und von einem Schleiervorhang verschlossen ist. In der Mitte befinden sich eine Projektionsfläche und eine Wandtafel, auf der vorüberziehende Landschaften (während Myschkins Zugreise) sowie Formeln von Einstein und Newton zu sehen sind. Der Regisseur deutet den Titelhelden auch als Wissenschaftler von vergeistigter, zarter Natur und Bogdan Volkov gelingt eine ideale Verkörperung dieser Figur. Er zeichnet einen Träumer, einen Idealisten, der nicht an das Böse im Menschen glaubt – der Regisseur sieht in ihm gar eine Christus-Figur. Beklemmend ist die Darstellung des epileptischen Anfalls im 3. Akt mit schonungsloser naturalistischer Deutlichkeit. Sein lyrischer Tenor mit potenter hoher Lage hält allen Anforderungen des groß besetzten Orchesters stand – insgesamt eine festspielwürdige Leistung. Myschkin steht emotional zwischen zwei Frauen – Ragoschins Geliebte Nastassia, die er glaubt retten zu müssen, und Aglaja, eine der drei unverheirateten Töchter der verwandten Familie Jepantschin. In ersterer Partie errang Ausrine Stundyte nach ihrer gefeierten Salzburger Elektra einen weiteren großen Erfolg. Der durchschlagende dramatische Sopran der litauischen Sängerin meistert die hohen vokalen Anforderungen staunenswert und darstellerisch zeichnet sie die Figur plastisch im Konflikt zwischen ihrer seelischen Verletzlichkeit und der leidenschaftlichen Natur. Szczesniak hat sie mondän gewandet bis zu einem rosa Ensemble aus Seide, Federn und Pelz. Die australische Mezzosopranistin Xenia Puskarz Thomas gibt die Aglaja mit hellem Mezzo als emanzipierte junge Frau. Entsprechend vehement gestaltete sich ihre Konfrontation mit Myschkin im 3. Akt nach ihrem eher schlichten Lied vom „Armen Ritter“. Am Ende tötet Ragoschin Nasstassja und legt sich gemeinsam mit Myschkin auf ihr Totenbett – eine intime Szene der besonderen Art. Vladislav Sulimsky singt ihn mit markigem Bariton und zeichnet ihn als düstere, hintergründige Figur. Auch die mittleren Rollen sind glänzend besetzt – mit dem ukrainischen Bariton Iurii Samoilov als skurrilem Lebedjew, dem Tenor Pavol Breslik als Ganja und Margarita Nekrasova mit sattem Alt als Jepantschina.
Die litauische Dirigentin Mirga Grazinyté-Tyla, erfahren mit Weinbergs Musik durch die Leitung der Passagierin am Teatro Real Madrid und die Einspielung von Werken des Komponisten, dirigiert die Wiener Philharmoniker mit großem Gespür für die reichen Facetten der Musik – ihre schneidenden Akzente, die nervösen Passagen und die zarten Lyrismen. Die Aufführung am 15. August 2024 wurde mit Ovationen bedacht – ungewöhnlich bei einem so unbekannten Werk, aber ein deutliches Zeichen für die Qualität der Aufführung.
.
Mit Spannung erwartet wurde die letzte szenische Neuproduktion der diesjährigen Festspiele – Offenbachs Les Contes d´Hoffmann im Großen Festspielhaus, hatte es bei den Festspielen doch schon gefeierte Inszenierungen mit Plácido Domingo und Neil Shicoff gegeben. Der neue Titelheld Benjamin Bernheim ist ein exemplarischer Interpret im französischen Repertoire mit feinem, kultiviertem Tenor und idiomatischem Gebrauch der voix mixte. Die lyrische Stimme wirkt freilich in der Mittellage etwas schmal und kommt im Giulietta-Akt, besonders im Duett mit der Kurtisane, deutlich an ihre Grenzen. Als Ärgernis hat die französische Regisseurin Mariame Clément den Dichter zu einem Filmproduzenten gemacht, der seine drei Liebesgeschichten verfilmt. Nervend sind seine permanenten Anweisungen für die Akteure, seine genervten Reaktionen auf deren Unvermögen, seine Ideen umzusetzen. Ausstatterin Julia Hansen hat auf die Bühne ein Filmstudio mit Gerüsten und einer hohen schäbigen Wand gestellt. Hoffmann in Jeans und Blouson liegt alkoholisiert unter einem Einkaufswagen, in dem sich Filmrollen und Kameras befinden. Aus einer Mülltonne steigt die Muse, die Hoffmann als Nicklausse begleitet und ihn am Ende aus seiner Depression befreit. Kate Lindsey singt die Doppelrolle mit schmalem Mezzo von unsinnlichem, jaulendem Klang. Erst das Chanson „C´est l´ amour“ erklingt in schönem Fluss.

Salzburger Festspiele 2024/ Jacques Offenbach /“Les Contes d‘ Hoffmann“/Foto Monika Rittershaus
Hoffmanns erster Film kreist um die Puppe Olympia, die als Barbarella mit blonden Zöpfen und Schulranzen im Schottenröckchen dargestellt ist. Unter ihrer Bluse verbirgt sich ein Bustier von silbernem Metall, was der Figur einen Sciene-Fiction-Anstrich gibt. Die amerikanische Sopranistin Kathryn Lewek brilliert in dieser Partie vor allem mit virtuosen staccati und Tönen bis in die Extremhöhe.
Als Antonia in einem Biedermeier-Salon mit Treppenaufgang und Damenporträts an der tapezierten Wand überrascht sie mit zarter Lyrik und innigem Ausdruck. Im Duett mit ihr wechselt Hoffmann vom Regisseur zum Darsteller des Liebhabers. In dieser Doppelfunktion ist er immer wieder zu sehen, was die Grundidee der Regisseurin in Frage stellt. Überraschend lässt sie am Ende des Antonia-Aktes nicht die Sängerin sterben, sondern Hoffmann nahe einem Herzinfarkt in den Armen von Nicklausse zusammenbrechen. Stimmig inszeniert ist der Gesang von Antonias Mutter, den spontan eine Regie-Assistentin (Géraldine Chauvet) übernimmt. während ihr Gemälde an der Wand aufleuchtet. Marc Mauillon in den vier Charakterpartien tönt hier als tuntiger Frantz nach pointiertem Beginn penetrant.
Nichts von venezianischer Pracht ist im Giulietta-Akt zu sehen, stattdessen die Rückseite der hohen Wand, versehen mit Neonröhren. Korrespondierend unerotisch klingt die Barcarolle zwischen Nicklausse und Giulietta. Dabei sorgt Lewek mit dem später voller Raffinement und vokaler Brillanz vorgetragenen Chanson „L´amour lui dit“ aus der Fassung von Michael Kaye und Jean-Christophe Keck für ein musikalisches Glanzlicht. In diesem Akt bringen herum geisternde Statisten mit Riesenaugen einen surrealistischen Effekt ein, während Christian Van Horn, der alle vier Bösewichte gibt, als Dr. Miracle und Dapertutto mit Hörnern und Schwanz ein konventionelles Mephisto-Klischee abgeben muss. Der amerikanische Bassbariton singt eine andere Fassung der „Diamanten“-Arie, seiner Stimme fehlen die dämonische Färbung und die Wandelbarkeit für die verschiedenen Charaktere. Im Duell tötet Hoffmann Schlemil (Philippe-Nicolas Martin) und trifft statt Giulietta, von der er sich betrogen sieht, noch ihren Vertrauten Pitichinaccio. Zuletzt sieht man ihn wieder an seinem Einkaufswagen, aber zum Glück sorgt die Muse für keinen so tristen Ausgang der Geschichte.
Wie Mariame Clément enttäuscht auch Marc Minkowski, dem es mit den Wiener Philharmonikern nicht gelingt, den Esprit der Musik einzufangen und eigene Akzente zu setzen. Mit seinen Musiciens du Louvre und in einem kleineren Haus hätte er wohl ganz anderer Klänge hören lassen. Ein großes Ensemble („Nur die Liebe macht uns groß“) beschließt die Inszenierung, die bei der Premiere noch umstritten war, am 21. August 2024 aber begeistert aufgenommen wurde. Bernd Hoppe
.
.
Fanbo und Pesaro. Il Bel Canto Ritrovato 2024 (über das wir in operalounge anlässlich der Gründung berichteten): Highlights von Lauro Rossi und Nicola Vaccaj. Das Opernfestival Il Bel Canto Ritrovato (IBR), das nun schon zum dritten Mal stattfindet, folgte auch in diesem Jahr dem Rossini Opera Festival in Pesaro und Umgebung. Das ROF schloss seine Pforten mit einer konzertanten Aufführung von Il viaggio a Reims am 23. August, und das IBR wurde am nächsten Abend im nahe gelegenen Fano mit Lauro Rossis Oper La casa disabitata eröffnet . In diesem Jahr stehen zwei Komponisten aus den Marken auf dem Programm, die beide eine enge Beziehung zu Pesaro haben: Lauro Rossi, der im nahe gelegenen Macerata geboren wurde, und Nicolai Vaccaj, der in Tolentino geboren wurde, aber lange Zeit in Pesaro lebte, wo sein Haus noch immer steht, nur einen Häuserblock von der Casa Rossini entfernt. Das Festival umfasste zwei Hauptveranstaltungen: eine szenische Aufführung von Rossis Oper im Teatro della Fortuna in Fano am 24. August und ein Vokalkonzert mit Orchester mit Auszügen aus längst vergessenen Vaccaj-Opern im Teatro Rossini in Pesaro am 25. August.

Il belcanto ritrovato Pesaro: Intendant, Gründer und Organisator Rudolf Colm/ Foto IBR
Auch andere Veranstaltungen standen auf dem Programm: „Il Buffo all’Opera“, ein interessantes Konzert mit komischen Stücken aus Opern von Rossi, Ricci und anderen aus dieser Zeit, das in Urbino und später in Pesaro aufgeführt wurde, und „I Marchigiani alla Scala“ mit Auszügen aus Opern von märkischen Komponisten (Federico, Vaccaj, Rossi, Nini, Rossini und Salieri) in der Scala. Kurze Konzerte auf den Balkonen der Casa Rossini und der Casa Vaccaj sowie wissenschaftliche Vorträge über die Komponisten waren ebenfalls Teil des Festivals.
Zu seiner Zeit galt La casa disabitata als das Meisterwerk von Lauro Rossi. Der in Macerata geborene Rossi (1810-1885) hatte 1829 kurz nach Abschluss seines Studiums in Neapel debütiert und bereits zehn Opern komponiert, als La casa disabitata am 16. August 1834 nach einem Libretto von Jacopo Ferretti an der Scala uraufgeführt wurde. Es war ein großer Erfolg und Rossi überarbeitete es etwa zehn Jahre später unter dem Titel I falsi monetari für Aufführungen in Turin. Die Oper war viele Jahre lang weit verbreitet, bis nach Spanien und sogar nach Mexiko, wo sie von einer von Rossi selbst geleiteten Truppe aufgeführt wurde. Es war die von Damiano Cerutti herausgegebene Fassung von 1844, die zum ersten Mal in der Neuzeit in Fano wiederaufgeführt wurde, obwohl man sich für den ursprünglichen Titel La casa disabitata „ ( Das unbewohnte Haus“) entschied, da dieser Begriff für die Handlung zentraler ist als der andere Titel Die Fälscher“.

Lauro Rossis Oper „La casa disabitata“ beim IBR 2024 in Fano/ Foto IBR
Ferrettis Handlung für La casa disabitata geht weit zurück, bis hin zu Plautus‘ altrömischer Komödie Mostellaria, in der der schlaue Sklave Tranio den Besitzer eines Hauses davon überzeugt, dass es in dem Gebäude spukt, damit Tranios Herr darin ungestört eine Affäre mit seiner Freundin haben kann. In Ferettis Libretto, das direkt auf einem Theaterstück von Giovanni Giraud (Rom, 1808) basiert, geht es um einen wohlhabenden Spanier, Don Raimondo Lopez, der sechs Jahre zuvor sein Haus auf der Suche nach seiner Geliebten Annetta verlassen hat, die auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Während er auf der Suche nach ihr war, wurde das Haus von einer Bande von Fälschern übernommen, die von Don Isidoro angeführt wird, der auch Raimondos wichtigster Domo ist. Isidoro hat Annetta entführt und hält sie im Haus gefangen, um sie dazu zu bringen, ihn zu lieben, da er sich in sie verliebt hat. Um die Neugierigen fernzuhalten, haben Isidoro und seine Männer verbreitet, dass es in dem Haus spukt. Raimondo kehrt von seiner Suche zurück und findet Don Eutichio und seine Frau Sinforosa auf dem Marktplatz neben dem Haus. Eutichio ist ein verarmter Dichter/Librettist, der gerade zusammen mit Sinforosa aus seiner Wohnung geworfen wurde, weil er die Miete nicht zahlen kann. Raimondo bietet sein Haus mietfrei für jeden an, der dort wohnen kann. Eutichio beschließt, das Angebot anzunehmen, trotz des schaurigen Rufs und obwohl seine eifersüchtige (und ältere) Frau vermutet, dass er das Haus für eine Affäre mit einem Mädchen nutzen will.
Im 2. Akt befindet sich Eutichio im Haus, als Mitternacht naht. Die als Gespenster und Dämonen verkleideten Fälscher quälen ihn, bis er schließlich vor Angst zusammenbricht. Annetta, der es endlich gelungen ist, aus ihrem Gefängnis zu entkommen, betritt das Zimmer und weckt versehentlich Eutichio, der sie für ein Gespenst hält. Sie hat ihn gerade davon überzeugt, dass sie aus Fleisch und Blut ist, als Sinforosa hereinplatzt; sie glaubt, dass Eutichio und Annetta eine Affäre haben, und es kommt zu einem Zickenkrieg zwischen den beiden Frauen. Isidoro kommt als Geist verkleidet herein und wird von Eutichio erschossen. Raimondo, der schon die ganze Zeit ruchlose Machenschaften vermutet hat, trifft ein und sieht seine geliebte Annetta. Am Ende wird alles gut: Die „Geister“ werden entlarvt, Annetta und Raimondo werden vereint und Eutichio und Sinforosa versöhnen sich.
 Die Musik ist ein wahrer Strom von eingängigen, italienischen Melodien. Isodoro und Annetta singen in der Eröffnungsszene beide Romanzen, er sanft („Amo sprezzato, ed ardo“), sie trotzig („Aprirò fra voi la scuola“). In der nächsten Szene ist ein Marktchor mitreißend und Raimondo hat eine brillante Arie mit Cabaletta. Eutichio und Sinforosa stellen sich in einem komischen Duett vor, gefolgt von einem Quartett. Annetta singt in ihrem Gefängnis eine unwiderstehliche „Canzone alla spagnola“, gefolgt von einem lebhaften Duett mit Isidoro, bevor das große Concertato-Finale des 1. Im 2. Akt gibt es ein großartiges Duett zwischen dem misstrauischen Raimondo und dem verräterischen Isidoro, gefolgt von einer langen, lustigen Szene und Arie für Eutichio, der versucht, sein Libretto für einen neuen Don Giovanni nach „modernem“ Geschmack zu überarbeiten und dabei von den „Geistern“ gequält wird. Ein lustiges Duett mit der entflohenen Annetta wird zum Trio, als Sinforosa auftaucht, voller Eifersucht und Bosheit, und alles endet mit dem fröhlichen Finaletto. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses fröhliche Finale aus der Partitur von 1834 oder aus der Revision von 1844 stammt, aber es klingt sehr nach dem Finale von Don Pasquale (1843). Zufall? Eine Reminiszenz?
Die Musik ist ein wahrer Strom von eingängigen, italienischen Melodien. Isodoro und Annetta singen in der Eröffnungsszene beide Romanzen, er sanft („Amo sprezzato, ed ardo“), sie trotzig („Aprirò fra voi la scuola“). In der nächsten Szene ist ein Marktchor mitreißend und Raimondo hat eine brillante Arie mit Cabaletta. Eutichio und Sinforosa stellen sich in einem komischen Duett vor, gefolgt von einem Quartett. Annetta singt in ihrem Gefängnis eine unwiderstehliche „Canzone alla spagnola“, gefolgt von einem lebhaften Duett mit Isidoro, bevor das große Concertato-Finale des 1. Im 2. Akt gibt es ein großartiges Duett zwischen dem misstrauischen Raimondo und dem verräterischen Isidoro, gefolgt von einer langen, lustigen Szene und Arie für Eutichio, der versucht, sein Libretto für einen neuen Don Giovanni nach „modernem“ Geschmack zu überarbeiten und dabei von den „Geistern“ gequält wird. Ein lustiges Duett mit der entflohenen Annetta wird zum Trio, als Sinforosa auftaucht, voller Eifersucht und Bosheit, und alles endet mit dem fröhlichen Finaletto. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses fröhliche Finale aus der Partitur von 1834 oder aus der Revision von 1844 stammt, aber es klingt sehr nach dem Finale von Don Pasquale (1843). Zufall? Eine Reminiszenz?
Der Chor hat in dieser Oper viel zu tun und die verschiedenen Ensembles sind noch köstlicher als die Soli, die Orchestrierung ist solide und interessant. Klingt es nach jemand anderem? Nicht wie Rossini, gelegentlich wie Donizetti, aber es ist wahrscheinlich sicherer zu sagen, dass Rossi und Donizetti in diesem Stadium ihrer Karriere wie der jeweils andere klingen. Rossi hat jedoch seine eigene Stimme, die eher der neapolitanischen Popoloresco-Seite Donizettis ähnelt, als seiner eher formalen Stimme. Diejenigen, die die CD-Aufnahme von Rossis Il domino nero gehört haben, werden wissen, was ich meine. Rossis Musik hat sich sicherlich mit der Zeit entwickelt, wie Aufführungen seiner späten Cleopatra (1876) in dem nach ihm benannten Theater in Macerata vor einigen Jahren gezeigt haben. Aber es ist sein Hang zur Komödie und zur eingängigen Melodie, den wir hier haben, und wahrscheinlich auch in einigen anderen komischen Opern dieser Zeit wie Dottor Bobolo, o la fiera (1847) – eine Oper, die ich gerne aufgeführt sehen würde.
Die IBR-Produktion in Fano war aus musikalischer Sicht erstaunlich gut. Enrico Lombardi leitete das Orchestra Sinfonica G. Rossini mit absoluter Klarheit und Prägnanz in einer völlig unbekannten Partitur, für die das Orchester (und der Chor), die im Rahmen des Rossini-Festivals intensiv an Opern gearbeitet hatten, nur wenig Zeit zum Einstudieren hatten. Mirca Rosciani, die Chordirektorin, verdient ein ebenso großes Lob, denn diese Oper enthält viel Chormusik. Obwohl spezielle Fernsehmonitore aufgestellt wurden, um dem überlasteten Chor zu helfen, sich an seinen Text zu erinnern, schienen sie dies nicht zu brauchen und spielten und sangen als Dorfbewohner, Fälscher, „Geister“ und „Dämonen“.

Pressevorstellung des Festivals IBR 2024/IBR
Auch die Hauptsängerinnen und -sänger leisteten Außergewöhnliches bei der Aufführung dieser unbekannten Musik. Tamar Ugrekhelidze zeigte einen attraktiven Mezzosopran, besonders in den spanischen Rhythmen ihrer „Canzone alla Spagnolo“ im ersten Akt, und Vittoriana De Amicis hatte einen präzisen und brillanten Koloratursopran für die Sinforosa, obwohl sie Jahrzehnte jünger aussah (und ist), als die Sinforosa eigentlich sein sollte. Jennifer Turri war eine kecke Ines, mehr oder weniger die Leadsängerin des Chores. Antonio Mandrillos solider Tenor war in seiner Arie mit Cabaletta und in den vielen Ensemblestücken ein starker Trumpf. Das Gleiche gilt für Matteo Mancini als mürrischer Isidoro. Vielleicht am besten von allen war Giuseppe Toia als Don Eutichio, der mittellose Dichter. Er schauspielerte gut, besser als die anderen, und sang hervorragend in der Buffo-Rolle. Martin Csölley als Alberto rundete die Besetzung ab. Tatsächlich gab es unter den Sängern kein schwaches Glied, wie es bei fortgeschrittenen Schülern oft der Fall ist. Wie das Orchester und der Chor hatten sie nur wenig Zeit zum Proben, und die Oper enthält mehrere wirklich komplexe Ensemble-Nummern. Bravissimi an sie alle.
Die einfache Inszenierung stammt von Cristina Pietrantonio. Es gab Hintergrundprojektionen in Schwarz und Weiß, die von den Studenten der Sezione Audiovisivi e Multimedia des Liceo Artistico Mengaroni in Pesaro entworfen wurden. Die Kostüme waren eine Mischung aus historischer und zeitgenössischer Kleidung, und die Fälscher verwandelten sich mit Hilfe von dunklen Schleiern über ihren Gesichtern in Geister. In einer Szene brachten sie große Luftballons mit aufgemalten Augen an Stöcken hervor. Titelkarten, wie sie für Stummfilme verwendet wurden, wiesen auf die Szenen hin. Es war einfach, aber wirkungsvoll. Die Sängerinnen und Sänger haben meist nicht viel gespielt. Ich glaube, sie hatten ihre Augen oft auf den Dirigenten gerichtet, was auf die Unbekanntheit der Musik und den Mangel an Probenzeit zurückzuführen ist. Toia’s Eutichio und manchmal De Amicis‘ Sinforosa waren die Ausnahmen. Ferretti, der auch die Libretti für Rossinis Cenerentola und Mathilde di Shabran schrieb, hat hier ein sehr lustiges Libretto verfasst, und die Inszenierung nutzte das komödiantische Potenzial nicht immer aus. Mit mehr Probenzeit oder erfahreneren Sängern, oder beidem, wäre La casa disabitata ein sehr komisches Werk. Die brillante musikalische Leistung wird jedoch zu gegebener Zeit zu einer CD (von Bongiovanni) führen, die für alle Belcanto-Liebhaber ein Muss ist. (Die CD der letztjährigen Bel Canto Ritrovato-Oper, Riccis Il birraio di Preston, wurde gerade veröffentlicht und ist ebenfalls ein Muss für Belcanto-Liebhaber).
********

Der Komponist Nicola Vaccaj/ Wikipedia
Der andere Schwerpunkt des diesjährigen Festivals war das Werk von Nicola Vaccaj, und die Aufführung, mit der Vaccaj gefeiert wurde, war ein Konzert mit sehr seltenen Auszügen aus seinen Opern, dargeboten von einer Phalanx feiner Sänger und wiederum dem Orchestra Sinfonica G. Rossini unter der Leitung von Daniele Agiman, der auch der künstlerische Leiter des Festivals ist. Beim Betreten des Konzertsaals, des Teatro Rossini in Pesaro, fielen dem Publikum die beiden gemalten Medaillons auf dem Bühnenvorhang auf, die von Angelo Monticelli anlässlich der Eröffnung des Hauses im Jahr 1818 (mit Rossinis La gazza ladra unter der Leitung des Komponisten selbst) gemalt worden waren. Die gemalten Medaillons zeigen Rossini in einer Ecke und Vaccaj in der anderen. Vaccaj (1790-1848) war zwei Jahre älter als Rossini; ihre Eltern waren befreundet und die Jungen wuchsen zusammen auf. Zu der Zeit, als das wieder aufgebaute Opernhaus eingeweiht wurde, galten beide als wichtige Söhne der Stadt. Heute ist das Porträt Vaccajs verblasst und verschwommen – auf dem Vorhang wie in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Konzert am 25. August stand unter dem Titel „Nicola Vaccaj, Profilo d’Autore“. Es gab großzügige Ausschnitte aus sieben von Vaccajs achtzehn Opern, die einen Zeitraum von 1816 bis 1838 umfassen: Malvina (1816), La Pastorella feudataria (1824), Zadig ed Astartea (1825), Giovanna d’Arco (1827), Giovanna Gray (1827), Saladino e Clotilde (1828) und Marco Visconti (1838).

Vaccajs Portrait rechts unten auf dem historischen Abschluss-Vorhang im Teatro Rossini Pesaro/Wikipedia
Seine berühmteste Oper, Giulietta e Romeo, war nicht unter den ausgewählten Werken, vielleicht weil sie in der Neuzeit (in Jesi) aufgeführt und aufgenommen wurde. Die Musik hat eine klassische Zurückhaltung mit Anklängen an Bellini. Es ist erstaunlich, dass die meisten dieser Werke beim Publikum durchfielen. Dies gilt nicht für das Duett Presso un ruscello limpido“ aus Pastorella feudataria, das in der Tat eine schöne, klare Melodie mit Harfeneinleitung und -begleitung aufweist. Die Buffo-Arie aus Malvina war wie viele solcher Arien aus Rossinis frühen, für Venedig komponierten Farcen , und diese Oper (die scheiterte) war Vaccajs Versuch, auf dem venezianischen Markt Fuß zu fassen. Alle Stücke zeigen die volle Beherrschung der Techniken der damaligen Zeit, sowohl für die Sänger als auch für das Orchester. Nicht weniger konnte man vom Autor des „Metodo Pratico di Canto Italiano“ erwarten, das Vaccaj während seines Aufenthalts in England schrieb, wo er auf Opernaufträge gehofft hatte, die nicht zustande kamen. Dieses didaktische Werk, das noch heute von Sängern verwendet wird, ist wahrscheinlich Vaccajs wichtigster Beitrag zur Oper.
 Il Bel Canto Ritrovato hatte vier hervorragende Sängerinnen und Sänger, um dieses Material zu untersuchen: Laila Alamanova (Sopran), Marta Pluda (Mezzosopran), Brayan Avila Martinez (Tenor) und der berühmte Bruno De Simone (Bariton). De Simone, ein Veteran vieler Komödien des Rossini-Festivals, verankerte die jungen Sänger, die alle außergewöhnlich stark und gut vorbereitet waren. Pluda hat einen ansprechenden Mezzo, reichhaltig und mit makelloser Technik ausgestattet; Alamanovas Sopran ist solide und volltönend von oben bis unten, und auch sie ist eine Meisterin der feinen Koloraturtechnik. Martinez war ebenfalls gut, und natürlich ist De Simone in jeder Hinsicht ein Profi.
Il Bel Canto Ritrovato hatte vier hervorragende Sängerinnen und Sänger, um dieses Material zu untersuchen: Laila Alamanova (Sopran), Marta Pluda (Mezzosopran), Brayan Avila Martinez (Tenor) und der berühmte Bruno De Simone (Bariton). De Simone, ein Veteran vieler Komödien des Rossini-Festivals, verankerte die jungen Sänger, die alle außergewöhnlich stark und gut vorbereitet waren. Pluda hat einen ansprechenden Mezzo, reichhaltig und mit makelloser Technik ausgestattet; Alamanovas Sopran ist solide und volltönend von oben bis unten, und auch sie ist eine Meisterin der feinen Koloraturtechnik. Martinez war ebenfalls gut, und natürlich ist De Simone in jeder Hinsicht ein Profi.
Es war ein Genuss, und der Applaus des großen Publikums war lang und anerkennend. Bongiovanni hat das Konzert aufgezeichnet, und es wird eine CD davon geben, ebenso wie von der Rossi-Oper.
.
Il Bel Canto Ritrovato bezeichnet sich selbst als „Festival Nazionale“, aber es ist ein zunehmend internationales Festival, das sich sowohl an ein lokales als auch an ein internationales Publikum richtet. Es basiert auf der Prämisse, dass italienische Komponisten etwa zwischen 1790 und 1850 eine enorme Anzahl lyrischer Werke schufen, um ein gefräßiges Publikum anzusprechen. Das Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses riesige und vergessene Repertoire zu erforschen und jedes Jahr ein oder zwei ehemals populäre Werke ans Tageslicht zu bringen oder ein neues Licht auf Komponisten zu werfen, die im Vergleich zu Verdi oder Rossini „unbedeutend“ sein mögen, aber reizvolle Werke komponiert haben, die es nicht verdienen, in Archivregalen zu verstauben. Dies ist eine praktisch unerforschte Schatztruhe des mächtigen italienischen künstlerischen Erbes, die nicht ignoriert werden sollte, und dank des IBR wird der Deckel dieser Truhe nun angehoben. Charles Jernigan/ Übersetzung DeepL
.
.
Giacomelli Giulio Cesare beim Festival für Alte Musik Innsbruck 2024: Opernstoffe aus der römischen Geschichte sowie „exotische“ Schauplätze waren im 18. Jahrhundert vor allem in der Handelsrepublik Venedig – deren Kaufleute ständig mit fremden Kulturen in Kontakt kamen – äußerst beliebt, wobei sich das ägyptische Sujet als außerordentlich populär erwies. Die Liebesgeschichte zwischen Julius Caesar und Kleopatra (die aus Makedonien stammte und somit Griechin aus dem früheren Imperium Alexanders des Großen war) wurde bereits in den Schriften der antiken Historiker Plutarch und Sueton erwähnt und war dem venezianischen Publikum bereits gut bekannt. Sie wurde unzählige Male von Librettisten bearbeitet und von Komponisten vertont, unter anderem auch von Geminiano Giacomelli.

Geminiano Giacomelli/ Wikipedia
Der heute fast vergessene Komponist (geboren am 28. Mai 1692 in Piacenza, gestorben am 25. Januar 1740 in Loreto) hat etwa 10 Jahre nach Georg Friedrich Händels „Masterpiece“ seinen „Cesare in Egitto“ herausgebracht. Giacomelli schuf ungefähr zwanzig Opern, Pasticci, Arien und Intermezzi für verschiedene italienische Städte.
Bis vor einiger Zeit war Geminiano Giacomelli nur wenigen Kennern der Barockoper ein Begriff. Doch in den letzten Jahren hat die Musik dieses zu Lebzeiten hochgeschätzten Komponisten, der regelmäßig für die größten Häuser Italiens und die bedeutendsten Gesangsvirtuosen seiner Generation schrieb, eine bemerkenswerte Renaissance erlebt, sowohl auf der Konzertbühne als auch in Gesangsrezitals und Einspielungen.
Zu seiner Biografie: 1727 wurde Giacomelli auf ausdrücklichen Wunsch des Herzogs Francesco Farnese auf Lebenszeit zum Kapellmeister von San Giovanni in Piacenza ernannt. Dazu erhielt er das Vorrecht, nach Belieben abwesend zu sein, sofern er für eine Vertretung sorgte und Kompositionen lieferte. Außerdem war er Kapellmeister am Hofe von Parma, ausserdem an der dortigen Kirche San Giovanni della Steccata sowie später Kapellmeister an der Kirche Santa Casa in Loreto, wo er auch starb.
Uraufgeführt wurde Giacomellis „Cesare“ 1735 als Karnevalsoper im Teatro Regio Ducale in Mailand, dann wurde die Oper schon im November desselben Jahres im Teatro San Giovanni Crisostomo in Venedig, nachgespielt. Es folgten Florenz, Graz und Verona.
Die Vorstellungen der Oper am venezianischen Teatro San Giovanni Crisostomos schienen besonders erfolgreich gewesen zu sein. Schon in zeitgenössischen biografischen Artikeln zu Giacomelli wird „Cesare in Egitto“ als eines der Meisterwerke des Komponisten hervorgehoben. Von Venedig verbreitete sich das Werk in ganz Europa.
Giacomellis wachsender Ruhm als Opernkomponist ermöglichte Giacomelli zahlreiche Reisen und Tätigkeiten auch nördlich der Alpen. So war er 1737 Theaterdirektor in Graz, wo er unter anderem Aufführungen seines schon damals recht populären “Cesare“ aufführte.
Auch wenn Domenico Lalli offiziell als Librettist des „Cesare“ gilt, darf vermutet werden, dass verantwortlich für viele textliche Details und Arientexte, kein anderer als der junge, aufstrebende Carlo Goldoni war. Am Teatro San Giovanni Crisostomo war Goldoni Lallis Assistent, daher wurde Goldonis Arbeit an den Textbüchern nicht einmal mit einer eigenen Signatur gewürdigt. „Cesare in Egitto“ ist mit dem Namen Domenico Lalli unterzeichnet, ohne Erwähnung Goldonis. Dieser scheint jedoch damit völlig einverstanden gewesen zu sein.
Unter dem Motto „Wohin kommen wir? Wohin gehen wir“ steht vom 21. Juli bis 30. August 2024 die Wiederaufführung der Oper „Cesare“ von Geminiano Giacomelli auf dem Programm des diesjährigen Festivals Alter Musik in Innsbruck, dessen finanzielle Verhältnisse erfreulicherweise als stabil gelten dürfen. Ottavio Dantone hat Giacomellis Oper für seine erste szenische Produktion als neuer Musikalischer Leiter der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik auserkoren. Eine an sich begrüßenswerte Ausgrabung eines vergessenen Werks.
Man spielt allerdings nicht die Kritische Ausgabe von Holger-Schmitt Hallenberg., der gleichwohl einen gelehrten Essay im Programmheft beisteuert, sondern eine Kritische Ausgabe von Bernardo Ticci und Ottavio Dantone nach der Uraufführungsversion von Venedig 1735. Als Librettisten werden ausdrücklich Carlo Goldoni und Domenico Lalli genannt. Dantone nennt das dreiaktige „dramma per musica“ schlicht „Oper“.
Er wolle „die Emotionen der damaligen Zeit ins Heute übersetzen“, so erklärte der Italiener seine künstlerische Programmatik. Dass sei eben etwa durch die Reduzierung der Spieldauer möglich. Damit gelinge „eine Anpassung an die heutigen Gegebenheiten.“ Tatsächlich dauert die Aufführung „nur“ drei Stunden, doch die werden lang! Dantone erklärte vorab: „Unser Ziel ist es, dem Publikum die stärksten Empfindungen erlebbar zu machen, die Wahrnehmung von Raum und Zeit aufzuheben und sie in eine ferne und dennoch gegenwärtige Ära mitzunehmen.“
Die Inszenierung von Leo Muscato, der sein Debut in Innsbruck gibt, löst dieses Versprechen nur bedingt ein. Er verlegt die Handlung in das augenscheinlich schon muslimisch besetzte Ägypten, die Herren Ägypter tragen den klassisch arabisch-türkischen Fez (in blau) zu sandfarbenen Uniformen. Die Leibgarde des ägyptischen Hofes trägt moderne rote Kampfanzüge und Helme, die Kalaschnikows stets im Anschlag. Die Herren fuchteln in Machopose mit Pistolen herum, oder sie rennen von einem Raum der aus altägyptischen Tempelruinen bestehenden Drehbühne in den nächsten.
Im Hintergrund fünf römische rote Krieger mit geschlossenen Helmen als Kolossalstatuen. Während der Ouvertüre stehen sie an der Rampe.
Bei den vielen Arien verharren die Sänger meistens in theatralischer Starre. Die Kostüme (Giovanna Fiorentini) sind zeitlos modern, vor allem die der Damen. Cesare, der von einer Frau gesungen wird, was die erotische „Sache“ nicht sehr glaubwürdiger macht, trägt einen roten Kampfanzug, Cleopatra indifferente Damengewandung mit Turban. Alle altägyptischen Erwartungen in Kostümierung (wie Dekoration) werden Lügen gestraft.

Geminiano Giacomellis“Giulio Cesare“ beim Festival für Alte Musik Innsbruck 2024/ Foto Birgit Gufler
Ob die nicht wirklich einsichtige Aktualisierung geeignet ist, eine „Anpassung an die heutigen Gegebenheiten“ zu vermitteln oder gar „dem Publikum die stärksten Empfindungen erlebbar zu machen, die Wahrnehmung von Raum und Zeit aufzuheben und sie in eine ferne und dennoch gegenwärtige Ära mitzunehmen,“ sei dahingestellt. Gewiss zeigt das bewegte, leicht variierte Bühnenbild von Andrea Belli immer wieder schöne Momente, zumal in stimmungsvoller Beleuchtung von Alessandro Verazzi, aber die Aufführung ist weitgehend statisch, spannungslos, um nicht zu sagen langweilig. Die Personenführung ist weitgehend konventionell, von Personenpsychologie kann kaum geredet werden, allerdings enthält das (deutsch übertitelte) Libretto auch wenig individuelle Charaktere, verbleibt weitgehend stereotyp und reichlich pathetisch. Worthülsen statt Emotionen. Eine gefühllose Staatsaktion. Wie überwältigend anders kommt Händels (und seines Librettisten Nicola Francesco Hayms) „Giulio Cesare“ daher. Und selbst Carl Heinrich Grauns “Cesare e Cleopatra“ ist um Vieles lebendiger, überzeugender, weniger klischeehaft, gefühlsechter und auch – last not least – musikalisch interessanter, ja faszinierender.
Von seinen Zeitgenossen wurde Giacomelli sowohl als Opernkomponist als auch als Gesangslehrer hochgeschätzt. Es gelang ihm, wie Benedetto Marcello im siebten Brief seines „Estro poetico-armonico rühmte, „seine Werke optimal an die Fähigkeiten der jeweiligen Sänger anzupassen. Gleichzeitig hatte er ein starkes Gespür für die Bedürfnisse des Theaters und eine schlichte traditionelle Tonsprache, durch die er große Popularität erlangte. Seine Melodien wirken weich, spontan und kantabel. Sie sind dem Zeitgeschmack entsprechend mit Vokalisen und Koloraturen Gespür für die Bedürfnisse des Theaters und Modulationen belebt.“ Das mag schon sein, aber die Bedürfnisse des Theaters wie des Publikums, die Hörgewohnheiten und die Erwartungen an die Oper. waren zu Giacomellis Zeiten eben andere als heute.
Giacomellis Vertonung des „Cäsar“-Stoffs hält dem uns vertrauten Händelschen Vorbild jedenfalls nicht stand. Er erreicht das psychologische Einfühlungsvermögen Händels nicht, auch wenn er sich bemüht, einen präzisen Blick auf die Seelenzustände seiner Protagonisten in Töne zu setzen. Doch die Arien seiner Protagonisten sind eher hochvirtuos als persönlichen oder gar gefühlvoll. Man kann sie bewundern, aber man wird von ihnen nicht berührt.
Giacomellis schon zu seinen Lebzeiten sowohl in der Gesangslinie als auch im genau durchgearbeiteten Orchestersatz als anspruchsvoll geltende Musik, akzentuiert die Persönlichkeitszüge häufig mit großen Intervallsprüngen, expressiven Dissonanzen, synkopierten Akzenten und einer oft imitierenden, selbständigen zweiten Violinstimme. Anspruchsvoll kann man seine Musik wohl nennen, (uns heute affizierende) Gefühlstiefe ist ihr fremd.
Ottavio Dantone und seine Accademia Bizantina bemühen sich redlich, nach Maßgabe der historisch informierten Aufführungspraxis die Reize der Musik Giacomellis, das ihr Eigene und Besondere zu Gehör zu bringen. In der dreiteiligen, recht rasant genommenen Ouvertüre hörte sich das noch vielversprechend an, doch im weiteren Verlauf des Abends machte die Musik einen immer drögeren Eindruck, gar nicht zu. Nicht zu reden von den vielen, langen Rezitativen

Geminiano Giacomellis“Giulio Cesare“ beim Festival für Alte Musik Innsbruck 2024/ Foto Birgit Gufler
Vor allem das (bei Händel) so Flirrende, das erotisch Bezaubernde Cleopatras vermisst man. Sie wird im Libretto als eiskalte, ehrgeizige Machtpolitikerin gezeichnet, die nur Eines im Sinne hat: Das römische Imperium an sich zu reißen. Ihre Liebe zu Cäsar ist lediglich strategisch und berechnend. Wenn überhaupt, ist die Rolle der Cornelia „sympathisch“ gezeichnet, obwohl auch sie eine selbstsüchtige Politikerin ist, die ihre Rolle im rücksichtslosen und grausamen Machtpoker des Stücks spielt, in dem die Frauen die dominanten Persönlichkeiten sind und Cäsar eher eine „milde“, weshalb das Stück auch mit einem „lieto fine“ endet.
Die sängerische Besetzung der Aufführung ist – zumal auf weiblicher Seite – vorzüglich, bei den männlichen Partien gab es hingegen Licht und Schatten: Die Sopranistin Arianna Vendittelli singt einen anständigen, wenn auch (naturgemäß) wenig „männlichen“ Giulio Cesare. Die Mezzosopranistin Emöke Baráth singt eine hochvirtuose, aber keineswegs einschmeichelnde oder gar betörende Cleopatra, Königin von Ägypten und Schwester des Tolomeo. Die sängerischen Höhepunkte des Abends sind der Altistin Margherita Maria Sala zu verdanken, die eine beeindruckende Cornelia, Witwe des Pompeo singt. Der Tenor Valerio Contaldo leiht Tolomeo, König von Ägypten seine Stimme. Der Sopranist Federico Fiorio singt den römischen Senator Lepido, Liebhaber der Cornelia, den Achilla, General des Tolomeo der Countertenor Filippo Mineccia. Alles in allem eine respektable, aber nicht gerade mitreißende Reanimierung. Dieter David Scholz
.
.
Familienangelegenheit: Luigi Riccis Chi dura vince in Neuburg an der Donau. Die Neuburger Kammeroper in Neuburg an der Donau, einem malerischen Städtchen an der Donau, ist vielleicht nicht über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt, aber sie spielt jeden Sommer für ein paar Wochenenden in dem exquisiten, winzigen Stadttheater aus dem Jahr 1869. Es werden eine zweiaktige Oper oder manchmal zwei einaktige Opern aufgeführt, die immer komisch sind. Sie werden auch immer auf Deutsch aufgeführt, unabhängig von der Originalsprache, und mit gesprochenen Dialogen. Außerdem handelt es sich immer um sehr ungewöhnliche Werke aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die man sonst nirgendwo zu hören bekommt. Im Jahr 2019 haben Peggy und ich zwei Einakter von Ferdinand Hérold gesehen, L’Auteur Mort et Vivant und Le muletier. In diesem Jahr war die Oper von Luigi Ricci, eine italienische Komödie in zwei Akten, die im Original Chi Dura Vince heißt, oder Eine Rosskur in der modernen deutschen Übersetzung von Annette und Horst Vlader. Es handelte sich um die 56. Aufführung des Festivals, das 1969 begann.

Luigi Ricci: „Eine Rosskur“ in Neuburg an der Donau/Szene/Foto Kammeroper Neuburg
Chi Dura Vince bedeutet „Wer ausharrt, gewinnt“, und der deutsche Titel lautet wörtlich „Eine Rosskur“, was eine drastische Heilung bedeutet, ein Ein-Wort-Ausdruck der englischen Idee „it will make you well if it doesn’t kill you first“. Das Libretto von Jacopo Ferretti ist eine Version der Geschichte, die Shakespeare in Der Widerspenstigen Zähmung “ verwendet hat , mit einigen Buffo-Bässen, die die Geschichte über eine zänkische Ehefrau, die sich der Pferdekur“ unterzieht, auflockern. Der Graf Sanviti hat eine junge, aber verarmte Adelige namens Fiorina geheiratet, die er als hochmütig, kapriziös und geradezu gemein empfindet. Er hat sie während der Flitterwochen im Stich gelassen, um seinen Plan für eine „Heilung“ zu verfolgen, indem er sich zunächst als Bauer verkleidet, der eine Stelle auf einem Schloss bekommt, das er selbst gerade gekauft hat. Das Schlossgut wird von zwei Taugenichtsen verwaltet, Gennaro, dem Aufseher, und Giovanni, der auf dem Gut eine Hutmacherei betreibt (in unserer Produktion ein Weingut). Als Fiorina eintrifft und sich über alle Einheimischen hinwegsetzt (auch über Biagio, den Chef der örtlichen Polizeibrigade), ist sie schockiert, als sie erfährt, dass sie keinen Grafen geheiratet hat, sondern jemanden, der auf den Ländereien des Grafen arbeitet. Wut und Abscheu verwandeln sich im zweiten Akt in Entsetzen und Eifersucht, als sie glaubt, ihr Mann wolle sie zugunsten einer neuen Liebe verlassen, nämlich der Baronin Galeotti (die in Wirklichkeit die Schwester des Grafen Sanviti ist). Die Eifersucht lässt sie erkennen, dass sie ihren Mann wirklich liebt, der sich praktischerweise als der echte Graf entpuppt, und die Geschichte endet mit einem fröhlichen Walzerlied.
Der meiste Spaß in der Oper entsteht nicht durch die Geschichte der Verwechslungen und Missverständnisse, sondern durch die Possen von Gennaro und Giovanni und ihre Begegnungen mit der Gräfin Fiorina. Sie überwinden bald ihr Erstaunen über ihre hochmütige Behandlung und geben so viel zurück, wie sie bekommen. Eine der besten Nummern der Partitur ist das Buffo-Duett „Ser Gennaro…Ser Giovanni/Quante pene, quanti affanni“ im zweiten Akt. Ein Genuss ist auch Gennaros eröffnende Buffo-Nummer „Ehi plebe! Volgo! Sudditi!“, in der er sich über die Bauern lustig macht, während diese ihn verspotten. Die Baronin, die zum ersten Mal im zweiten Akt auftaucht, ist auch mit von der Partie, aber sie ist die „seconda donna“, und als solche hat sie in der Originalpartitur keine eigene Arie. Also haben die Neuburger zur Bereicherung ihrer Rolle Musik interpoliert, und zwar aus (wie man mir sagte) Riccis Il birraio di Preston, das letztes Jahr beim Festival Il Bel Canto Ritrovato in Pesaro aufgeführt wurde.

Federico und Luigi Ricci /Wikipedia
Luigi Ricci hatte zusammen mit seinem Bruder Federico am Konservatorium von Neapel studiert, und zwar unter der Leitung von Vincenzo Bellini, der als Seniorstudent eine Art Assistent des Absolventen war. Auch Luigi begann seine Karriere dort mit L’impresario in angustie (1823), der ersten von etwa dreißig Opern, die er schreiben sollte, einige davon in Zusammenarbeit mit seinem Bruder. Seine erfolgreichsten Werke scheinen komisch gewesen zu sein. Acht von ihnen entstanden in Zusammenarbeit mit Jacopo Ferretti, einem römischen Geschäftsmann aus der Tabakindustrie, der nebenbei Libretti schrieb, darunter das für Rossinis La Cenerentola. Ferretti hatte eine klassische Ausbildung genossen und kannte die Möglichkeiten von Missverständnissen und Verwechslungen aus den Farcen des Plautus. Dieses Wissen nutzte er in Chi Dura Vince, dessen Untertitel La Luna di Miele – Die Flitterwochen lautet, was sicherlich ironisch gemeint ist, denn die Flitterwochen der Sanvitis sind alles andere als das.
Chi Dura Vince wurde 1834 in Rom uraufgeführt. Es erlebte eine rege Aufführungsgeschichte und wurde lange nach Luigis Tod (1859) von Luigi Riccis Bruder Federico überarbeitet und 1876 in Paris als La petite comtesse wiederaufgeführt. Die Musik ist immer melodiös und voluminös und manchmal unvergesslich. Je mehr wir von den Brüdern Ricci (und vor allem von Luigi) hören, desto mehr verstehen wir, dass ihr Werk eine Brücke zur leichten Oper und zur Operette des späteren neunzehnten Jahrhunderts bildet. Die leichte Orchestrierung hat Operettenqualität, und die meisten Rollen sind technisch nicht so schwierig wie die Opernrollen der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Die Brüder Ricci wirken wie ein Bindeglied zu Franz von Suppé und zu den Strauss-Brüdern. Die abschließende Walzernummer „Ah! Che al brillar dell’iride“ ist nicht nur fröhlich und einprägsam, sie ersetzt auch das kunstvolle Cabaletta- oder Rondo-Finale, das früher diesen Ehrenplatz einnahm.
Diese Opern waren dafür gemacht, in kleinen und Provinztheatern und gelegentlich auch in großen Häusern gespielt zu werden. Sie eignet sich perfekt für die intimen Räumlichkeiten des Neuburger Stadttheaters und das Gemeinschaftsgefühl der Aufführungen, bei denen Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung im Chor singen, die Bühnenbilder bauen, die Kostüme nähen oder sogar einige der Hauptrollen übernehmen – oder die Regie übernehmen. Das ganze Unterfangen hat etwas Familiäres: Chormitglieder in Kostümen mischen sich unter das Publikum und verkaufen vor der Aufführung Programme, und die Darsteller mischen sich in der Pause unter das Publikum. Viele von ihnen sind Nachbarn, die ihre Nachbarn unterhalten.
Selbst die Hauptsopranistin, die Gräfin Fiorina (im italienischen Original Elisa genannt), Da-yung Cho, ist in Wien geboren und aufgewachsen, obwohl die Familie aus Korea stammt. Ihr heller Sopran wäre sowohl für die Operette als auch für die Oper geeignet, und ihre Technik war sicher. In dem kleinen Saal funktionierte alles perfekt, und ihr Schauspiel war perfekt. Frau Da-yung Cho hat schon früher in Neuburg gearbeitet und ist Teil der Familie. Patrick Ruyters war ebenfalls ein Volltreffer und ein fähiger Farceur als Gennaro. Seine Baritonstimme ergänzte den Giovanni von Michael Hoffmann, der seit vielen Jahren an der Neuburger Kammeroper engagiert ist. Horst Vlader (Biagio) ist einer der Gründungsväter des Neuburger Ensembles und trägt seit Jahrzehnten mit seinen vielen Talenten zum Erfolg des Ensembles bei, auch als Comprimario. Der polnische Tenor Karol Bettley spielte die Rolle des Grafen. Seine Stimme würde vielleicht besser zur musikalischen Komödie oder Operette passen, aber egal, er war großartig auf der Bühne. Das Gleiche gilt für Martha Harreiter als Baronin; ihr Charme auf der Bühne übertraf ihre kleine Stimme.
Alois Rottenaicher leitete das 28-köpfige Orchester, Horst Vlader führte mit sicherer Hand Regie und Michele Lorenzini entwarf einfache, funktionelle Bühnenbilder.
Kurzum, man könnte die Aufführung oder die Sänger kritisieren, aber warum? Es ist am besten, wenn man die Mitglieder der Familie nicht kritisiert. Außerdem sind Opernhäuser, die Werke von Luigi Ricci aufführen, selten, und Werke, die so ungetrübtes Vergnügen bereiten, sind viel lohnender als eine weitere Regieversion von Tosca. Die Neuburger Kammeroper folgt dem Libretto und es gibt kein Konzept, das nichts mit dem Werk zu tun hat. Die Brüder Ricci gehörten zu einer großen Gruppe von Komponisten, Librettisten und Interpreten, die das Publikum in einer Zeit unterhielten, in der die Oper eine der wichtigsten Formen der Unterhaltung war. Das ausverkaufte Publikum im Jahr 2024, das größtenteils aus der Region stammte, verließ das Haus glücklich und gut unterhalten, mit dem letzten Walzerlied im Kopf, genau wie 1834 in Rom. Was ist daran falsch? Charles Jernigan, 27./28. Juli, 2024/Übersetzung DeepL
.
.
Kammeroper Schloss Rheinsberg – in stimmungsvoller Kulisse. Der Komponist Niccolò Piccinni war Italiener, lebte und starb jedoch in Paris. Dort gab es den berühmten Komponistenstreit zwischen ihm und dem Reformer der Oper Christoph Willibald Gluck, ausgefochten zwischen den Anhängern der beiden. Sonst aber ist der italienische Meister heute so gut wie vergessen. Umso verdienstvoller das Bemühen der Kammeroper Rheinsberg, ihn nach 222 Jahren erneut aufzuführen, denn in Rheinsberg war das Werk zuletzt 1802 im Schlosstheater zu hören. Das Festival ist bekannt dafür, sich vergessener Werke anzunehmen – ein Verdienst des Künstlerischen Leiters Georg Quander, der auch zu interessanten Kombinationen in den Programmen findet. In diesem Jahr stellte er unter dem Motto „Der Schatten Trojas“ Glucks Iphigenie in Aulis Piccinis Didon gegenüber. Viele Komponisten haben den Stoff vertont, man denke nur an Purcell, Hasse und Berlioz. Piccinnis Librettist Jean-François Marmontel fokussiert die Handlung auf die wenigen Tage, in denen sich Énée entscheidet, Didon zu verlassen, um in Italien Rom zu gründen.

Zu Piccinnis „Didon“: der bezaubernde Spiwelort, der Innenhof des Schlosses Rheinsberg/Kammeroper Rheinsberg
Piccinnis Musik ist voller Esprit, reich an melodischen Eingebungen und delikat instrumentierten Zwischenspielen, wird bestimmt von tänzerischem Duktus, der die französischen Konventionen befolgt, nach denen große Chor- und Tanztableaus obligatorisch waren. Der Klang der Akademie für Alte Musik Berlin unter Bernhard Forck entfaltete sich im Schlosshof Rheinsberg, wo das Werk in französischer Sprache halbszenisch aufgeführt wurde (Regie: Andreea Geletu), zauberhaft und wunderbar transparent. Preisträger des Internationalen Gesangswettbewerbes der Kammeroper übernahmen die Partien und legten durchweg Ehre ein, angeführt von Noemi Bousquet in der Titelrolle, die mit größtem Einsatz und leidenschaftlicher Darstellung das Schicksal der Königin packend verkörperte. Ihr farbiger, substanzreicher Sopran ließ schon bei „Venez, enfant des Dieux“ im 1. Akt durch lyrische Delikatesse aufhorchen. Selbstbewusst und mit flammenden Tönen lehnt sie das Werben des feindlichen Königs Yarbe ab, empfindsam und mit leuchtenden Obertönen singt sie „Ah! Que je fus bien inspirée“ im 2. Akt. Herzzerreißend versucht sie mit „Vous la savez“ Énée in seinem Plan, sie zu verlassen, umzustimmen. Emotional völlig aufgewühlt formt sie das erregte „Non, ce n´est plus pour moi“ zu Beginn des 3. Aktes, ergreifend das „Prend pitié de ma faiblesse“. Am Ende wechselt ihr Gefühlszustand in Raserei, mit „Je veux mourir“ nimmt sie Didons Szene in Berlioz` Tragédie vorweg.
Chen Li lässt als Énée einen hellen, durchschlagenden Tenor hören und bewältigt die. exponierte Partie souverän. Spannend schildert er in „Au noir chagrin“ seinen Konflikt zwischen der Liebe zu Didon und dem Auftrag der Götter. Mit Didon hat er mehrere Duette, die von resolutem Zuschnitt sind und von den beiden Sängern eindringlich geformt werden.

Piccinnis „Didon“ in Rheinsberg 2024/Szene/Foto Uwe Hauth
Der Bariton Yiwei Mao als Yarbe gestaltet sowohl die noblen als auch die vehementen Soli beeindruckend. Das Vokalsystem Berlin absolviert in Konzertkleidung (Leitung: Johannes Wolf) seine Auftritte markant, so das energische „Aux armes“ am Ende des 2. oder lärmende „Victoire!“ zu Beginn des 3. Aktes, wenn die Karthager siegreich aus dem Krieg gegen Yarbe und die Numidier zurückkehren. Grandios die Schilderung der Naturgewalten („Les éléments troublé“) und erschütternd das Finale („O Ciel!“), wenn die Karthager die tote Didon betrauern und mit Hass und Aggressivität den Trojanern ewige Rache schwören. Das Publikum in der zauberhaften Kulisse des Schlosshofs feierte auch in dieser 3. Aufführung am 28. 7. 2024 alle Interpreten begeistert. Bernd Hoppe (ein ausführlicher Artikel zur Oper selbst findet sich als Beitrag in unserer Serie Die vergessene Oper.)
.
.
Rossini in Wildbad 2024: Während in zwei Wochen auf und an der Seine bereits die Eröffnung der Olympischen Spiele stattfindet, wehte im Juli ein Hauch von Paris durch den Nordschwarzwald. Ganz punktgenau hat es Jochen Schönleber nicht hinbekommen, doch die beiden erweiterten Wochenenden, auf die er das Belcanto Opera Festival „Rossini in Wildbad“ reduziert und konzentriert hat, fallen fast genau zwischen Fußball-Euphorie und Olympische Spiele. (…)
Rossini selbst, Wildbads berühmter Kurgast, ließ sich für seine Bäderbehandlung 1856 mehrere Wochen Zeit. Ein Sportsmann war er sicherlich nicht. Bewegungen vermied er tunlichst. Wenn er sich regelmäßig zu Ausflüge im Bois de Boulogne mit Michele Carafa traf, ritt der neapolitanischen Adelige und Offizier auf seinem Pferd, während es sich Rossini in seiner Kutsche bequem machte. Sie waren gut befreundet, seit sie in Neapel das seinerzeit beste Opernhaus der Welt erobern wollten. Beide verschlug es in den 1820er Jahren nach Paris. Der perfekt französisch sprechende Bonapartist Carafa, der auch die französische Staatsbürgerschaft annahm, konnte an der Opéra-Comique, die fortan sozusagen seine künstlerische Heimstatt blieb, sofort mit französischen loslegen, während Rossini zögernd mit französischen Umarbeitungen früherer Werke und einer Festkantate begann, aus der er dann seine erste originale französische Oper Le Comte Ory filterte.

Rossinis „Comte Ory“ beim Belcanto-Festival Rossini in Wildbad 2024/Szene/Patrick Pfeiffer
Dieser Graf Ory steht zusammen mit Carafas Masaniello im Zentrum der 35. Festspiele 2024. In zehn Tagen geht es hurtig Schlag auf Schlag und atemlos wie im Crescendo einer Rossinischen Ouvertüre, denn hinzu kommen im Königlichen Kurtheater Aufführungen der Italienerin in Algier unter José Miguel Pérez-Sierra, ganz kommod auch vormittags, was geballte Rossini-Besuche erlaubt, dazu Cenrentola für Kinder, instruktive Arienkonzerte, wobei sich beispielsweise Mert Süngü des Tenors Duprez annimmt, und zum Abschluss ein Waldkonzert hoch oben auf dem Berg.
Singen ist Hochleistungssport. Das bewiesen Nathanael Tavernier und Camilla Carol Farias, die am 20.7. nach dem Masaniello wieder ran mussten, um Patrick Kabongos Grafen Ory zur Seite zu stehen. Wobei sie als Erzieher und Pförtnerin des Schlosses kaum das Treiben des Erotomanen gutheißen können, der in wechselnder Verkleidungen Sophia Mchedlishvilis sehr kapriziöser Gräfin an die Wäsche will, im Dunkeln aber an seinen Pagen Isolier gerät. Das alles spielt einer alten Legende zufolge um 1200 in der Tourraine, wo die Frauen während der kreuzzugsbedingten Abwesenheit ihrer Männer Enthaltsamkeit geschworen haben. Diese gilt es zu erschüttern. Rossini hat einen gewichtigen Teil seiner Il viaggio a Reims-Musik in seine erste originale französische Oper gerettet, die dezidiert nicht als opéra comique, sondern als „Opera“ ausgewiesen wurde. Denn schon Philip Gossett wies einst darauf hin, „Während die Instrumentierung einer damaligen opéra comique relativ durchsichtig ausfällt, ist Rossinis Orchesterapparat in Le Comte Ory riesig und durchaus vergleichbar dem, den er in Guillaume Tell verwendete“.

Rossinis „Comte Ory“ beim Belcanto-Festival Rossini in Wildbad 2024/Szene mit Patrick Kabongo/Patrick Pfeiffer
Witz, Geist und Esprit verströmt in reichem Maß die Leitung Antonino Foglianis, der sich einmal mehr als profunder Rossini-Kenner erwies, bei dem Timing, Phrasen und Nuancen wie selbstverständlich sitzen, wie sich im präzisen Agieren des Krakauer Orchesters und Chors zeigte. Patrick Kabongo gab den liebestollen Ory mit ansprechender Geschmeidigkeit und federleichter Verblendung von Mittellage und Höhe und die ihm übergestülpten Kostüme mit Nonchalance. Bemerkenswert die virtuose, in der Mittellage etwas verkniffene Gräfin der georgischen Sopranistin Sophia Mchedlishvili, die eher dem Pagen des Grafen geneigt ist. Diana Haller singt den Isolier als handele es sich um Verdis Amneris, mit bolleriger Mittellage, viel Kraft, mühelos strömend, guter Höhe, aber auch etwas wackelnd. Tavernier blieb als Erzieher bei reicher Tiefe etwas gleichförmig, Fabio Capitanucci machte als Raimbaud wenig aus seiner Arie, Camilla Carol Farias war die resche Ragonde, Yo Otahara die süße Alice. Jochen Schönleber und seine Kostümbildnerin Olesja Maurer haben dazu einen Flower-Power-Mix angezettelt, der ein bisschen mit kultureller Aneignung und genderfluiden Stereotypen kokettiert. Ekstatische Begeisterung. Rolf Fath (der auch den erstmalig Masaniello Michele Carafas als moderne Erstaufführung erlebte, seine Rezension findet sich zum Artikel in der Reihe Die vergessene Oper.)
.
.
Bei der styriarte Graz: Vivaldis Le quattro stagioni als Soap-Opera. Kaiserin Maria Theresia hat sich in Graz angesagt und die Vorbereitungen auf den hohen Besuch sind in vollem Gange. Ein reiches Programm soll die Monarchin unterhalten. Schon am Vortag der Ankunft Ihrer Majestät herrscht reges Treiben im Palais des Grafen Attems, wo die Putzdirndln und -burschen in historischen Kostümen (der HIB.art.chor) das goldene Besteck polieren und dazu steirische Balladen aus dem 18. Jahrhundert und „Deutsche Volkslieder aus Steiermark“ singen.

Styriarte 2024: Vivaldis „Quattro stagioni“/Szene/Foto Nicola Milatovic
So beginnt der 1. Teil der Attems-Saga, die Thomas Höft erdacht und Adrian Schvarzstein in Szene gesetzt hat. Grundlage ist der historisch verbürgte Besuch der Kaiserin Maria Theresia in der steirischen Hauptstadt am 4. Juli 1750 samt der Bemühungen des Grafen Ignaz Maria Attems, der Herrscherin mit einer neuen Oper zu imponieren. Leider hatte die Kaiserin die Stadt nach nur wenigen Stunden wieder verlassen…
Nun soll mit einem großen Spektakel an diese historische Episode erinnert werden. Sänger, Schauspieler, Tänzer und Musiker wirken mit. Beim Gang durch die prachtvollen Räume des Palais unter Führung des Haushofmeisters Hippolyt (gebührend aufgeregt: Matthias Ohner) wird man auch Zeuge einer Affäre von Marianne Gräfin Attems (exaltiert: Maria Köstlinger) mit ihrem Geliebten Monsieur de la Tour (Georg Kroneis virtuos an der Viola da Gamba). Schließlich geht es zu Fuß in die ehrwürdige Aula der Alten Universität mit ihren wunderbaren floralen Deckenmalereien, wo ein Vorsingen stattfindet für die Aufführung von Vivaldis „Jahreszeiten“-Oper am nächsten Abend. Große Chancen haben zwei Damen – die Primadonna Daniela Papagallo (die Italienerin Carlotta Colombo mit substanzreichem Sopran) und die Nichte des Basteischließers Mizzi Huber (Anna Manske mit angenehmem, hellem Mezzo). Zweifelhaft ist der Auftritt des dänischen Tenors Svend-Poul Hjorth-Stromqvist (wirklich aus Dänemark: der Tenor Valdemar Villadsen mit schmaler Stimme).

Styriarte 2024: Vivaldis „Quattro stagioni“/Szene/Foto Nicola Milatovic
Tags darauf begegnet man diesen drei Sängern im Schauspielhaus bei der Aufführung von Le quattro stagioni stiriane wieder. Der 2. Teil der Attems-Saga ist ein Pasticcio aus den vier Concerti von Vivaldis Le quattro stagioni und einer Auswahl seiner berühmtesten Arien. Am Pult der Palais Attems Hofkapelle steht Michael Hofstetter im Kostüm eines bettelnden Straßenmusikanten (Bettina Dreißiger). Erfahren in der historischen Barock-Praxis, findet er die Balance zwischen delikaten Passagen mit filigranen Instrumentalsoli und furios auftrumpfenden oder eisig klirrenden Episoden.
Die Spanierin Lina Tur Bonet als Konzertmeisterin des Ensembles brilliert in den zahlreichen Soli der Komposition mit musikantischer Verve und stupender Technik.
Auf die Bühne hat Christina Bergner ein drehbares Modell gestellt, welches bunte Landschaften, Blumen-Arrangements und winterliche Gletscher-Massive zeigt. Zum Amüsement des Publikums werden die über den Abend verteilten Sätze aus Vivaldis Concerti mit pantomimischen Szenen garniert (Choreografie: Mareike Franz) – ein Schäfer mit Hund, Blumenmädchen, ein Jongleur, Eisbären…

Styriarte 2024: Vivaldis „Quattro stagioni“/Szene/Foto Nicola Milatovic
Immer wieder wird auch die Ankunft der Kaiserin verkündet, das Publikum aufgefordert, sich zu erheben und den Begrüßungschor anzustimmen, ein aus Dorilla in Tempe stammendes und eigens für diesen Anlass mit neuem Text versehenes Stück. Doch jedesmal erweist sich die Ansage .als Irrtum, was die Künstler nicht von der Fortsetzung des Programms abhält. Im Falle der Primadonna Daniela Papagallo alias Carlotta Colombo ist man darüber besonders erfreut, denn die Sopranistin glänzt in „Ombre vane“ aus Griselda mit Klangfülle und starkem Aplomb im rasanten Mittelteil. Das „Addio caro“ aus La verità in cimento im zweiten Teil geriet dagegen etwas beiläufig, während die Aria „In furore iustissimae irae“ wahrhaft mit Furor vorgetragen, im Da capo angemessen verziert und mit Spitzentönen geschmückt war. Die Mezzosopranistin Anna Manske als Mizzi Huber imponierte bei „Gelido in ogni vena“ aus Farnace durch starke Expressivität, während es ihr für die Cantata in Scena con Viola all´inglese (Georg Kroneis) an Pathos fehlte. Mit der Sopranistin fand sie im Duetto „Placa l´alma“ aus Händels Alessandro zu ausgewogenem, harmonischem Zusammenklang. Gegenüber den Sängerinnen blieb der Tenor Valdemar Villadsen im Schatten, doch gelangen ihm in „Care pupille“ aus Tigrane immerhin feine Kopftöne. Dagegen blieb der auftrumpfende Nachdruck in „Alle minacce di fiera belva“ aus Farnace unterbelichtet.
Mit dem Finalsatz Allegro. Lento aus „L´Inverno“ endet die Aufführung, aber es wird natürlich noch einmal der Begrüßungschor angestimmt – auch wenn die Kaiserin bis zum Schluss nicht erschien (was ein wenig an Rossinis Reise nach Reims erinnert). Die Begeisterung im Publikum bewies, dass darüber niemand enttäuscht war.

Styriarte 2024: Vivaldis „Quattro stagioni“/Szene/Foto Nicola Milatovic
Am nächsten Vormittag waren alle eingeladen, im prachtvollen Planetensaal von Schloss Eggenberg dem Spiel Königlicher Bläser zu lauschen. Die fünf Musiker, Virtuosen auf ihren Instrumenten, gehören zur Compagnia di Punto, benannt nach dem größten Hornisten der Mozart-Zeit Wenzel Stich alias Giovanni Punto. In Telemann Ouvertüre in F zu Beginn wechselten Jagdsignale mit einem lieblichen Menuet, einer feierlichen Sarabande und einer munter beschwingten Loure. In drei Stücken kam noch einmal Händel zu Wort. und mit einer Triosonate in g wurde an Vivaldi erinnert. Nach diesen Kompositionen für kleinere Besetzungen vereinten sich alle fünf Mitglieder des Ensembles am Ende beim Quintett in F von Telemann, das mit einer festlichen Fanfare ausklingt. Danach konnten alle Freunde von Natur und Musik im Park bei einem Picknick–Konzert Hornkonzerte von Punto mit David Fliri und Christian Binde, dem Leiter der Compagnia, hören, was das originelle und innovative Wochenendprogramm der styriarte (28., 29. und 30. 6. 2024) stimmungsvoll beendete.. Bernd Hoppe
.
.
Musikfestspiele Potsdam Sanssouci: Der Kaiser auf dem Koffer. Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci zeichnen sich seit Jahren durch originelle Programmkonzeptionen aus. In diesem Jahr war „Tanz“ das Motto, was eine Fülle von attraktiven Aufführungen versprach. Im Schlosstheater des Neuen Palais gab es Grauns Oper Adriano in Siria, welche erstmals 1746 an der Königlichen Oper in Berlin erklang, seither aber nicht mehr gespielt wurde. Wie die berühmten opéra-ballets im Frankreich des 17. Jahrhunderts erfreute sich diese Kunstform auch in Preußen großer Beliebtheit. Friedrich II. engagierte ab 1744 für den Potsdamer Hof eine Tanzkompagnie, an deren Spitze die italienische Startänzerin Barbara Campanini („La Barberina“) für Furore sorgte und natürlich bei der Uraufführung des Adriano mitwirkte.
Die legendäre Künstlerin hatte auch in der aktuellen Inszenierung von Deda Cristina Colonna einen Platz gefunden. Die Regisseurin arrangierte die Handlung um den römischen Kaiser Hadrian, der den syrischen König Osroa besiegt und dessen Tochter Emirena entführt hat, vor einer hohen dekorativen Wand (Ausstattung: Domenico Franchi), welche mit Kunstobjekten sowie Details aus dem Palastinterieur und dem Garten geschmückt ist. Unnötigerweise wurde eine Vielzahl von Jalousien installiert, die von den Akteuren unmotiviert fast pausenlos bedient werden müssen. Attraktiv und kostbar sind die Kostüme in ihrer historischen Orientierung, entbehrlich einige modische Zutaten wie ein Reisekoffer, der für den Kaiser als Sockel dient, ein Einkaufstrolley und ein Fahrrad. Für die Auftritte der Barberina an den Aktschlüssen hatte Graun Divertissements komponiert, wofür nun eine moderne Lösung gefunden wurde. Als Auftragswerk der Musikfestspiele schuf der 1965 in Rom geborene Italiener Massimiliano Toni eine „Barberina Suite“, bestehend aus drei Intermezzi, die von der Spezialistin für Barocktanz Valerie Lauer mit Grazie und Geheimnis interpretiert werden. Ihre orientalische Gewandung und das golden geschminkte Gesicht sind von fremdartigem Reiz, passend zur Musik mit ihren exotischen Instrumenten Nay, Clavictherium, mediterranem Perkussioninstrumentarium und von Dorothee Oberlinger selbst gespielter Flöte.
Mit ihrem Ensemble 1700 sorgte die Dirigentin schon in der dreiteiligen Ouvertüre für einen lebhaften Einstieg mit rhythmischer Prägnanz und großem Farbenreichtum. Die Musik ist beschwingt und galant, oft auch elegisch und wehmütig. All diese Stimmungen bringt Oberlinger wirkungsvoll zur Geltung, setzt auch starke Akzente durch prägnant platzierte Affekte.

Szene aus Grauns Oper „Adriano in Siria“ in Potsdam 2024/Foto Sebastian Gloede
Ein erlesenes Solistenensemble meistert die anspruchsvollen Partien in staunenswerter Manier, angeführt von Valer Sabadus in der Titelrolle. Der Counter war in der 4. und letzten Aufführung der Serie am 13. 6. 2024 in blendender Form. Die Stimme klang resonant und ausgeglichen, ohne Schärfen in der Höhe und auch in der tiefen Lage präsent, wie die furiose Arie „Wenn ein wilder Löwe“ im 2. Teil zeigte. Beeindruckend war auch die emotionale Gestaltung seiner Soli, während das Spiel bei diesem Sänger immer recht verhalten bleibt. Spektakulär war der Auftritt des Sopranisten Bruno de Sá als Partherfürst Farnaspe. Nicht nur die stupende Beherrschung der Extremhöhe mit topsicheren Spitzentönen überwältigte, auch die makellose Demonstration des virtuosen Zierwerks mit Koloraturen, Trillern und Fiorituren war von schier mirakulösem Zuschnitt. Als seine Verlobte Emirena war Roberta Mameli zu erleben. Die italienische Sopranistin ist in Potsdam regelmäßig zu Gast und noch immer ein Garant für hochkarätigen Barockgesang. Zu rühmen sind neben ihrer individuellen Stimme die intensive Darstellung und das expressive Gebärdenspiel. Nach ihrer Arie „Als verlassene Gefangene“ mit resolutem Nachdruck sorgt sie gemeinsam mit de Sà im Duett „Meine Seele soll übergehen“ für einen überwältigenden Moment, in dem die Zeit still zu stehen schien – zwei Sopranstimmen, die sich zu einem harmonischen Zusammenklang umschlingen und ihre Individualität aufgeben zugunsten einer wundersamen Symbiose. Auch die zweite Sopranistin, Keri Fuge als Sabina, Verlobte des Kaisers Adriano, die in dessen Affinität zu Emirena eine Rivalin wittert, bot eine exzellente Leistung. Die substanzreiche, technisch blendend geführte Stimme der Britin war der Mameli ebenbürtig, und auch sie überzeugte durch die engagierte Darstellung. Zu den Trümpfen der Besetzung zählte auch der französische Haute-contre David Tricou als besiegter Partherkönig Osroa. Von stattlicher Erscheinung und herrscherlicher Aura zog er bei jedem seiner Auftritte die Blicke auf sich. Auftrumpfend und furios sein Gesang, furchtlos sein Ausdruck, würdevoll seine Haltung. Der junge italienische Sopranist Federico Fiorio komplettiert das Personal als Adrianos Adjudant Aquilio mit knabenhafter, buffonesk-leichter Stimme. Reizend und mit großer Spielfreude trägt er seine Arien „Ein alter Krieger“ und „Der vorsichtige Schnitt des Winzers“ vor. Am Ende vereinen sich alle Mitwirkenden zum jubelnden Schlusschor „Möge dein Name, großer Kaiser“ und fröhlich-ausgelassenen Tanz, denn Adriano hat Osroa die Freiheit und Farnaspe seine Emirena geschenkt. Nach diesem lieto fine gibt es auch im Saal anhaltende Begeisterung. Bernd Hoppe

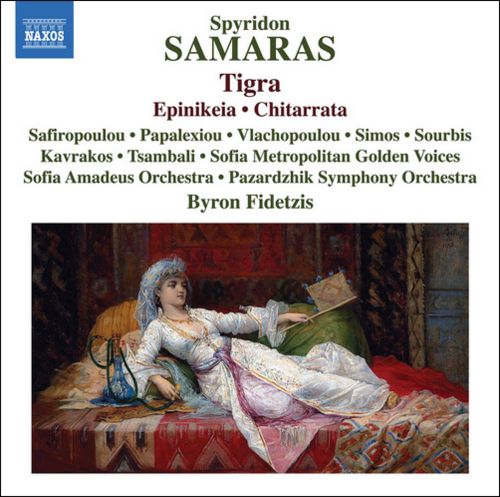 Für die heroischen Gesänge auf Texte von Georgios Drosinis hat man mit dem Mezzosopran Vavara Tsambali eine angemessen vollmundige, weich und geschmeidig ihre Stimme einsetzende Interpretin gefunden und die Chitarrata ist an mitreißendem Schwung kaum zu überbieten (Naxos 8.574358.). Ingrid Wanja
Für die heroischen Gesänge auf Texte von Georgios Drosinis hat man mit dem Mezzosopran Vavara Tsambali eine angemessen vollmundige, weich und geschmeidig ihre Stimme einsetzende Interpretin gefunden und die Chitarrata ist an mitreißendem Schwung kaum zu überbieten (Naxos 8.574358.). Ingrid Wanja 
 Die verstorbene Nena Michelaki war eine liebenswürdige Persönlichkeit des alten Athener Bürgertums.
Die verstorbene Nena Michelaki war eine liebenswürdige Persönlichkeit des alten Athener Bürgertums. 


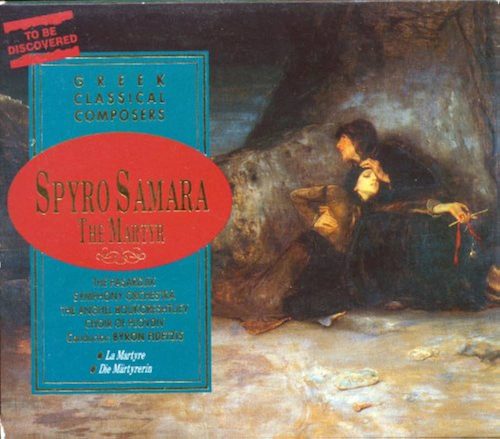 Die Gründe dafür sind zum einen das begrenzte Repertoire dieser Orchester und zum anderen das fragwürdige Niveau ihrer professionellen Musikstandards. Ich glaube daher, dass sein unmittelbarer Kontakt mit der Französischen Musikschule und ihrem Orchestrierungsstil ebenfalls ein Schlüsselfaktor für die endgültige Gestaltung seines persönlichen Klanguniversums war. Ich denke, dass ein Hinweis auf die Art der Beziehung, die Komponisten zu Wagner haben – und mehr noch für Opernkomponisten aus Samaras‘ Zeit –, eine unabdingbare Voraussetzung für das Verständnis des wagnerschen Einflusses auf Samaras‘ eigenes kreatives Schaffen ist. Auf allgemeiner Ebene lässt sich dieser Einfluss in dem Kontakt erkennen, den der Komponist mit den vorherrschenden postwagnerischen Musik- und Theaterkonzepten hatte, in die er sich nach und nach und auf natürliche Weise vertiefte. Ein Beweis dafür ist die Verwendung des Leitmotivs und sein allmählicher Widerstand gegen die Verwendung von Strukturformen, die als autonom und nicht voneinander abhängig definiert sind (wie Arien und verschiedene phonetische Ensembles). Auch die erweiterte Bedeutung, die der Rolle und Größe eines Orchesters beigemessen wird, ist ein Beweis dafür. Es scheint jedoch, dass Wagner-Konzepte, die bereits einer „Filterung“ durch den französischen Geist unterzogen wurden (dem sie als Konzepte auch viel verdanken), Samaras und seine Arbeit nur auf einer sekundären Ebene beeinflussten, wenn es um spezifischere Elemente ging (wie die Erweiterung des harmonischen theoretischen Denkens sowie die Art der Orchestrierung).
Die Gründe dafür sind zum einen das begrenzte Repertoire dieser Orchester und zum anderen das fragwürdige Niveau ihrer professionellen Musikstandards. Ich glaube daher, dass sein unmittelbarer Kontakt mit der Französischen Musikschule und ihrem Orchestrierungsstil ebenfalls ein Schlüsselfaktor für die endgültige Gestaltung seines persönlichen Klanguniversums war. Ich denke, dass ein Hinweis auf die Art der Beziehung, die Komponisten zu Wagner haben – und mehr noch für Opernkomponisten aus Samaras‘ Zeit –, eine unabdingbare Voraussetzung für das Verständnis des wagnerschen Einflusses auf Samaras‘ eigenes kreatives Schaffen ist. Auf allgemeiner Ebene lässt sich dieser Einfluss in dem Kontakt erkennen, den der Komponist mit den vorherrschenden postwagnerischen Musik- und Theaterkonzepten hatte, in die er sich nach und nach und auf natürliche Weise vertiefte. Ein Beweis dafür ist die Verwendung des Leitmotivs und sein allmählicher Widerstand gegen die Verwendung von Strukturformen, die als autonom und nicht voneinander abhängig definiert sind (wie Arien und verschiedene phonetische Ensembles). Auch die erweiterte Bedeutung, die der Rolle und Größe eines Orchesters beigemessen wird, ist ein Beweis dafür. Es scheint jedoch, dass Wagner-Konzepte, die bereits einer „Filterung“ durch den französischen Geist unterzogen wurden (dem sie als Konzepte auch viel verdanken), Samaras und seine Arbeit nur auf einer sekundären Ebene beeinflussten, wenn es um spezifischere Elemente ging (wie die Erweiterung des harmonischen theoretischen Denkens sowie die Art der Orchestrierung).

























 Die Musik ist ein wahrer Strom von
Die Musik ist ein wahrer Strom von 


 Il Bel Canto Ritrovato
Il Bel Canto Ritrovato


















 Die
Die 
 Dazu ein kleiner Überblick über Vohandenes
Dazu ein kleiner Überblick über Vohandenes
 Unter Sammlern kursiert ein bemerkenswertes Dokument von
Unter Sammlern kursiert ein bemerkenswertes Dokument von 


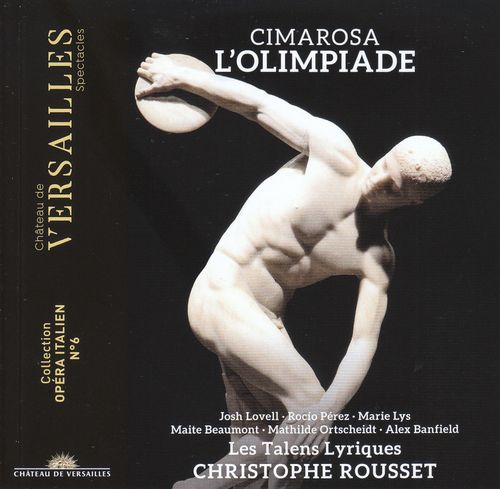
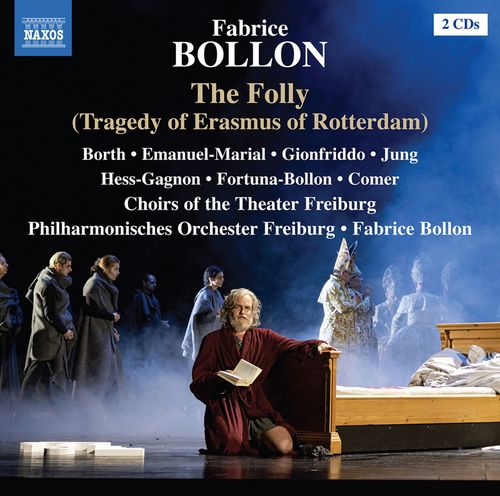


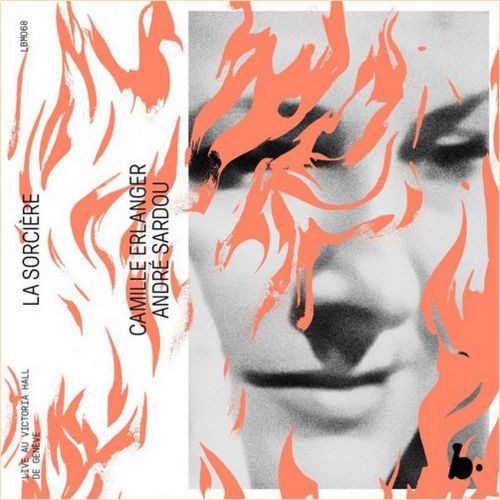 Das und manches mehr breitet sich über
Das und manches mehr breitet sich über