In einer Fernseh-Sendung bei Servus TV (moderiert von Ion Holender) hörte man kürzlich Gutes über die Sopranistin Elena Mosuc, als in Muscat das neue Opernhaus von Oman prunkvoll eröffnet wurde und die Lakmé von Léo Délibes in Elena Mosuc eine aufregende Verkörperung fand. Das war uns Anlass zu einem Interview, das Csaba Némedi mit ihr bei den Proben zu Verdis Lombardi gehalten hat, die in Klausenburg im September 2019 Premiere hatten. Und nicht vergessen werden soll, dass Elena Mosuc als beste Sopranistin für den Opus Klassik-Preis zweimal nimoniert wurde. Und am 1 Oktober 2019 in Teatro Malibran bekommt sie den Oscar della lirica in der Kategorie beste Sopranistin im venezianischen Teatro Malibran! Glückwünsche!

Elena Mosuc/ Foto EM
Jahrzehntelang galt die Extrempartie der Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte als eine Ihrer wichtigsten Visitenkarten in der Opernwelt. Eine Rolle, die Sie nicht nur weltweit mit großem Erfolg in mehr als 250 Aufführungen verkörperten, sondern auch für Sie wichtige Türen öffnete. Wie würden Sie Ihre Interpretation vokaler, musikalischer und darstellerischer Natur beschreiben? Wie haben Sie diesen komplexen Charakter ausgearbeitet bzw. wie haben Sie diesen Vorstellung für Vorstellung selbst erlebt? Als ich während meines Gesangstudiums angefangen hatte, an den Arien der Königin der Nacht zu arbeiten, war ich zunächst davon überhaupt nicht überzeugt, ob diese Arien bzw. diese Rolle überhaupt zu meiner Stimme passt. Die Idee, dass ich mir diese Rolle erarbeiten sollte, kam eigentlich von einem Gesangsprofessor, bei dem ich allerdings nur eine kurze Zeit studierte. Er hatte überdies auch die anfangs etwas merkwürdig anmutende Idee, auch mit Mezzosopranistinnen an dieser Rolle zu arbeiten. [Anm.: sie lacht]. Im Nachhinein betrachtet – noch dazu nach soviel Jahren als Opernsängerin – muss ich aber zugeben, dass seine Idee gar nicht so abwegig war, wenn man seine Unterrichtsmethode und deren Zielsetzung in ihrer Gesamtheit betrachtet. Am Anfang meines Gesangsstudiums hatte ich Angst vor der Höhe. Durch das Erlernen der richtigen Gesangstechnik hat sich dann auch meine Höhe entdeckt und immer mehr entfaltet und sicherer geworden. Aus heutiger Sicht kann ich natürlich darüber lachen, was für eine Angst es mir bereitete, am Anfang etwa ein b zu singen… Ab dem Moment, als die Höhe sich festigte, hätte ich Tag und Nacht die Königin singen können, somit war auch meine ursprünglich vorhandene Angst vor der Höhe weg.
Als ich im Februar 1990 nun mein offizielles Bühnendebut – noch dazu mit der Königin der Nacht geben konnte – war ich bereits in technischer Hinsicht sicherlich soweit sattelfest, dass man dieses Debüt sehr wohl als klaren Erfolg verbuchen konnten. Dennoch ist meine Königin durch das stetige Weiterarbeiten an meiner Stimme, die Festigung meiner Gesangstechnik und die jahrelange intensive Arbeit auch viel stärker, ausdrucksstärker und dramatischer geworden. Um mein Repertoire auch nach der Königin der Nacht erfolgreich erweitern zu können, ist es unerlässlich, permanent an der eigenen Technik zu arbeiten und die Stimme zu pflegen. So folgten auf meine erste Königin in relativ rascher Folge Rollen wie beispielsweise Gilda, Lucia, Violetta, aber auch Donna Anna und Zerbinetta. Während ich die Königin der Nacht anfangs nur als gute und wichtige Übung betrachtete, musste ich später erkennen, dass sie für mich nicht nur das Fundament für mein späteres Bühnenrepertoire bildete, sondern sie half mir sogar bei der souveränen und technischen Bewältigung manch anderer Partien!
Wenn man aber während des Studiums der Königin der Nacht erkennen sollte, dass es doch nicht so recht klappen könnte, dann sollte man lieber ganz die Finger von dieser exponierten Partie lassen, da diese absolut keine halbe-halbe Lösungen zulässt.
Da ich weltweit nicht nur in unzähligen Zauberflöte-Produktionen mitwirkte, die sowohl musikalischer, als auch szenischer Natur teilweise sogar extrem unterschiedlich und herausfordernd waren, festigte sich meine Rolleninterpretation immer mehr. Viele musikalische und szenische Einflüsse trugen dazu bei, mich in der Rolle nicht nur sehr gut, sondern auch sicher zu fühlen. Musikalisch habe ich insbesondere von der regen und inspirierenden Zusammenarbeit mit Maestro-Legende Nikolaus Harnoncourt profitiert, von dem ich eine Menge über diese schwere Rolle und andere) und deren vielschichtigen Charakter gelernt habe!
Die Königin der Nacht hat nicht nur wichtige Türen in meiner Karriere geöffnet, sondern war ein jahrzehntelanger und konstanter Wegbegleiter meiner Karriere. Außerdem habe ich den Eindruck, dass ich an dieser enorm facettenreichen Rolle von Vorstellung zu Vorstellung, von Produktion zu Produktion, sehr gewachsen bin! Jede Vorstellung war ein besonderen Abenteuer! Vielleicht werde ich sogar mein 30-jähriges Bühnenjubiläum mit ihr feiern…?! [Anm.: sie lacht]
 Gibt es eine bestimmte Aufführung oder Aufführungsserie der Zauberflöte, die Ihnen auch aus heutiger Sicht noch ganz besonders am Herzen liegt? Eine ganz besonders schöne Erinnerung verbindet mich mit einer Produktion am Gärtnerplatz Theater in München (1990) – nicht nur wegen des opulenten und wunderschönen Kostüms, sondern weil es meine allererste Königin der Nacht im Ausland war, noch dazu auf Deutsch, da ich zuvor lediglich zwei Aufführungen in meiner Heimatstadt Iasi auf Rumänisch absolviert hatte…
Gibt es eine bestimmte Aufführung oder Aufführungsserie der Zauberflöte, die Ihnen auch aus heutiger Sicht noch ganz besonders am Herzen liegt? Eine ganz besonders schöne Erinnerung verbindet mich mit einer Produktion am Gärtnerplatz Theater in München (1990) – nicht nur wegen des opulenten und wunderschönen Kostüms, sondern weil es meine allererste Königin der Nacht im Ausland war, noch dazu auf Deutsch, da ich zuvor lediglich zwei Aufführungen in meiner Heimatstadt Iasi auf Rumänisch absolviert hatte…
Am häufigsten trat ich vermutlich in der legendären und sehr beliebten Inszenierung von Jean-Pierre Ponnelle am Opernhaus Zürich auf. Die ausladende und überdimensional große Krone – aus Pfauenfedern angefertigt – die nicht auf dem Kopf war, sondern hat meine ganzen Rücken bedeckt, war nicht nur atemberaubend schön, sondern auch ziemlich schwer… [Anm.: sie lacht], aber das Publikum liebte diese Produktion sehr! (Dieser Produktion verdanke ich übrigens auch eine kurze, jedoch unvergessliche Begegnung mit der einzigartigen Sopranistin Lucia Popp, die ja zuvor selbst auch als legendäre Königin der Nacht galt. In Zürich sang sie bereits meine Bühnentochter Pamina…)
Die spektakuläre Regie und Kostümierung von Marco Arturo Marelli an der Wiener Staatsoper, die Inszenierung von Pier Luigi Pizzi an der Oper zu Rom und die Produktion an der Leipziger Oper samt in der Luft schwebender Königin der Nacht bleiben mir natürlich auch in guter Erinnerung.
Nicht nur die bereits angesprochene Mozart’sche Sternflammende Königin, sondern auch die unterschiedlichsten Belcanto-Heldinnen gehören seit knapp 30 Jahren zu Ihrem Kernrepertoire. Welche Rollen sind aus diesem Repertoire Ihre absoluten Lieblingsrollen und aus welchem Grund? Was macht das Phänomen italienischer Belcanto für Sie aus? Wie ist es hierbei um Technik und Stilistik bestellt? Es ist ein Riesenglück, dass der liebe Gott mir dieses großzügige Geschenk in die Wiege gelegt hat und ich würde mit keiner anderen Sängerin tauschen wollen! [Anm.: sie lacht]. Es ist also nicht mein Verdienst. Mein Verdienst ist hingegen, wenn man das als solches bezeichnen kann (?), dass ich mit diesem Geschenk bzw. an meiner Stimme so lang und hart gearbeitete habe, bis ich soweit war, die Fachpartien des italienischen Belcanto nicht nur technisch und stilistisch, sondern auch in ihrer Gesamtheit souverän und mit Raffinesse zu bewältigen.
Es ist aber natürlich ein kontinuierlicher (Lern-)Prozess, welcher nie aufhört bzw. niemals aufhören sollte! Obwohl es sich um dieselbe Epoche oder sogar oftmals um den gleichen Komponisten handelt, sowie jede einzelne Interpretation etwas ganz spezielles darstellen und erzählen sollte, ist es für mich irgendwie so wie der Duft eines geliebten und vertrauten Parfüms, das man aktuell verwendet, so ist es auch im Fall meiner Belcanto-Rollen: die jeweils Aktuelle ist eben mein aktuelles Lieblingskind!
Wenn ich aber meine bisherigen Belcanto-Erfahrungen Revue passieren lasse, muss ich zugeben, dass ich sehr wohl dazu tendiere, eher die dramatischen und tragischen Rollen zu bevorzugen. (Für manche, die mich persönlich kennen, scheint es oft etwas verwunderlich, denn Humor, Witz, Heiterkeit und Freude sind mir im Privaten alles andere als fremd!) [Anm.: sie lacht]

Elena Mosuc/ Foto EM
Etwa Lucia, Norma, Lucrezia Borgia, Anna Bolena, Maria Stuarda sind aber definitiv ganz oben auf der Skala meiner sogenannten Lieblingsrollen – diesen stehen aber auch Gilda, Violetta und Luisa Miller in nichts nach, insbesondere wenn man sich überlegt, dass die Opernheldinnen des »frühen« und »mittleren Verdi« ursprünglich für Sängerinnen komponiert wurden, die die größten und wichtigsten Belcanto-Primadonnen ihrer Zeit waren…
Belcanto heißt für mich also nicht nur eine ganz bestimmte Epoche oder ein ganz bestimmter Gesangsstil, sondern schlicht und einfach auch Perfektion. Die Anforderungen an die Sängerinnen und Sänger, denn man braucht hier – nebst eines tollen Stimm-Materials als Basis – absolut alles, was von einem Sänger überhaupt abverlangt werden kann: makellose Technik, perfekte Stilistik, Klasse und guten Geschmack für Phrasierung und Verzierungen etc.
»Wer Belcanto singen kann, kann alles singen!« – soll Maria Callas einst gesagt haben. Eine Aussage und Feststellung, der ich nur vollinhaltlich zustimmen kann. Belcanto ist also auch für mich die unangefochtene Basis, auch wenn ich etwa Rollen von G. Puccini oder gar R. Strauss singe. In diesen Fällen muss natürlich eine entsprechende und zeitgemäße Stilistik ohne Wenn und Aber berücksichtigt und angewandt werden, jedoch ohne die eigene Stimme bzw. Technik zu verstellen.
Um beim italienischen Fach zu bleiben, ist es nicht zu übersehen, dass man u.a. den Rollen der Lucia, Violetta und Gilda immer wieder in Ihrem Repertoire begegnen kann. Gibt es für Sie spezielle Verbindungen unter diesen Operncharakteren? Absolut! Es sind zwar allesamt jüngere Frauen, sie erleiden jedoch jeweils ein anderes Schicksal.
Der einzige gemeinsame Nenner unter diesen drei Heldinnen ist und bleibt die Liebe und deren Auswirkungen. Man könnte fast behaupten, die Liebe ist hier eine Art dramaturgisches Leitmotiv, welches eine indirekte Verbindung zwischen Lucia, Violetta und Gilda herstellt.
Seit langem gehört ebenfalls die Titelpartie der Donizetti’schen Maria Stuarda Ihrem Repertoire an, also Ihre erste Rolle aus der sog. Tudor-Trilogie. Seit 2007 haben Sie bereits auch die Titelpartie in Anna Bolena mit großem internationalem Erfolg gesungen. Wie sieht es aber mit Elisabetta I. in Roberto Devereux aus? Haben Sie vor, Ihre eigene Tudor-Trilogie zu vervollständigen? Was ist das Spezielle an der Rolle der Elisabetta I.? Nach meinem erfolgreichen Debüt (2006) in einer wunderschönen szenischen Produktion von Maria Stuarda – unter der Leitung von Ralf Weikert – am Opernhaus Zürich, habe ich anschließend 2007 auch die Partie der Anna Bolena mit Maestro Bertrand de Billy – zunächst konzertant – am Wiener Konzerthaus erarbeitet. Wie man es den div. Tondokumenten dieses Konzerts im Internet entnehmen kann, darf ich auch aus heutiger Sicht dieses Rollendebüt als erfolgreich betrachten. Diese beiden Debüts haben für mich einmal mehr bestätigt, dass es absolut richtig war, diese Entscheidung zu treffen, mich immer mehr auf die Epoche des Belcanto zu konzentrieren – noch dazu mittlerweile auch auf die eher dramatischeren Rollen dieses Repertoires.
Auf diese beiden Rollendebüts folgten dann die weiteren Maria Stuarda-Aufführungen in Berlin und Genova, während ich Anna Bolena zum ersten Mal szenisch in Lissabon, in der Regie von »il grande« Graham Vick singen durfte. (Diese Produktion habe ich letztes Jahr auch am Teatro Filarmonico zu Verona wiederholt, also an jenem Haus, für welches diese Regie von Graham Vick ursprünglich erarbeitet worden war.)
Natürlich ist es ein langersehnter Wunsch, eigentlich ein Traum von mir, endlich »meine eigene und persönliche Tudor-Trilogie« auf der Bühne zu vervollständigen, zumal ich Ausschnitte aus Roberto Devereux bereits vor ein paar Jahren auch auf meiner Donizetti-Arien CD eingespielt habe.
Auch wenn die Sehnsucht schon sehr groß ist, die Extremrolle der Elisabetta I. endlich auf der Bühne verkörpern zu können, muss ich gestehen, dass ich meinem Schicksal dennoch sehr dankbar bin, dass ich diese »Mammutrolle« nicht schon früher singen sollte…(Die ganze Partie sollte ich bereits vor vielen Jahren am Opernhaus Zürich einstudieren, als ich das Cover für Edita Gruberová war – zu einem Rollendebüt meinerseits kam es damals jedoch nicht.)
Das Maximum an Dramatik, was Donizetti hier schonungslos von der Sängerin einfordert, kann eine zarte und bewegliche Stimme sehr rasch ruinieren. Nun kann ich aber beruhigt sagen: »Die Zeit ist reif und ich bin in jeglicher Hinsicht bereit für mein Rollendebüt als Elisabetta I.!«

Elena Mosuc als Lakmé in Oman/ EMI
Wir haben bereits Ihre besonderen Markenzeichen – die dramatischen Koloratursopran-Partien Mozarts oder die div. Belcanto-Rollen – angesprochen. Es gibt aber eine weitere tragende Säule innerhalb Ihres Bühnenrepertoires – noch dazu seit dem Anfang Ihrer Karriere: Ihre wichtigen Fachpartien Giuseppe Verdis! Erzählen Sie uns ein wenig über Ihr bisheriges Verdi-Repertoire und Ihre 2018 erschienene Verdi-ArienCD Verdi Heroines. Verdis fantastische Opernheldinnen (Gilda, Violetta – sogar als Hausdebüt an der Scala, Luisa Miller, Leonora, Medora, Desdemona und Alice Ford) aus Fleisch und Blut sind auch schon immer meine große Liebe gewesen, auch wenn man mich hin und wieder gerne in die Schublade mit der Aufschrift: »Mozart und Belcanto-Sängerin« stecken möchte! [Anm: sie lacht]. Auch wenn manche dies nicht wahrhaben wollen, begleiten mich diese Rollen sowieso schon seit Anbeginn meiner Bühnenkarriere. (Die Verdi-Partien der Gilda, Violetta und Luisa Miller habe ich sogar mehrfach an der Mailänder Scala singen dürfen.)
Das Programm meiner Verdi CD dürfte zunächst nicht nur das Publikum, die Rezensenten und die Entscheidungsträger der internationalen Opernszene etwas überrascht haben, sondern es sollte sogar eine Art von mir bewusst gewählter Wegweiser und eine aktuelle Bestandsaufnahme dahingehend sein, wohin mein Weg künftig führen soll, welche Optionen könnte es noch geben etc. So findet man auf diesem Album – neben meinen bühnenerprobten Partien wie beispielsweise Violetta und Leonora (Il trovatore) – sehr viel Neues, insbesondere aus der Epoche des »frühen Verdi«…
Etwa die dramatischen Koloraturen der Lucrezia (I due Foscari) wären sicherlich eine großartige künstlerische Herausforderung, welcher ich mich sehr gerne auch auf der Bühne stellen würde. Ähnlich empfinde ich auch für Amelia Grimaldi (Simon Boccanegra), die ich neulich an der Seite von Thomas Hampson auszugsweise in einer Operngala an den Ljubljana Festival mit großer Freude interpretieren durfte.
(Wenn die Rolle der Königin der Nacht einst für mich derart wichtige Türen der internationalen Opernszene geöffnet hatte, so kann ich guten Gewissens behaupten, dass Giuseppe Verdi bzw. seine La traviata mir – im 17ten Jahr meiner Bühnenkarriere – auch die Türen der Mailänder Scala geöffnet hat – eine Tatsache, die ich niemals vergessen werde (unter der Leitung von Maestro Lorin Maazel). Wie es wohl mit meiner Karriere an der MET weitergegangen wäre, wenn ich dort anstelle von Olympia auch mit einer Verdi-Rolle mein Hausdebüt hätte geben können, beschäftigt mich auch heute noch… denn Verdi verlangt wie seine Vorgänger aus der Epoche des Belcanto – neben einer Top-Stimme, einer felsenfesten Technik – auch sehr viel Einsatz, Enthusiasmus und Leidenschaft!)
Das Programm meiner Verdi CD dürfte zunächst nicht nur das Publikum, die Rezensenten und die Entscheidungsträger der internationalen Opernszene etwas überrascht haben, sondern es sollte sogar eine Art von mir bewusst gewählter Wegweiser und eine aktuelle Bestandsaufnahme dahingehend sein, wohin mein Weg künftig führen soll, welche Optionen könnte es noch geben etc. So findet man auf diesem Album – neben meinen bühnenerprobten Partien wie beispielsweise Violetta und Leonora (Il trovatore) – sehr viel Neues, insbesondere aus der Epoche des »frühen Verdi«… (Dieses mutige Experiment meinerseits dürfte offenbar auch die Fachjury überzeugt haben, da ich soeben erfahren habe, dass ich ausgerechnet wegen meines Albums „Verdi Heroines“ für den Opus Klassik-Preis 2019 nominiert worden bin!)
Es war vor kurzem mehreren Medienportalen zu entnehmen, dass Sie im September in einer ganz großen Rolle des frühen Verdi debütieren werden. Es handelt sich hierbei um die Rolle der Giselda in Verdis selten gespielten, vierten Oper I Lombardi alla prima crociata. Wie kam es zu diesem ganz speziellen Engagement Das ist eine wunderbare Überraschung und zugleich auch eine fabelhafte Herausforderung, die ich mir – ehrlich gesagt – niemals hätte träumen lassen! Noch dazu all das knapp vor meinem 30-jährigen Bühnenjubiläum.
Ohne überheblich zu klingen, kann ich gerne behaupten, dass es mich selbst auch immer wieder aufs Neue überrascht, welchen abwechslungsreichen Weg ich in diesen Jahrzehnten in puncto Bühnenrepertoire gehen konnte. Am Anfang stand noch wie gesagt die Mozart’sche Sternflammende Königin, eine Rolle, die – wie bereits erwähnt – sehr wohl den ursprünglichen Kern meines einstigen Repertoires darstellte.
Nach zahlreichen anderen Fachpartien für einen Mozart’schen Dramatischen Koloratursopran, unterschiedlichsten Belcanto-Heldinnen bis hin zu den Krönungspartien dieses Fachs wie Norma, Semiramide und Anna Bolena, berühmten Bühnencharakteren des vorwiegend »mittleren Verdi«, einigen bestimmten, großen Rollen aus dem französischen Fach und Zerbinetta – sogar in deren viel virtuoserer, höherer und längerer Urfassung bei den Salzburger Festspielen, war es nun an der Zeit, meine Fühler auch in andere Richtungen auszustrecken und der stetigen Weiterentwicklung meiner Stimme zu folgen…
Der erste konkrete Schritt in diese Richtung war die bereits erwähnte Verdi Arien CD »Verdi Heroines«. Keine drei Jahre nach den Aufnahmesitzungen zu meinem Verdi-Album darf ich mich nun in einer ersten und kompletten Rolle des »frühen Verdi« auch auf der Bühne ausprobieren!
Im deutschen Sprachraum pflegt man gerne in so einem Fall von einem sogenannten »Fachwechsel« zu sprechen – ich hingegen bevorzuge viel eher die Bezeichnung »Facherweiterung«, auch wenn diese Rollen primär und generell dramatischer sind als die meisten Partien meines bisherigen Bühnenrepertoires, dennoch liegen die Wurzeln dieser »ungezähmten Töchter des frühen Verdi« allesamt in der Epoche des italienischen Belcanto!
A propos italienischer Belcanto! Gerade diese Epoche – inkl. der Schaffensperiode des »frühen Verdi« liegt meinem lieben Freund, Csaba Némedi, dem österreichischen Opernregisseur und Musiktheaterwissenschaftler ungarischen Ursprungs, ganz besonders am Herzen. Nach mehreren Inszenierungen div. Belcanto-Opern in internationaler Besetzung, sowie auch etlichen Vorträgen zu diesem Thema sogar an der Universität Wien, bekam er nun die Möglichkeit, an der Ungarischen Oper zu Klausenburg (Rumänien) I Lombardi alla prima crociata zu inszenieren. Auch nach soviel Jahren Karriere auf den großen und größten Opernbühnen der Welt ist es immer wieder ein wunderbares Gefühl, wenn man im Fall einer geplanten Neuproduktion nicht nur die Erstbesetzung, sondern zugleich auch die absolute Wunschbesetzung eines Dirigenten oder Regisseurs sein darf!
Im Frühstadium des Einstudierens dieser Rolle ist mir aufgefallen, dass die Partie der Giselda bisher von den unterschiedlichsten Sängerinnen interpretiert worden ist. Auch wenn die Aufführungspraxis und Diskografie dieser Oper bzw. dieser Rolle nicht einmal annähernd so reichhaltig ist wie die der anderen berühmten Verdi-Heldinnen, sieht man sofort, dass solch unterschiedliche Sängerinnen in dieser Rolle zu reüssieren wussten wie beispielsweise die junge Renata Scotto – zu einem Zeitpunkt ihrer Karriere, in welchem sie auch noch sehr viele Belcanto-Rollen zu singen pflegte, aber auch Luciana Serra, die man generell als lyrisch-leichte Virtuosa bezeichnen kann. Parallel zu diesen beiden seien natürlich auch Legenden wie die hochdramatische Ghena Dimitrova und die einzigartige Cristina Deutekom erwähnt, die sicherlich die Giselda innerhalb ihrer künstlerischen Generation war… [Anm.: Ich habe mich überdies auch mit der Rezeptionsgeschichte und Aufführungspraxis dieser Rolle in zwei ausführlichen Notizen via Facebook auseinandergesetzt;
Fakt ist aber, dass diese Rolle mir – auch bezüglich ihres Temperaments und Charakters – sehr entspricht. Musikalisch betrachtet konzentriere ich mich selbstverständlich auf meine eigene Interpretation, d.h. auch diese Rolle werde ich – ohne jemanden von den großen erwähnten Vorgängerinnen kopieren zu wollen – mit meiner eigenen Stimme singen und mit meinen eigenen stimmlichen Mitteln ausstatten. Da die Stilistik und v.a. auch das heterogene Spektrum der vokalen Anforderungen derart reichhaltig, fordernd und anspruchsvoll ist, ist es absolut legitim und korrekt, sich dieser Rolle belcantesk zu nähern. Trotz aller in der Partie enthaltenen Dramatik, halte ich es für absolut verkehrt, Giselda veristisch anmutend zu interpretieren, zumal es einerseits gar nicht zu meiner Stimme passen würde, außerdem existierte ja zum Zeitpunkt der Entstehung von I Lombardi die spätere Epoche des Verismo noch gar nicht…
Neben den primären Anforderungen an die Stimme und Stimmtechnik darf man im Fall von Giselda auch die Stimmökonomie im Allgemeinen nicht außer acht lassen – man muss sich seine Kräfte irrsinnig gut einteilen, da die Rolle extrem lang ist. Um es vereinfacht auszudrücken, würde ich sagen: Diese Rolle ist genauso lang wie Norma, jedoch mindestens fünfmal schwerer, fordernder und komplexer! Dies wurde mir natürlich auch beim Rollenstudium immer bewusster. Es ist also kein Wunder, dass dieses Werk so selten aufgeführt wird…
Dass ich ausgerechnet jetzt – noch dazu als Wunschbesetzung der rumänischen Erstaufführung des Werks – Giselda singen darf, erfüllt mich mit sehr großer Freude, Dankbarkeit und Demut. Der Erfolg meiner vorausgegangenen Verdi CD und das bevorstehende Rollendebüt als Giselda lassen mich hoffen, künftig auch in weiteren und neuen Verdi-Rollen in Erscheinung zu treten.
Wir sind dankbar der Ungarischen Oper Cluj ( Kolozsvari Magyar Opera, Rumänien ) die uns ermöglichte, diesen Projekt zu realisieren und unseren Traum Realität werden zu werden mit der Première am 26 September 2019.

Elena Mosuc/ Foto EM
Nachdem wir bereits über Ihre Karriere als Mozart-, Belcanto- und Verdisängerin gesprochen haben, möchte ich Sie dennoch auf ein weiteres, ganz wichtiges und bedeutendes Rollendebut ansprechen, welches erst im Frühling diesen Jahres stattgefunden hat: Sie sangen zum ersten Mal die Titelpartie von L. Delibes‘ Lakmé am Royal Opera House Muscat. Wie kam es zu diesem – zugegebenermaßen überraschenden – Rollendebüt? Darf man diese Rolle lediglich auf das aus den div. TV-Werbespots bekannte Blumenduett und die mit wahnwitzigen Koloraturen gespickte Glöckchenarie reduzieren? Lakmé ist eine wahre Rarität, bzw. eine eine Rarität geworden… Eigentlich sehr schade!
Vor knapp 20 Jahren, als ich meine erste Arien-CD-Aufnahme gemacht habe, durfte natürlich auch die berühmt-berüchtigte Glöckchenarie aus dem Programm nicht fehlen und es machte mir damals sehr viel Freude und Spaß, diese wahnwitzige Arie zu singen. Nach dem Erfolg dieses Albums habe ich schon irgendwie gehofft, dass ich Engagements für diese Rolle bekäme… aber es kam leider anders.
Ich finde es sehr bedauerlich, dass man diese Rolle lediglich auf die Kehlkopfakrobatik der Sängerin reduziert. Diese Betrachtungsweise ist völlig falsch und lässt eindeutig durchblicken, dass viele Menschen – auch Entscheidungsträger aus der Opernbranche – die Rolle in ihrer Gesamtheit gar nicht kennen…
Dass Lakmés Auftritt – das sogennante orientalische Gebet – oder das Blumenduett sowie auch die Glöckchenarie ganz klar einen Bravourkoloratursopran erfordern, steht außer Zweifel, aber der Rest der Rolle verlangt eindeutig nach einem vollen und durchschlagskräftigen lyrischen Sopran – nach einer Stimme, die sonst in der Lage wäre, etwa auch die Titelpartie von Madama Butterfly mühelos zu bewältigen. Da die Anforderungen dieser Partie derart heterogen sind, müsste man fast sagen, dass man für diese Rolle zwei verschiedene Sängerinnen bräuchte, nämlich einen Bravourkoloratursopran und einen soprano lirico bzw. soprano lirico spinto. (Noch dazu muss man bei Lakmé immer unterscheiden, von welchem Teil der Rolle man spricht, denn die Glöckchenarie ist eine ganz klare Trennlinie.)
Wenn ich schon im Zusammenhang mit Giselda davon erzählte, welche Schwierigkeiten und spezielle Herausforderungen sich beim Rollenstudium gezeigt haben, muss ich gleich hinzufügen, dass ich fürs Studium der Lakmé gerade mal nur drei Wochen zur Verfügung hatte – erst so kurzfristig bekam ich nämlich die Anfrage vom Royal Opera House Muscat (Oman). (Nur für Giselda brauchte ich vier Wochen, um die ganze Rolle einzustudieren und dies soll auch ein weiterer Hinweis auf den wahren Schwierigkeitsgrad dieser Partie sein…)
In Muscat wir haben drei Wochen hart und intensiv für die Première gearbeitet, ich habe einen Tag- max zwei Tage frei gehabt, war aber sehr motiviert eine schöne Interpretation und einen schönen Charakter zu liefern, das Team war total voll dabei und das Resultat war fantastisch. Der Regisseur Davide Livermore hatte fantastische Ideen und die ganze moderne Technik und alle Möglichkeiten brachten als Resultat eine traumhafte Inszenierung, was das Publikum und die internationale Presse begeisterte.
Abschließend möchte ich festhalten, dass die diesjährige Opernsaison mir drei völlig unterschiedliche und jeweils sehr anspruchsvolle Rollendebüts (Lakmé, Magda – in La rondine und Giselda) beschert hat – noch dazu alles Rollen, mit denen ich fast nicht gerechnet hätte! Es scheint also irgendwie auch mein Schicksal zu sein, während meiner gesamten Karriere, ausschließlich schwere und äußerst anspruchsvolle Partien singen zu dürfen. Ein schweres, aber auch ein einzigartiges und wunderschönes Los, wofür ich sehr dankbar bin!
Kaum haben Sie Ihr Rollendebüt als Lakmé erfolgreich hinter sich gebracht, haben Sie die Nachricht erhalten, dass Sie mit dem International Opera Award – Oscar della lirica (Kategorie: Best Soprano) ausgezeichnet worden sind In der Tat, dieser Preis bzw. diese renommierte Anerkennung war für mich eine Überraschung der ganz speziellen Art! Ich befand mich – nach den bereits erwähnten Lakmé-Vorstellungen – auf dem Heimflug von Muscat nach Zürich… Die offizielle und feierliche Verleihung findet am 1. Oktober 2019 – im Rahmen eines Festkonzerts – am Teatro Malibran in Venedig statt, wo ich gemäß meines aktuellen Repertoires die große Szene des Giselda aus I Lombardi und natürlich auch die große Aria aus La traviata singen werde. (Das besagte Bühnenjubiläum möchte ich übrigens nächstes Jahr gesondert auch mit einer eigenen Operngala feiern, diese ist also gerade noch in Planung.)
Elena Mosuc versichert, die Abbildungsrechte für die hier gezeigten Foto zu besitzen.
https://www.facebook.com/notes/csaba-némedi/i-lombardi-blog-elena-mosuc-giselda/2290138567688618/ und https://www.facebook.com/notes/csaba-némedi/i-lombardi-blog-elena-mosuc-giselda/2459722144063592/ ]






 Ich erinnere mich auch an diese Abende mit Herbert von Karajan und anderen in der Berliner Philharmonie, wo sie ihre immer afrikanischer werdenden Roben zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Auftritte machte. Sie hatte da bereits in Frankreich ein drastisches image-polishing erfahren und stand nun als die große Heroine des Gesangs vor uns: stolz, aztekisch anmutend, charismatisch und geheimnisvoll. Sie war neu erfunden, war durch Video-Auftritte und die vielen, vielen Einzel-LPs/CDs bei Philips mit den fabelhaften Covers zur Ikone der Musik geworden. Namentlich die Franzosen (Sergio Segalini von L´Opéra vor allem) wiesen ihr den Göttinnen-Status zu, der in ihre Umhüllung in die Trikolore zum 14. Juli mündete (man hat immer schon schwarze Sängerinnen in Frankreich geliebt, vor allem Amerikanerinnen wie Josephine Baker, Ethel Semser, Barbara Hendricks bis zu – nun – Pretty Yende).
Ich erinnere mich auch an diese Abende mit Herbert von Karajan und anderen in der Berliner Philharmonie, wo sie ihre immer afrikanischer werdenden Roben zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Auftritte machte. Sie hatte da bereits in Frankreich ein drastisches image-polishing erfahren und stand nun als die große Heroine des Gesangs vor uns: stolz, aztekisch anmutend, charismatisch und geheimnisvoll. Sie war neu erfunden, war durch Video-Auftritte und die vielen, vielen Einzel-LPs/CDs bei Philips mit den fabelhaften Covers zur Ikone der Musik geworden. Namentlich die Franzosen (Sergio Segalini von L´Opéra vor allem) wiesen ihr den Göttinnen-Status zu, der in ihre Umhüllung in die Trikolore zum 14. Juli mündete (man hat immer schon schwarze Sängerinnen in Frankreich geliebt, vor allem Amerikanerinnen wie Josephine Baker, Ethel Semser, Barbara Hendricks bis zu – nun – Pretty Yende).
 Und das bewährte Wikipedia fügt an:
Und das bewährte Wikipedia fügt an: Um diese Zeit begann Norman, sich verstärkt mit dem Liedrepertoire zu beschäftigen, das sich als für ihre Stimme besonders geeignet erwies. Bis 1980 sang sie keine weiteren Opern, sondern konzentrierte sich ausschließlich auf die Welt der Lieder, in der sie sich ein bemerkenswertes Repertoire erarbeitete. Zu ihren Spezialitäten gehörten Wagners Wesendonck-Lieder, die Gurre-Lieder von Arnold Schönberg und Alban Bergs Altenberglieder. Außerdem beschäftigte sie sich ausführlich mit französischen Komponisten wie Henri Duparc, Francis Poulenc, Gabriel Fauré und den Liedern Modest Petrowitsch Mussorgskis.
Um diese Zeit begann Norman, sich verstärkt mit dem Liedrepertoire zu beschäftigen, das sich als für ihre Stimme besonders geeignet erwies. Bis 1980 sang sie keine weiteren Opern, sondern konzentrierte sich ausschließlich auf die Welt der Lieder, in der sie sich ein bemerkenswertes Repertoire erarbeitete. Zu ihren Spezialitäten gehörten Wagners Wesendonck-Lieder, die Gurre-Lieder von Arnold Schönberg und Alban Bergs Altenberglieder. Außerdem beschäftigte sie sich ausführlich mit französischen Komponisten wie Henri Duparc, Francis Poulenc, Gabriel Fauré und den Liedern Modest Petrowitsch Mussorgskis.


 Gibt es eine bestimmte Aufführung oder Aufführungsserie der Zauberflöte, die Ihnen auch aus heutiger Sicht noch ganz besonders am Herzen liegt?
Gibt es eine bestimmte Aufführung oder Aufführungsserie der Zauberflöte, die Ihnen auch aus heutiger Sicht noch ganz besonders am Herzen liegt?





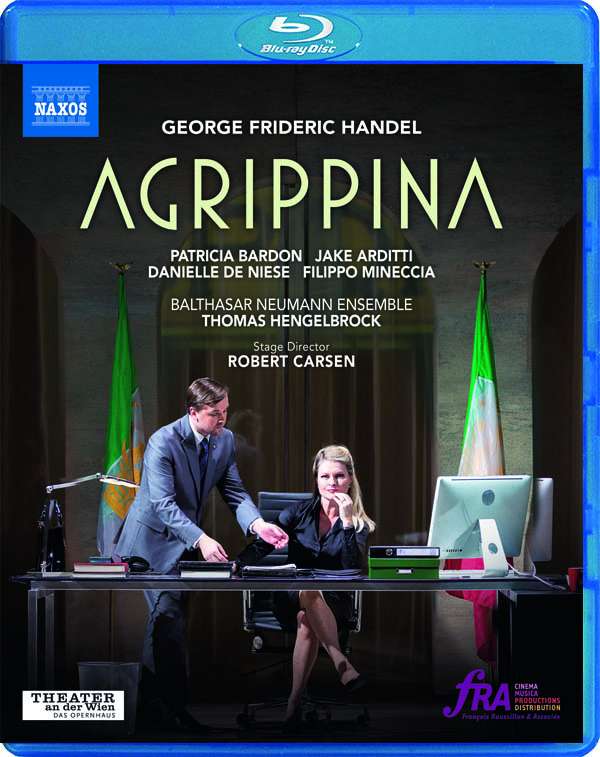










 Diesem bei der Uraufführung von Lucien Petipa, dem Bruder des berühmteren Marius, choreographierte sinnfreiem Einschub mit tanzenden Zigeuner und Soldaten vor der Ergreifung Azucenas unterlegt Wilson
Diesem bei der Uraufführung von Lucien Petipa, dem Bruder des berühmteren Marius, choreographierte sinnfreiem Einschub mit tanzenden Zigeuner und Soldaten vor der Ergreifung Azucenas unterlegt Wilson „Sung in French“:
„Sung in French“: Habenswert
Habenswert







