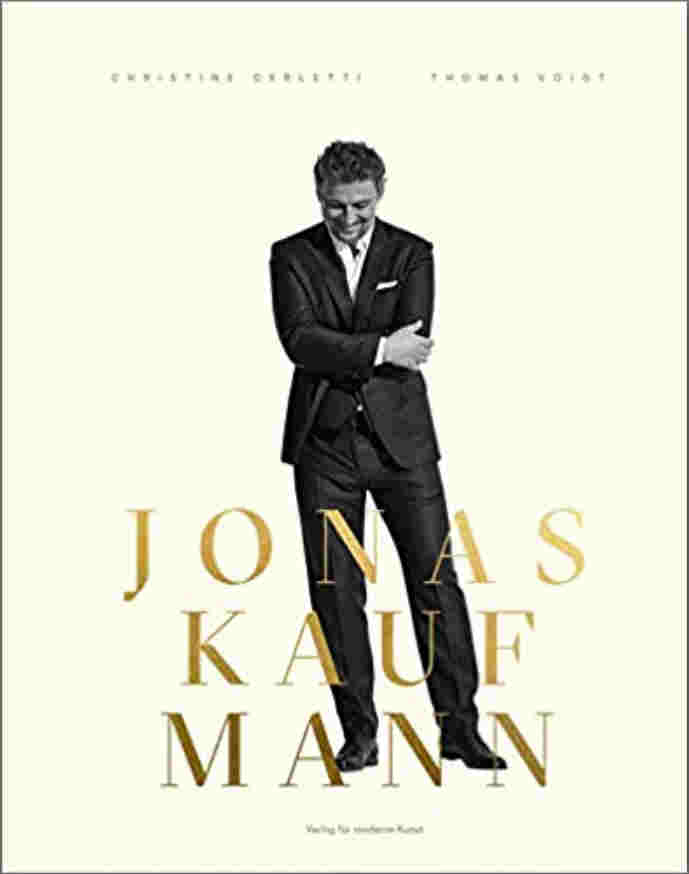Die französische Firma Aparte bringt zwei Recitals heraus, welche die Herzen von Barockfreunden und Raritäten-Sammlern höher schlagen lassen. Beide wurden Ende 2018 bzw. Anfang 2019 aufgenommen – das erste im September in Metz in Zusammenarbeit mit dem Centre de musique baroque de Versailles. Es trägt den Titel „L’opéra du roi soleil“ und wird gestaltet von der englischen Sopranistin Katherine Watson und dem Ensemble Les Ambassadeurs unter Leitung von Alexis Kossenko (AP 209). Das Programm umfasst Ausschnitte aus der französischen Oper des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter seltene oder erstmals aufgenommene Titel, wie es das Anliegen des koproduzierenden CMBV ist. Gleich der Auftakt, die Arie der Eurydice, „Ah! que j’éprouve bien que lámoureuse flamme“, aus Louis de Lullys Orphée von 1690, ist eine Rarität. Es ist ein getragenes Lamento, das Eurydices Zweifel, ob Orphée sie noch liebt, eindrücklich wiedergibt. Die Sopranistin lässt einen schmerzlichen Tonfall hören, welcher der existentiellen Situation perfekt entspricht.
Der folgende Komponist, Marin Marais, ist in der Barocklandschaft kein Unbekannter. Aus seiner Oper Alcyone, die in dieser Saison am Gran Teatre del Liceu von Barcelona gezeigt wird, erklingen die Ouverture sowie die rhythmisch reizvolle Marche pour les und das pompöse Deuxième Air des Matelots. Aus Ariane et Bacchus gibt es sogar vier Ausschnitte – die wehmütige Arie der Titelheldin, „Croirai-je“, die sehr delikat musizierte Symphonie du sommeil, das Air pour les flutes und das Rondeau. In diesen Instrumentalstücken imponiert das Orchester mit farbigem, akzentuiertem Spiel.
Auch von André Campra finden sich in der Programmfolge mehrere Titel. Aus seinem Idoménée von 1712 bzw. der Version von 1732 gibt es die feierliche Chaconne, die Arie der Illione „Espoir des malheureux“ und die Arie der Vénus „Coulez, ruisseaux“. Auch die Arie der Zaide, „Mes yeux“, aus L’Europe galante von 1697 steht in ihrem Lamento-Charakter ganz in der Tradition der tragédie-lyrique. Vier Szenen aus Téléphe (1713) bringen die Sarabande und drei Arien von La Pythonisse, von denen besonders die letzte, „Quelle épaisse vapeur“, durch ihren majestätischen Charakter heraus ragt.
Natürlich darf in einer solchen Anthologie Jean-Baptiste Lully nicht fehlen. Es finden sich die Arie der Galatée, „Enfin, j’ai dissipé la crainte“, aus Acis et Galatée (1686), welche von Watson zunächst gefühlvoll, später sehr engagiert vorgetragen wird, die wehklagende Arie von Une Femme affligée, „Deh, pangete al pianto mio“, aus Psyché und die tänzerisch beschwingte Marche pour la cérémonie des Turcs aus Le Bourgeois gentilhomme.
Zu erwähnen sind noch Titel von weiteren unbekannten Komponisten – eine furiose und eine klagende Arie der Titelheldin aus Circé von Henri Desmarest sowie zwei Szenen aus Werken von Jean-Baptiste Stuck. Aus dessen Thétis et Pélée erklingt in pompöser Feierlichkeit und Koloraturjubel das Air ajouté „Non sempre guerriero“, aus Polydore die Arie der Ilione „C’en donc fait“, welche noch einmal den Sopran in seiner technischen Kompetenz und sensiblen Gestaltungsintensität zeigt. Benrd Hoppe
Nicht weniger originell ist das Recital mit der Sopranistin Sophie Karthäuser und dem Ensemble Le Concert de la Loge unter Julien Chauvin (AP 210). Es wurde im Oktober 2018 im Pariser Louvre bzw. im März 2019 im Conservatoire Jean-Baptiste Lully in Puteaux aufgenommen und trägt den Titel „Haydn – L’Impatiente“. Auch hier finden sich unbekannte Komponisten, wie die dreisätzige, dramatisch pulsierende Symphonie en ré mineur, op. 10 no 1 von Louis-Charles Ragué, welche die Anthologie beendet, oder die Arie der Titelheldin, „Il va venir“, aus Jean-Baptiste Lemyones Phèdre. Dagegen nimmt sich der Auftakt der Programmfolge geradezu populär aus. Es ist Haydns Symphonie no 87 en la majeur, deren Untertitel „L’Impatiente“ der Sammlung den Titel gab. Das Orchester verleiht dem 1. Satz, Vivace, federnden Schwung, breitet das folgende Adagio mit starker Empfindung aus, setzt im Menuet – Trio übermütige Akzente und beschließt die Komposition mit heiterem Elan. Auch die Arie der Eurydice, „Fortune ennemie“, aus Glucks Orphée et Eurydice ist ein sattsam bekannter Titel. Die Anthologie wird vervollständigt von weiteren Raritäten – der Arie der Titelheldin „C’ est votre bonté“ aus Antonio Sacchinis Chimène ou Le Cid, der Arie der Dircée „Age d’or“ aus Johann Christoph Vogels Démophon und der Arie der Éliane „O sort“ aus André-Ernest-Modeste Grétrys Les Mariages samnites. Sophie Karthäuser lässt in den Gesangsnummern einen reizvoll timbrierten Sopran hören, der in den lyrischen Szenen mit reicher Empfindung berührt und in den dramatischen mit flammender Intensität imponiert. Bernd Hoppe
 Ein originelles Konzept erdachte der katalanische Countertenor Xavier Sabata für sein im Januar 2018 aufgenommenes Recital bei APARTÉ (192). Unter dem Titel L’Alessandro amante stellt er elf Arien aus zehn Barockopern von acht verschiedenen Komponisten vor, die sich sämtlich mit der Person Alexander des Großen oder einer aus dessen Umfeld beschäftigen. In der Geschichte der Oper ist Alexander eine der am meisten in Musik gesetzten Figuren – Metastasios Libretto Alessandro nell’Indie von 1726 wurde über 65mal vertont. Die Spanne des Programms reicht chronologisch von Antonio Draghis La Vittoria della fortezza (Uraufführung 1687 in Wien) bis zu Leonardo Leos Alessandro in Persia (1741, London) und bietet die Möglichkeit, den vielschichtigen Charakter des berühmten Feldherren zu beleuchten – den Kämpfer und Liebhaber. Darunter finden sich viele Raritäten, so die beiden Titel von Giovanni Battista Bononcini, welche die Anthologie eröffnen – das straffe Preludio aus seinem Abdolomino (1711, Neapel) und die Arie von Alessandros treuem Begleiter Efestione „Da tuoi lumi“ aus L’Euleo festeggiante nel ritorno d’Alessandro Magno dall’Indie (1699, Wien). Später folgt aus dieser Serenade noch eine klagende Arie des Alessando, „Chiare faci“. Sabata nimmt vom ersten Ton an mit seiner weichen, sinnlichen Stimme für sich ein, die sanft und wohltönend erklingt, in den Koloraturläufen mit gebotener Virtuosität aufwartet. In zwei Arien der Titelhelden aus Opern Händels, welche die einzig bekannten der Sammlung markieren, kann der Counter besonders imponieren. Aus Poro, re dell’Indie (1731, London) singt er das getragene, emotionsstarke „Se possono tanto“, welches er im Da capo phantasievoll variiert, aus Alessandro (1726, London) „Vano amore“, wo er energisch auftrumpft und mit einem rasanten Koloraturfeuerwerk brilliert.
Ein originelles Konzept erdachte der katalanische Countertenor Xavier Sabata für sein im Januar 2018 aufgenommenes Recital bei APARTÉ (192). Unter dem Titel L’Alessandro amante stellt er elf Arien aus zehn Barockopern von acht verschiedenen Komponisten vor, die sich sämtlich mit der Person Alexander des Großen oder einer aus dessen Umfeld beschäftigen. In der Geschichte der Oper ist Alexander eine der am meisten in Musik gesetzten Figuren – Metastasios Libretto Alessandro nell’Indie von 1726 wurde über 65mal vertont. Die Spanne des Programms reicht chronologisch von Antonio Draghis La Vittoria della fortezza (Uraufführung 1687 in Wien) bis zu Leonardo Leos Alessandro in Persia (1741, London) und bietet die Möglichkeit, den vielschichtigen Charakter des berühmten Feldherren zu beleuchten – den Kämpfer und Liebhaber. Darunter finden sich viele Raritäten, so die beiden Titel von Giovanni Battista Bononcini, welche die Anthologie eröffnen – das straffe Preludio aus seinem Abdolomino (1711, Neapel) und die Arie von Alessandros treuem Begleiter Efestione „Da tuoi lumi“ aus L’Euleo festeggiante nel ritorno d’Alessandro Magno dall’Indie (1699, Wien). Später folgt aus dieser Serenade noch eine klagende Arie des Alessando, „Chiare faci“. Sabata nimmt vom ersten Ton an mit seiner weichen, sinnlichen Stimme für sich ein, die sanft und wohltönend erklingt, in den Koloraturläufen mit gebotener Virtuosität aufwartet. In zwei Arien der Titelhelden aus Opern Händels, welche die einzig bekannten der Sammlung markieren, kann der Counter besonders imponieren. Aus Poro, re dell’Indie (1731, London) singt er das getragene, emotionsstarke „Se possono tanto“, welches er im Da capo phantasievoll variiert, aus Alessandro (1726, London) „Vano amore“, wo er energisch auftrumpft und mit einem rasanten Koloraturfeuerwerk brilliert.
Giovanni Battista Pescettis Vertonung von Metastasios Libretto wurde 1732 in Venedig uraufgeführt. Der Komponist war später der Lehrer von Josef Myslivecek und Antonio Salieri. Sabata stellt Alessandros Arie „Serbati a grandi imprese“ vor, die in ihrem wiegenden siciliano-Rhythmus die Schönheit und Sanftmut seiner Stimme besonders herausstellt. Aus dem frühesten Werk der Zusammenstellung, Draghis Einleitung zum Ballett La Vittoria della fortezza, erklingen zwei kurze Arietten Alessandros im Canzonetta-Charakter. Den neapolitanischen Stil vertritt Francesco Mancini mit Alessandro il Grande in Sidone, uraufgeführt 1706 in Neapel. Daraus ist die Arie des Eumene, „Spirti fieri“, zu hören, in welcher der Counter mit heroischer Verve aufwartet und einmal die Agilität seiner Stimme demonstriert. Auch Leonardo Vincis Version (1730, Rom) repräsentiert diesen Stil. Alessandros Arie „Serbati a grandi imprese“ war vorher bereits in Pescettis Vertonung zu hören, hier klingt sie eher beschwingt, doch lässt sie mit ihren getupften staccati Sabatas Stimme gleichfalls zu schöner Wirkung kommen.
Leonardo Leo führt zum galanten Stil. Seine Oper nennt sich Alessandro in Persia (1741, London). Die Arie der Titelfigur, „Dirti, ben mio“, ist eine zärtliche Liebeserklärung, die Sabata mit schmeichelnden Tönen formuliert. Mit Nicola Porporas Poro (1731, Turin) endet das Recital höchst spektakulär, denn der Komponist widmete sie der Kastraten-Legende Farinelli. Poros Arie „Destrier ch’all’armi usato“ porträtiert den Feldherren Alexander mit Koloraturbravour und schmetterndem Klang der Trompeten und Hörner, die im Wettstreit mit dem Sänger auch mal in Bedrängnis geraten.
Sabata unterstreicht mit dieser CD eindrucksvoll seine prominente Position unter den derzeit führenden Vertretern seiner Gattung.
Das den Sänger begleitende Ensemble Vespres d’Arnadí unter Leitung von Dani Espasa kann sich schon im Eröffnungsstück imponierend profilieren, wie auch in den später folgenden Instrumentalnummern – der gewichtigen Sinfonia aus Agostino Steffanis Il Zelo di Leonato (1691, Hannover) und der tänzerischen aus Francesco Mancinis Alessandro il Grande in Sidone (1706, Neapel). In den Klangteppich des Orchesters ist die Stimme Sabatas harmonisch eingebettet, wirkt aber dennoch stets präsent. Bernd Hoppe






 Der zweite Teil des Buches befasst sich mit den deutschen Orchestern, d.h. der Bedeutung der DOV, der Frage, ob Unkündbarkeit gleich Qualitätsverlust sei, der Problematik von zwei Orchestern an einem Ort ( z.B. Dresden oder Wien) und der Orchestertypologie. Interessant zu erfahren ist, dass die Bamberger Symphoniker von böhmischen Musikern gegründet wurden, die Philharmonia Hungarica, inzwischen aufgelöst, von 1956 geflüchteten Ungarn.
Der zweite Teil des Buches befasst sich mit den deutschen Orchestern, d.h. der Bedeutung der DOV, der Frage, ob Unkündbarkeit gleich Qualitätsverlust sei, der Problematik von zwei Orchestern an einem Ort ( z.B. Dresden oder Wien) und der Orchestertypologie. Interessant zu erfahren ist, dass die Bamberger Symphoniker von böhmischen Musikern gegründet wurden, die Philharmonia Hungarica, inzwischen aufgelöst, von 1956 geflüchteten Ungarn.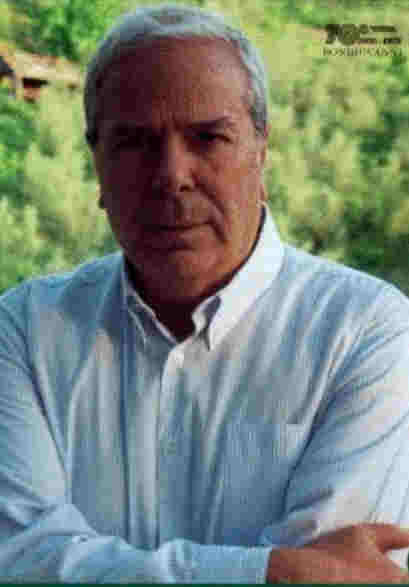
 Sein Repertoire umfasste zuletzt mehr als 150 Opern, darunter besonders Verdi und Puccini. In komischen Rollen feierte er seine größten Erfolge, so als Ford in Verdis Falstaff, in beiden Figaro-Partien von Mozart und Rossini, ferner als Leporello, Guglielmo und Alfonso bei Mozart, als Belcore und Dulcamara in L’elisir d’amore von Donizetti sowie in der Titelrolle von dessen Don Pasquale. Den Gianni Schichi sang er noch 2011 im Alter von 87 Jahren. Aber auch neueren Opern gegenüber war Panerai aufgeschlossen, so etwa Hindemiths Mathis der Maler und Der feurige Engel von Prokofjew. Zu seinen Gesangspartnern zählten solche Größen wie Maria Callas, Renata Scotto, Beverly Sills, Giuseppe di Stefano, Carlo Bergonzi und Nicolai Gedda. Seine womöglich berühmtesten Einspielungen machte er unter Herbert von Karajan in dessen legendärer Bohème neben Pavarotti und Freni (1973) und später auch im Falstaff (1980). Das Gros seiner Studioaufnahmen entstand indes bereits in den 1950er und 60er Jahren. Ja sogar Wagner hat er gesungen, wie eine italienischsprachige Aufnahme des Parsifal von 1950 beweist (neben der Callas und Boris Christoff). Selbst im greisenhaften Alter war er noch als Gesangslehrer tätig und versuchte sich daneben auch als Opernregisseur, so zuletzt noch im Vorjahr in Genua mit Gianni Schicchi. 1992 wurde er zum österreichischen Kammersänger ernannt.
Sein Repertoire umfasste zuletzt mehr als 150 Opern, darunter besonders Verdi und Puccini. In komischen Rollen feierte er seine größten Erfolge, so als Ford in Verdis Falstaff, in beiden Figaro-Partien von Mozart und Rossini, ferner als Leporello, Guglielmo und Alfonso bei Mozart, als Belcore und Dulcamara in L’elisir d’amore von Donizetti sowie in der Titelrolle von dessen Don Pasquale. Den Gianni Schichi sang er noch 2011 im Alter von 87 Jahren. Aber auch neueren Opern gegenüber war Panerai aufgeschlossen, so etwa Hindemiths Mathis der Maler und Der feurige Engel von Prokofjew. Zu seinen Gesangspartnern zählten solche Größen wie Maria Callas, Renata Scotto, Beverly Sills, Giuseppe di Stefano, Carlo Bergonzi und Nicolai Gedda. Seine womöglich berühmtesten Einspielungen machte er unter Herbert von Karajan in dessen legendärer Bohème neben Pavarotti und Freni (1973) und später auch im Falstaff (1980). Das Gros seiner Studioaufnahmen entstand indes bereits in den 1950er und 60er Jahren. Ja sogar Wagner hat er gesungen, wie eine italienischsprachige Aufnahme des Parsifal von 1950 beweist (neben der Callas und Boris Christoff). Selbst im greisenhaften Alter war er noch als Gesangslehrer tätig und versuchte sich daneben auch als Opernregisseur, so zuletzt noch im Vorjahr in Genua mit Gianni Schicchi. 1992 wurde er zum österreichischen Kammersänger ernannt.
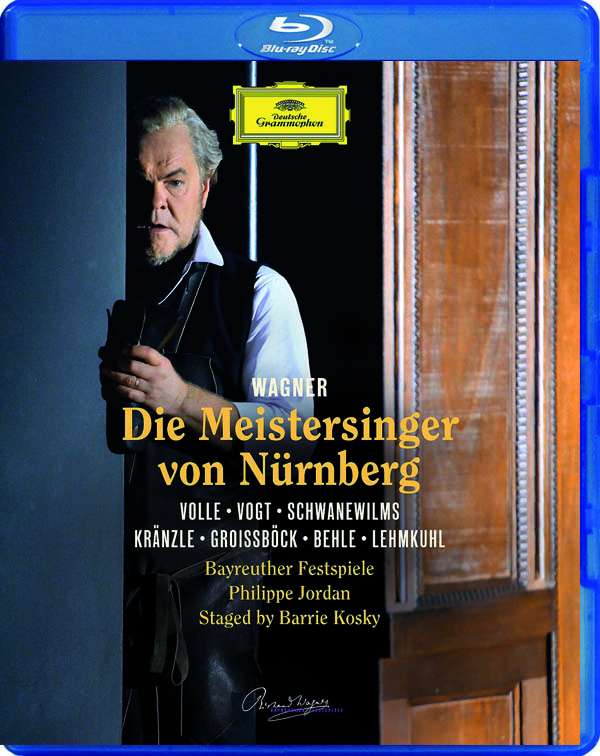


 Im Booklet zur CD-Ausgabe bei Ars schreibt Johannes Held, dass sie beide unabhängig voneinander schon lange mit Schuberts Winterreise
Im Booklet zur CD-Ausgabe bei Ars schreibt Johannes Held, dass sie beide unabhängig voneinander schon lange mit Schuberts Winterreise