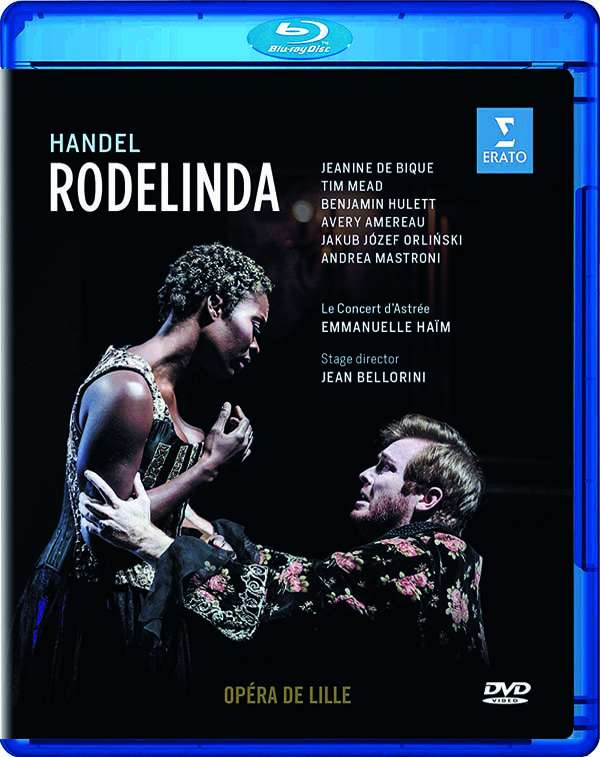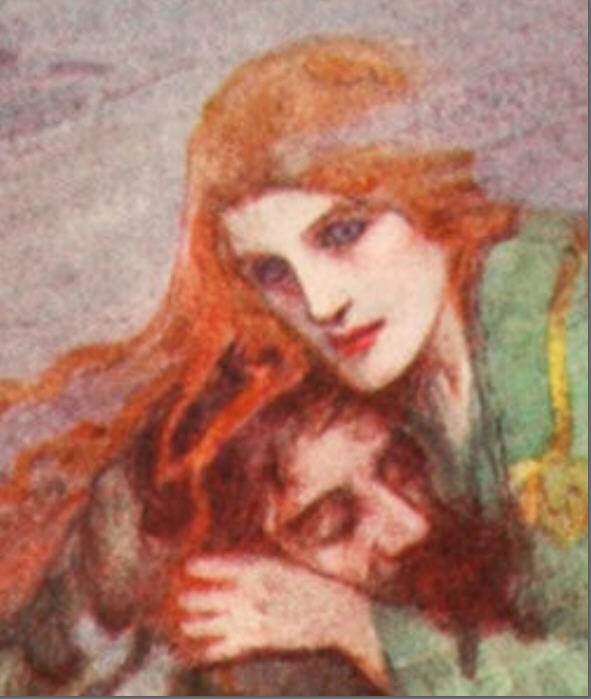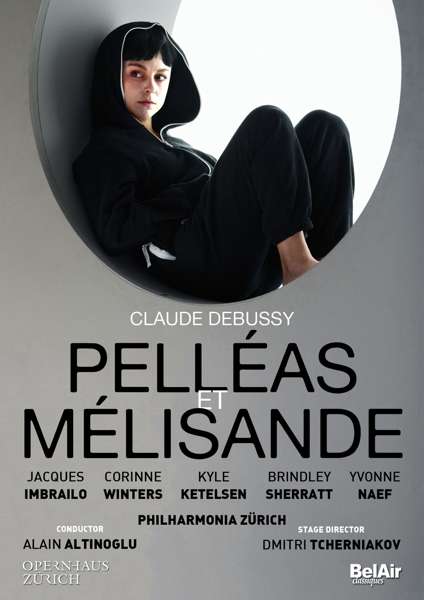Das große Berlioz-Jahr 2019 neigt sich seinem Ende zu. Blickt man auf die Diskographie, die im letzten halben Jahrhundert stattlich angewachsen ist und mittlerweile (fast) keine Wünsche offenlässt, dann kann man sich freilich schon fragen, ob es zum Beispiel einer weiteren Einspielung der Grande Messe des morts, des monumentalen Requiems, bedarf. Ein Mangel an vorbildlichen Aufnahmen besteht eigentlich nicht, denken wir an den Klassiker von Colin Davis (Philips), an die Darbietung von Charles Munch (RCA) oder auch an Bernsteins eigenwillige Lesart (CBS).
 Und doch handelt es sich bei den von Erato vorgelegten Neuerscheinungen in Sachen Berlioz keinesfalls um 08/15-Interpretationen, für alle von John Nelson dirigierten Aufnahmen gilt dies. So auch für die beiden neusten Einspielungen im Rahmen einer geplanten Gesamtaufnahme aller Werke Berlioz´unter Nelson (eine ausgiebige Besprechung der in Strasburg aufgenommenen Troyens findet sich hier).
Und doch handelt es sich bei den von Erato vorgelegten Neuerscheinungen in Sachen Berlioz keinesfalls um 08/15-Interpretationen, für alle von John Nelson dirigierten Aufnahmen gilt dies. So auch für die beiden neusten Einspielungen im Rahmen einer geplanten Gesamtaufnahme aller Werke Berlioz´unter Nelson (eine ausgiebige Besprechung der in Strasburg aufgenommenen Troyens findet sich hier).
Den besonderen Anspruch erkennt man bereits auf dem Cover des Requiem (Erato 0190295430641), wo nicht nur der Aufnahmeort – die St Paul’s Cathedral in London –, sondern auch die Namen Michael Spyres und John Nelson aufscheinen. Wer sich auch nur ein klein wenig mit heutigen Berlioz-Interpreten beschäftigt hat, weiß, dass dies verheißungsvoll anmutet. Im französischsprachigen Repertoire kommt dem Tenor Spyres heutzutage kaum einer gleich. Und dass Nelson mittlerweile zum Spiritus rector unter den lebenden Berlioz-Dirigenten geworden ist, sollte auch längst kein Geheimnis mehr sein. Erato ließ sich also nicht lumpen, was man auch beim hier mitwirkenden Klangkörper, dem renommierten Philharmonia Orchestra, sowie den beiden Chören, dem London Philharmonic Choir sowie dem Philharmonia Chorus, behaupten kann. Kurzum: Die Neuproduktion hat durchaus das Zeug, die Diskographie des Werkes zu bereichern. Tatsächlich tut sie dies auch. Nelson weiß den gewaltigen Raum mit seinem langen Nachhall zum Teil seiner Interpretation zu machen und kommt damit den schwierigen Bedingungen bei der Uraufführung im Pariser Invalidendom durchaus nahe. Seine langjährige Erfahrung trägt dazu bei, dass er nie den Überblick verliert und die gewaltigen Klangmassen zusammenhalten kann. Die Tontechnik wird in der Live-Aufnahme vom 8. März 2019 – obwohl „nur“ auf CD – auch den Höhepunkten Herr, so gerade im spektakulären Dies irae. Der anderswo als störend empfundene Hall erscheint hier insgesamt adäquat. Das Philharmonia Orchestra legt sich hörbar ins Zeug; insbesondere die in dieser Totenmesse so bedeutsamen Blechbläser brillieren. Nelsons Zugang ist insgesamt eher auf der kontemplativen denn auf der dramatischen Seite – sicherlich eine legitime und hier auch überzeugende Lesart. Spyres schließlich erfüllt ebenfalls die Erwartungen mit müheloser Leichtigkeit im Sanctus. Definitiv eine hörens- und besitzenswerte Neuaufnahme, wenngleich sie für mich persönlich die erste Davis-Einspielung von 1969 als Referenz nicht ablösen kann. Als Bonus ist noch die sehenswerte Filmversion des Konzerts auf DVD beigefügt. Daniel Hauser
 Seinen Status als der Berlioz-Dirigent unserer Tage untermauert John Nelson, der im Dezember 2019 achtundsiebzig ist, zum Abschluss des großen Berlioz-Jahres 2019, in welchem wir den 150. Geburtstag des vermutlich bedeutendsten französischen Komponisten des 19. Jahrhunderts feiern, mit seiner Einspielung von La Damnation de Faust, die wiederum bei Erato (0190295417352) vorgelegt wird. Ambitioniert tut Nelson im klugen Vorwort des Booklets kund, dass man mit dieser Aufnahme mehr als die Hälfte des Projekts verwirklicht habe, das darauf abziele, alle bedeutenden Werke von Berlioz einzuspielen. Es dürfte uns also noch einiges bevorstehen – und das ist aufgrund der hohen Güte der bisherigen Veröffentlichungen fraglos zu begrüßen. So darf gleich vorweggenommen werden, dass sich auch der Faust in diese Erfolgsgeschichte einreiht. Diesen merkwürdigen Hybriden aus einer Oper und einem konzertanten Werk will Nelson im Übrigen als letzteres verstanden wissen, womit er gleichsam die konzertanten Aufführungen in Straßburg, die dieser Produktion zugrunde liegen, noch einmal besonders legitimiert.
Seinen Status als der Berlioz-Dirigent unserer Tage untermauert John Nelson, der im Dezember 2019 achtundsiebzig ist, zum Abschluss des großen Berlioz-Jahres 2019, in welchem wir den 150. Geburtstag des vermutlich bedeutendsten französischen Komponisten des 19. Jahrhunderts feiern, mit seiner Einspielung von La Damnation de Faust, die wiederum bei Erato (0190295417352) vorgelegt wird. Ambitioniert tut Nelson im klugen Vorwort des Booklets kund, dass man mit dieser Aufnahme mehr als die Hälfte des Projekts verwirklicht habe, das darauf abziele, alle bedeutenden Werke von Berlioz einzuspielen. Es dürfte uns also noch einiges bevorstehen – und das ist aufgrund der hohen Güte der bisherigen Veröffentlichungen fraglos zu begrüßen. So darf gleich vorweggenommen werden, dass sich auch der Faust in diese Erfolgsgeschichte einreiht. Diesen merkwürdigen Hybriden aus einer Oper und einem konzertanten Werk will Nelson im Übrigen als letzteres verstanden wissen, womit er gleichsam die konzertanten Aufführungen in Straßburg, die dieser Produktion zugrunde liegen, noch einmal besonders legitimiert.
Die von Berlioz gegebenen Bühnenanweisungen sind laut Nelson dazu da, „die Ausführenden zu einem dramatischen Denken [zu] animieren“. Dem mag man zustimmen, wenngleich es in den letzten Jahren ja auch tatsächlich einige nicht völlig misslungene Bühnenadaptionen gab. Wie schon bei Les Troyens fand die Einspielung in Strasbourg statt (Konzerte am 25. und 26. April 2019, Nachbesserungen am 27. April). Der Ort ist gut gewählt als Berührungspunkt zwischen Frankreich und Deutschland, hebt die Times zurecht hervor, zwischen Berlioz‘ Adaption und Goethes Vorlage. Großen Anteil am Gelingen der Aufführungen haben (wieder) Joyce DiDonato (als Marguerite) und Michael Spyres (in der Titelrolle als Faust). Da hat man vokal die crème de la crème des heutigen Berlioz-Gesanges versammelt, zu der sich noch Nicolas Courjal (als Méphistophélès) und Alexandre Duhamel (als Brander) gesellen.
Besonders Spyres erfüllt alle Erwartungen, hat die richtige Stimme für das schwierige französische Repertoire des 19. Jahrhunderts und auch für diese ganz besonders heikle Partie, an der schon große Namen scheiterten. Man muss schon weit zurückgehen, um Vergleichbares zu finden, womöglich gar bis Richard Verreau unter Igor Markevitch und Nicolai Gedda unter Sir Colin Davis – womit auch bereits die beiden Referenzaufnahmen genannt sind.

Berlioz: „La Damnation de Faust“ in Strasbourg 2018/ Foto Warner/ Grégory Massat
Ob Joyce DiDonato ganz die Klasse einer Consuelo Rubio und Josephine Veasey hat, darüber ließe sich debattieren. Mit dem französischen Idiom hat sie jedenfalls keine Probleme und weiß durch tadellose Diktion für sich einzunehmen. Ihre Marguerite ist jedenfalls weniger dramatisch angelegt als einst bei Régine Crespin. Nicht ganz so herausragend die beiden Franzosen. Nicolas Courjals heller Bass könnte kaum ein größerer Kontrast zu Jules Bastin unter Davis sein; die fehlende Schwärze gleicht Courjal durch tiefgehende Charakterisierung aus. Rollendeckend Alexandre Duhamel in der undankbaren Partie des Brander. Den in dieser „dramatischen Legende“ so wichtigen Chorpart schultert der portugiesische Coro Gulbenkian aus Lissabon, unterstützt von Les Petits Chanteurs de Strasbourg, beide auf Weltklasseniveau und mit der Höhepunkt dieser Neueinspielung. Gewohnt überzeugend auch der orchestrale Part, neuerlich gespielt vom Orchestre Philharmonique de Strasbourg unter Nelsons Leitung, die vielleicht nicht ganz so expressiv ausfällt wie jene von Markevitch, aber doch zu den gelungensten bei diesem Werk gezählt werden muss und die erstaunliche Orchestrierungskunst von Berlioz vor Augen führt. Als Beigabe der Doppel-CD erhält man eine 41-minütige Bonus-DVD mit Highlights der Konzertaufführung vom 25. April 2019. Informativ auch der ausführliche Text von Christian Wasselin im Beiheft. Dies alles, ergänzt um die sehr gute Klangqualität, machen diese Neuproduktion zu einem wichtigen Bestandteil der Diskographie und einem würdigen und krönenden Abschluss des Berlioz-Jahres. Daniel Hauser
Dazu John Nelsons Bemerkungen zur Damnation und der von ihm geplanten Gesamtaufnahme der Berlioz´schen Werke bei Erato im Booklet zur neuen Damnation de Faust. Mit dieser Einspielung haben wir mehr als die Hälfte des Projekts verwirklicht, alle wichtigen Werke dieses Komponisten bei Erato/Warner Classics aufzunehmen. Das vorliegende Werk ist dabei die größte Herausforderung, und dafür können wir Méphistophélès verantwortlich machen, dessen teuflische Machenschaften Berlioz inspirierten, unglaublich schwierige Musik zu komponieren, die in ihrer Vielfalt ihresgleichen sucht. Erneut spielt das wunderbare Orchestre philharmonique de Strasbourg, für das diese Herausforderungen kein Problem darstellen, und in den Hauptrollen sind die unvergleichliche Joyce DiDonato sowie Michael Spyres zu erleben.
Einer der Faktoren, die dieses Werk – und in der Tat alle großen Werke von Berlioz – so besonders machen, ist die enorme Bandbreite an Gefühlen, die er erkundet. Es gibt wohl keinen anderen Komponisten, der die Palette zwischen Unschuld und Teufelei so kontrastreich darzustellen wusste wie Berlioz. Kein anderer Komponist hat die Tiefen der Traurigkeit eindrucksvoller ausloten können als Berlioz in Margarethes „D’amour l’ardente flamme“. Ein Dirigent sollte bei einer Aufführung nicht in Tränen ausbrechen, damit nicht auch das Publikum anfängt zu weinen. Aber ich bin jedes Mal nahe dran, wenn die Passage „ö caresses de flamme!“ kommt. Absolut erschütternd.

„Les Troyens“ konzertant in Straßburg/ Joyce DiDonato und John Nelson/ Foto Gregory Massat (dazu auch die Besprechung in operalounge.de)
Der wunderbare Coro Gulbenkian aus Lissabon hat die große und abwechslungsreiche Aufgabe, frühlingsliebende Bauern, Osterkirch- gänger, Betrunkene in einem Leipziger Bierkeller, Gnome und Sylphen im Dienst von Méphistophèles, Studenten und Soldaten auf dem Weg nach Hause, Irrlichter, die um Margarethes Haus tanzen, entsetzte Nachbarn, Bauern, die unter einem Kreuz knien, während Méphistophélès und Faust auf zwei schwarzen Pferden zur Hölle galoppieren, Dämonen und verdammte Seelen in der Hölle und schließlich Engel im Himmel, die Margarethe willkommen heißen, zu verkörpern. Welche Oper oder welches Oratorium könnte mit dieser Bandbreite an Chor-Rollen mithalten?
Ein abschließendes Wort zu dem merkwürdigen Charakter dieses Werks. Handelt es sich um eine Oper oder um ein konzertantes Werk? Angesichts der vielen Bühnenanweisungen in der Partitur würde man annehmen, dass Berlioz es als Oper konzipiert hat. Und durch diese Anweisungen haben viele Opernintendanten sich legitimiert gefühlt, es auf der Bühne zu präsentieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Berlioz es für den Konzertsaal vorgesehen hatte – und dass die Bühnenanweisungen die Ausführenden zu einem dramatischen Denken animieren sollten. Die Aufführung als Bühnenstück beschränkt die Fantasie der Zuschauer auf eine Sichtweise. Eine konzertante Aufführung ermöglicht zweitausend Menschen, sich das Werk auf zweitausenderlei Weise zu vergegenwärtigen. John Nelson (Übersetzung Dorle Ellmers/ den Artikel entnahmen wir dem Booklet zur neuen Aufnahme der hier besprochenen Damnation de Faust bei Erato)





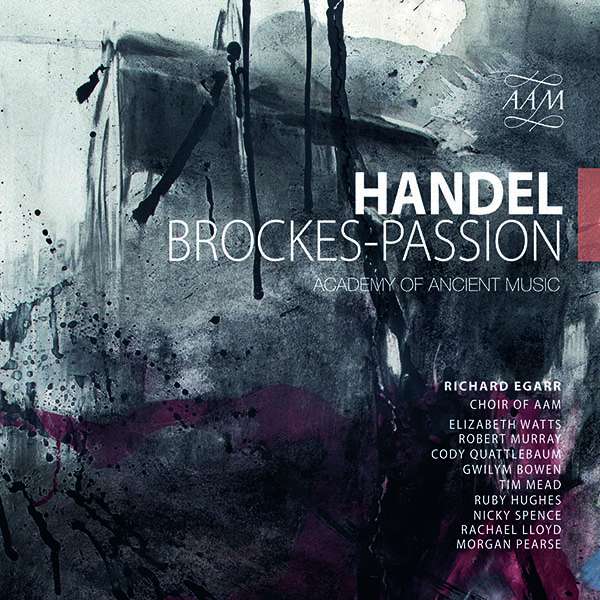


 Die Texte der Auswahl stammen von Victor Hugo, Alphonse de Lamartine und Théophile Gautier, doch auch weniger bekannte Autoren befinden sich darunter, etwa Pierre Barbier, der Sohn von Jules, und die Baronin de La Tombelle. Als Hausbariton von Palazzetto Bru Zane bringt
Die Texte der Auswahl stammen von Victor Hugo, Alphonse de Lamartine und Théophile Gautier, doch auch weniger bekannte Autoren befinden sich darunter, etwa Pierre Barbier, der Sohn von Jules, und die Baronin de La Tombelle. Als Hausbariton von Palazzetto Bru Zane bringt 
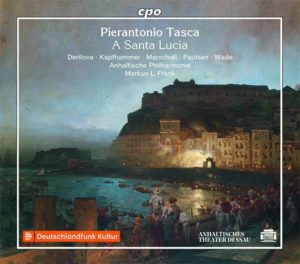 A Santa Lucia
A Santa Lucia