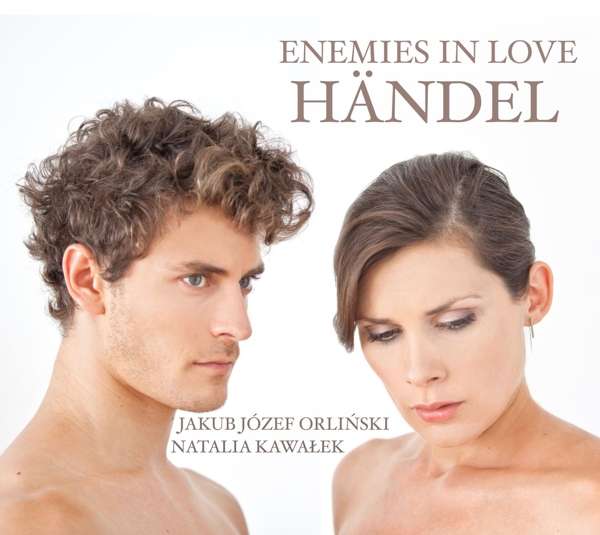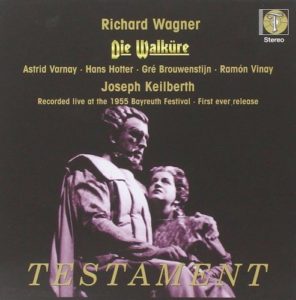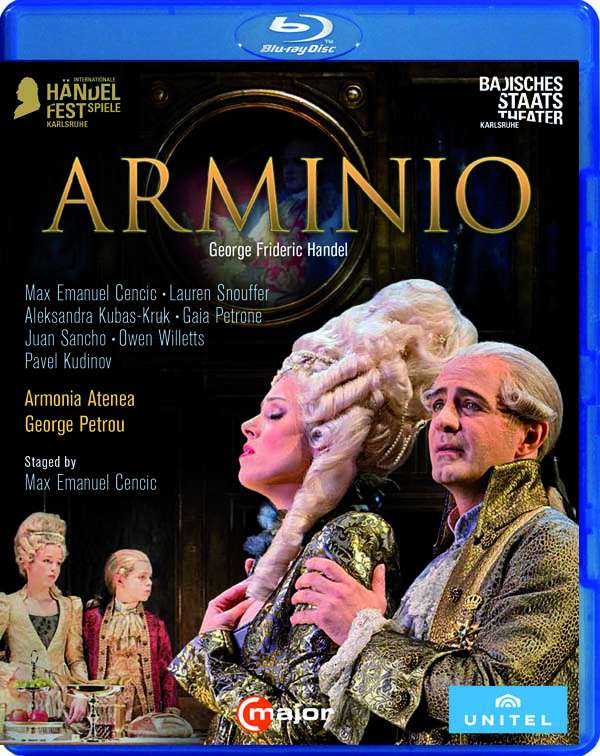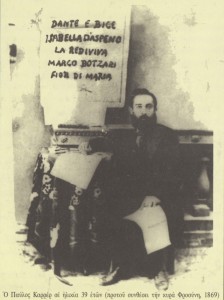.
Aktueller denn je sind die Zeugnisse einer gelungenen Integration von Auswanderern/ Flüchtlingen/ Migranten in ihrem Gastland – über kaum ein Thema wird ja gegenwärtig so viel diskutiert wie genau darüber. Deshalb ist es spannend zu sehen, wie sich die jüdischen (russischen und polnischen) Auswanderer des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts auf der Flucht vor Verfolgung und Progromen in den USA einrichteten (namentlich New York als Anlaufstelle), wie sie ihre eigene Sprache, Kultur, Folklore und Gewohnheiten institutionalisierten und im Laufe der Zeit zu einer der beherrschenden Life-Style-Formen der USA machten. Sie verhalfen – wie viele ihrer Zeitgenossen – dem jüdisch geprägten Unterhaltungstheater (namentlich dem Musiktheater) zu ungeahnter Blüte. Das ist eine Periode des amerikanischen Theaterlebens, von der bei uns in Europa und Deutschland kaum etwas bekannt ist.
Das National Yiddish Theatre in New York ist so ein Ort, an dem heute der jiddischen Traditionen aus Osteuropa gedacht wird. Eine mit viel Beifall bedachte Aufführung des Musicals Di goldene Kale (Die goldene Braut) von Joseph Rumshinsky war dem auf dem Theatergebiet spezialisierten Steven Ledbetter, Autor, Musikkritiker und Musikwissenschaftler von Rang, einen langen Artikel zum Jiddischen Theater in Amerika wert, den wir von unseren Freunden des ORCA (Operetta Reserach Center Amsterdam/ Kevin Clarke) mit Dank in unserer eigenen deutschen Übersetzung übernehmen. G. H.

Cover for the catalogue of New York’s Yiddish Theater „From the Bowery to Broadway“ Columbia University Press, ISBN-10: 0231176708, ISBN-13: 978-0231176705
Steven Ledbetter: Ein unwahrscheinlicher Hit, das 1923 entstandene jiddische Musical Di goldene Kale (Die goldene Braut) von Joseph Rumshinsky, kam nach jahrelangen Recherchen, ausgelöst durch eine Partitur, die in der Harvard Music Library gefunden wurde, in einer exzellenten Produktion des National Yiddish Theatre Folksbiene in der Edmond J. Safra Hall im Museum of Jewish Heritage (Manhattan, New York City) heraus. Ich fand die Show so reizend und zufriedenstellend wie alles in der Stadt und war damit nicht allein. Die New York Times bedachte sie mit einer sehr positiven Rezension und inkludierte einen Videoclip mit Auszügen aus verschiedenen Liedern, die einen Eindruck vom Werk und der Inszenierung geben.
Obschon der ursprüngliche, monatelange Zyklus vorüber ist, wurde von möglichen Auftritten in Philadelphia und vielleicht anderswo, einer kommerziellen Aufnahme oder gar eine DVD-Produktion gesprochen. Ich habe die Entwicklung des wissenschaftlichen Projekts von seinem Ursprung in der Harvard Music Library bis zu seinem unerwarteten Aufblühen in New York verfolgt, und da nahezu niemand den Komponisten oder die Musik mehr kennt, biete ich diesen Artikel als kleinen Einblick in einen reichen und weitgehend vergessenen Teil des amerikanischen Musiktheaters.

Grand Theater advertising Jacob P. Adler in “The Jewish King Lear,” c. 1905. (Photo Byron Company Museum of the City of New York, J. Clarence Davies Collection)/ ORCA mit Dank
Während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts war das jiddische Theater sehr erfolgreich, besonders in New York, wo im Laufe von etwa drei Jahrzehnten eine große Anzahl neuer Einwanderer aus Osteuropa eintraf. Die meisten von ihnen sprachen Jiddisch, eine Sprache, die wie Englisch eine Verschmelzung verschiedener Quellen darstellt – in diesem Falle aus Mittel- und Osteuropa, einschließlich einer starken Portion Deutsch, gefärbt mit Obertönen das Russischen, Polnischen, Litauischen und Rumänischen sowie Überresten des Hebräischen. Jiddisch wurde zu einer lingua franca für die Ankömmlinge aus weiten Teilen Osteuropas, wo die Behörden ihr Bestes gaben, um die Juden zu vertreiben.
In Amerika standen diese neu angekommenen Immigranten, wie Neuankömmlinge aus anderen Kulturen und Ländern vor ihnen, vor der Herausforderung, eine neue Sprache und neue kulturelle Praktiken zu erlernen, während sie, so gut sie konnten, an ihren bekannten und beliebten Traditionen – sozial und religiös – festhielten.
Von den 1890er bis in die 1920er Jahre mussten die neuen Immigranten in ihrer neuen Heimat Fuß fassen, was sie durch eine Verschmelzung alter und neuer Erfahrungen schafften. Das Theater bot einen einfachen Weg für die Sprecher einer bestimmten Sprache, die eine bestimmte Kultur teilten, sich der Neuheit der Neuen Welt zu stellen und gleichzeitig so viel vom Mitgebrachten zu bewahren wie möglich. Das jiddische Theater, ein ziemlich neues Genre, erfunden im östlichen Europa der 1880er Jahre und vom zaristischen Regime großflächig unterdrückt, bot Unterhaltung und Ablenkung, Beispiele für eine erfolgreiche Lebensweise sowie eine Unterweisung in dem, was sie in Amerika erwartete.

ORCA-Chef Kevin Clarke vor dem Yiddish Theatre/ ORCA
Einige der Stars wurden, zumindest innerhalb ihres eigenen ethischen Zirkels, hochberühmt. Zwei der größten Stars waren Boris und Bessie Thomashevsky, die von einer großen Fangemeinde, darunter der junge George Gershwin, zum Idol stilisiert wurden, aber in der Welt außerhalb der jiddischen Sprache fast unbekannt blieben. Boris und Bessie waren die Großeltern von Michael Tilson Thomas, und für die meisten Menschen, die nicht in New York City aufgewachsen waren, wo die Mehrheit der neu eingewanderten Juden wohnte, wäre ihre erste bedeutende Verbindung zur Tradition höchstwahrscheinlich ein Konzertprogramm gewesen – im Wesentlichen ein Vortrag mit einer Vorstellung von singenden Schauspielern –, zusammengestellt und dirigiert von Michael Tilson Thomas im Laufe des letzten Jahrzehnts, schließlich ausgestrahlt von PBS (The Thomashevskys: Music and Memories of a Life in the Yiddish Theater)

Composer Joseph Rumshinsky (1881-1956)/ORCA).
Und dann gab es noch andere, die ein breites Publikum erreichten, wie Molly Picon und Jacob Adler, deren Tochter Stella Marlon Brando, Robert De Niro und vielen anderen die Schauspielerei beibrachte.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts engagierte Boris Thomashevsky einen jungen Komponisten, der neu aus Wilna, Litauen, eingetroffen war: Joseph Rumshinsky (1881-1956), der später zum vielleicht bedeutendsten Komponisten des jiddischen Theaters werden sollte. Sein Erfolg war so groß, dass er „der jüdische Victor Herbert“ genannt wurde.
Rumshinsky gehörte zur ersten Generation bedeutender Komponisten des jiddischen Musiktheaters, die vom Ethnomusikologen Mark Slobin von der Wesleyan University in seinem Buch Tenement Songs: The Popular Music oft he Jewish Immigrants (Illinois Press, 1982) diskutiert wurde. Hierbei handelt es sich scheinbar um die bis heute einzige substanzielle Studie über den musikalischen Aspekt des jiddischen Theaters. Diese frühe Gruppe dieser Komponisten wuchs in Osteuropa mit den musikalischen Traditionen der Shul (Synagoge) und des Khazn (Kantor) auf, die einen musikalischen Jungen als einen Meshoyrer (Chorknaben) akzeptierten. Wenn sich sein Talent als ausreichend erwies, erhielt er Gesangsunterricht und lernte später Noten zu lesen und Elemente der Theorie und Komposition zu studieren, um sich so den Rahmen für eine Karriere zu schaffen.

Joseph Rumshinsky:“Di goldene Kale“ am Yiddish Theatre/ Foto Moody/ ORCA
Der junge Rumshinsky erwies sich beim fortgeschrittenen Unterricht als so geeignet, dass er den Spitznamen „Yoshke der notnfresser“ (Joey der Notenfresser) bekam. Er erinnerte sich später, dass diese musikalischen Erfahrungen in Verbindung mit der Anbetungstradition „für Juden, die Oper, die Operette und die Sinfonie“ standen. Eine spätere Generation der Komponisten des jüdischen Liedes in Amerika, deren Ausbildung weltlicher und theaterorientierter war, wurde allgemein bekannter, als einige ihrer Lieder (wie Sholom Secundas „Bei mir bist du sheyn“ von 1932) in der allgemeinen Musikkultur Amerikas populär wurden.
Trotz seines späteren Erfolges als Hauptkomponist des jiddischen Theaters in Amerika, fehlte Rumshinsky sowohl in der 1980er wie auch in der 2000er Ausgabe des New Grove als auch in der ersten Auflage des New Grove Dictionary of American Music. Schließlich erschien er erstmals in der zweiten Auflage des American Grove mit einem kurzen Artikel – indes ohne ein Werkverzeichnis, das angeblich um die 90 Musicals umfasste.
Angesichts des Mangels an allgemein zugänglichen Informationen über ihn werde ich einige wesentliche Details seines Hintergrunds kurz aufführen, die aus Slobins Buch stammen, das auch Zitate aus den Memoiren des Komponisten enthält (Auszüge werden in Anführungszeichen stehen).
Rumshinskys Vater war Hutmacher, aber ein musikalischer Mann, der seine Lehrlingen zum Singen ermutigte – manchmal hebräische Lieder, die er ins Jiddische übersetzte und dann „die Musik auf seine eigene Weise improvisierte“. Wenn das Geschäft schlecht war oder andere Schwierigkeiten drohten, sangen sie Passagen aus den Psalmen „mit dem Wohlklang der Lehrlinge: es brachte dein Herz mit seiner Süße und Traurigkeit zum Schmelzen“. Aber wenn das Hutgeschäft gut lief, leitete er einen Frage-und-Antwort-Typ des Liedes mit jedem, der mitsang. „Die fröhlichen Lieder waren halbrussisch, halbpolnisch, vermischt mit Jiddisch und Hebräisch, und das Werk sollte dem Tempo und der Stimmung der Musik folgen.“ Rumshinskys Mutter war eine Gesangslehrerin – „Nicht, Gott verbiete es, für Geld!“ Sie lehrte Hochzeitslieder für die Mädchen vor Ort. Die Beschreibung macht klar, dass es sich um eine sehr vielseitige Gesellschaft in sozialer und musikalischer Hinsicht handelte.

Joseph Rumshinsky:“Di goldene Kale“ am Yiddish Theatre/ Foto Moody/ ORCA
Der junge Yoshke wurde zum Kantor in Wilna gebracht, wo er sang und zu seiner großen Freude zum ersten Mal einen vollen Chor hörte. Eine musikalische Karriere war klar erkennbar. Er überredete seinen Vater, ihn an eine Schule mit einer säkularen Ausbildung zu schicken, wo er Berichten zufolge binnen eines Monats Notenlesen lernte und das Klavierspiel begann. Von diesem Zeitpunkt an bis zu seinem Umzug nach Amerika verfolgte er verschiedene Arten musikalischer Aktivitäten. Manchmal schrieb er für eine Synagoge, fand sich aber zunehmend vom Theater angezogen. Er war begeistert von einer Aufführung von Shulanis, einem Stück von Abraham Goldfadn, dem Begründer des jiddischen Theaters in Litauen um 1880 herum. Aber als diese Tradition vom Zaren verboten wurde, konnte sie nur in der Neuen Welt gedeihen. Inzwischen lebte er ein vagabundierendes Musikleben und lernte Musik aus verschiedenen Traditionen, darunter russische Operette und deutsche Lieder. In Lodz gründete er einen nationalistischen jüdischen Chor, der seinen offenen Nationalismus unterdrücken musste, um Probleme mit der zaristischen Polizei zu vermeiden, und einen Skandal bei der älteren Generation auslöste, sangen doch Jungen und Mädchen zusammen.
Die Gefahr, in die Armee des Zaren eingezogen zu werden, motivierte ihn schließlich zu schneller Flucht nach London und nicht lange danach nach New York. Dort war sein vielseitiger Hintergrund hilfreich. Er wurde zunächst damit beauftragt, einen Chor zu trainieren, der Rubinsteins Oper Der Dämon auf Russisch singen sollte, und eine neue Orchestrierung zu besorgen, da es schwierig war, Material aus Russland zu bekommen. Er schrieb auch leichte Klavierstücke für S. Goldberg, einen Musikverleger mit einem Geschäft in der Lower East Side. Er gab einer Vielzahl an Einwanderern Klavierstunden, von denen viele in ihrem Bestreben, der Mittelschicht anzugehören, ein Klavier gekauft hatten. (Die Gershwins waren eine solche Familie, die es für den schüchternen Bücherwurm Ira gekauft hatten; aber kaum dass das Klavier im Apartment stand, nahm es dessen Bruder George in Beschlag und ließ nicht mehr davon los.)

Molly Picon in the Yiddish film The Jolly Orphan, 1929. From New York’s Yiddish Theater From the Bowery to Broadway.
Aber der Umzug nach New York brachte Rumshinsky auch in eine Region, in der das jiddische Theater florierte. Nicht lange nach seiner Ankunft wurde er von Boris Thomashevsky angestellt, um an seinen Shows zu arbeiten, womit eine lange Karriere begann, die zu Dutzenden Musicals und anderen Werken führte, darunter eine ernste Oper, Ruth, in den späten 1940er Jahren, die unaufgeführt blieb.
Es ist sein 1923er Hit Di goldene Kale (Die goldene Braut), die kürzlich in New York elegant und clever in einer außerordentlich schönen Version wiederbelebt wurde und sich durch eine exzeptionelle Präsentation der Lieder und Tänze auszeichnet. Dieses Werk hat diesen Aufsatz motiviert. Kurz vor dem Ende der freien und offenen Einwanderung aus Osteuropa entstanden, muss das Libretto heute ziemlich modern erscheinen, mit zwei kontrastierenden Akten, die Charaktere zunächst in ihrem Heimatland präsentierend und die meisten davon dann bei ihrem neuen Leben in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig wird an die große Operettentradition angeknüpft. Am auffälligsten war für mich die Ähnlichkeit mit der Situation in Lehárs Lustiger Witwe: Die weibliche Hauptprotagonistin ist eine unverheiratete Frau mit großem Reichtum (bei Lehár ist sie die Witwe eines sehr vermögenden Mannes; bei Rumshinsky ein armes jüdisches Mädchen, das von seiner Mutter getrennt wurde, aber deren kürzlich verstorbener Vater nach Amerika gegangen war und ein Vermögen gemacht hatte). In der jiddischen Show fühlt Goldele, dass ihre Mutter nach wie vor am Leben sein muss, und sie versprach, denjenigen Verehrer zu heiraten, der sie ausfindig machen kann (trotz der Tatsache, dass sie einen favorisierten Geliebten hat).
Der Weg zur Wiederbelebung war lange und nahm nicht weniger als sechs Jahre wissenschaftlicher Arbeit in Anspruch. Quellen für Theaterstücke und Musicals, die am Kessler’s Second Avenue Theater und anderen Häusern in der jiddischen Tradition gespielt wurden, sind meist verloren oder verstreut. Die erste Aufgabe besteht schlichtweg darin, die große Menge an fehlendem Material zu finden.

Molly Picon in a Yiddish Theater production, 1919/ ORCA
Der erste Anstoß zu einer Rekonstruktion von Di goldene Kale war eine Konferenz amerikanischer Musikwissenschaftler im Raum Boston 1984, als Michael Ochs, der damalige Musikbibliothekar in Harvard, eine handschriftliche Kopie eines Klavierauszuges fand. Wie bei solchen Partituren üblich, ist kein gesprochener Dialog enthalten und hat man keine Vorstellung, wie die Orchestrierung aussieht. Gleichwohl stellte er die Partitur bei einer Ausstellung für die jährliche Konferenz der damaligen Sonneck Society (heute Society for

Poster for the “Hassidic” operetta “The Rabbi’s Temptation” at Manhattan Theatre, 1932. The show by Sholom Secunda and Sholem Steinberg was first produced in 1924-25./ Ledbetter/ ORCA
Nachdem er sich aus Harvard zurückgezogen hatte, beschloss er, ein Projekt zu dieser Operette zu machen und begann, die Texte zu übersetzen. Am YIVO Institute for Jewish Research in New York (das eine außergewöhnliche Sammlung von Materialien zum jiddischen Theater besitzt) fand er ein Schreibmaschinenmanuskript des Librettos unter den Papieren, welche die Enkel der Librettistin Frieda Freiman und die Kinder der Schauspielerin Flora Freiman gestiftet hatten.
Was es ermöglichte, die Partitur zu rekonstruieren, war ein Geschenk von Manuskripten aus Rumshinskys Nachlass, die von seinen Kindern Murray Rumshinsky und Betty Rumshinsky der UCLA vermacht wurden. Hier fand Ochs die Vorlage (keine vollständige Orchesterpartitur!), mit der der Komponist 1923 die Uraufführung dirigierte, sowie die einzelnen Orchesterpartien. Diese Materialien ermöglichten es ihm, die gesamte Partitur wiederherzustellen, indem er alle Einzelteile zusammenfügte. (Ein Operndirigent an der Met würde niemals ohne Partitur arbeiten, aber es ist sehr selten für den Dirigenten einer kommerziellen Show, etwas Ausführlicheres als eine Klavierpartitur zu haben.)
Wie Michael Ochs mehrfach lächelnd beschrieb, ist es Ironie, dass er aus einer älteren jüdischen Familie mit deutschen Wurzeln stammt, einer Gruppe von Menschen, die im späten 19. Jahrhundert dazu tendierten, auf die verarmten Neuankömmlinge aus den Schtetls herabzublicken, die nicht einmal richtiges Deutsch sprachen. Seine Vorfahren hätten sich nicht dazu herabgelassen, die Vorstellungen im Second Avenue Theater zu besuchen. Doch ein Jahrhundert später ist er zum Hauptakteur bei der Wiederentdeckung der Brillanz von Joseph Rumshinsky und seines entzückenden Hits von 1923 geworden. Jetzt, wo die Partitur wiederhergestellt ist, wird sie in der Reihe Music oft he United States of America (MUSA) erscheinen, herausgegeben von der American Musicological Society, und wird das erste wissenschaftliche Aufführungsmaterial eines jiddischen Musicals überhaupt darstellen. Laut Michael Ochs spielten Rumshinsky und diese Operette „eine wichtige Rolle in der Entwicklung des amerikanischen Musicals. Irving Berlin, Yip Harburg und die Gershwins besuchten, wie viele andere Broadway- und Tin-Pan-Alley-Persönlichkeiten, regelmäßig die jiddischen Theateraufführungen.“

Der Autor Steven Ledbetter/ ORCA/ Facebook
Die wunderbare Gelegenheit, die Ergebnisse all dieser Jahre wissenschaftlicher Arbeit tatsächlich zu sehen und zu hören, wurde durch die Hilfe von Chana Mlotek von YIVO möglich, die Michael Ochs ihrem Sohn Zalmen, dem künstlerischen Leiter des National Yiddish Theatre Folksbiene, vorstellte, der Musikdirektor dieser Produktion wurde. Zunächst wurde die Show im Mai 2014 auf minimalistische Weise mit einer klavierbegleiteten Aufführung der Lieder präsentiert. Dann wurde die Partitur im August 2015 mit Orchesterbegleitung an der Rutgers University aufgeführt. Die offensichtliche Qualität im Konzert führte direkt zur Inszenierung von Bryna Wasserman und Motl Didner von 2. Dezember 2015 bis 3. Januar 2016. Etwa 300 Sänger/Schauspieler haben für die acht Soloparts und das Ensemble vorgesprochen, was Spielraum für den Aufbau einer prächtigen Besetzung gab, die sowohl den Anforderungen einer Oper als auch dem ethnischen Kitsch gerecht wurde. Das Titellied offeriert einige Aromen dieses stilistischen Schmelztiegels. Die Aufnahme stammt aus einer Reihe von Liedern des jiddischen Theaters von Naxos in der bedeutenden Reihe Jewish Music in American Life. Es sind neun Lieder von Rumshinsky von neun verschiedenen Werken enthalten, eine willkommene Einführung in die Arbeit dieses Meisters des Musiktheaters.
Die Edmond J. Safra Hall wurde zu seinem stilvollen Garten geschmückt, der im ersten Akt als Schtetl diente, bevor sie sich zu unserer großen Belustigung im zweiten Akt in eine elegante New Yorker Wohnung verwandelte. Diese Transformation war eines der Highlights der Produktion. Die Charaktertypen wurden in ungemeiner Detailfülle dargeboten. Der amerikanische Cousin Jerome, gespielt von Glen Steven Allen, trainierte sogar sein Jiddisch mit amerikanischem Akzent. Der stattliche Adam Shapiro verkörperte Pavlova denkwürdig während des Kostümballs. Zalmen Mlotek leitete die rund 20 Spieler mit echter Hingabe und stilistischem Elan. Die Platzierung des Orchesters hinter einem Glitterstoff gab ihnen die Möglichkeit, zur entsprechenden Zeit aufzutauchen.
Als Musikwissenschaftler, der manchmal Jahre damit verbracht hat, staubige Materialien zu bearbeiten, kenne ich das Gefühl, ein wissenschaftliches Projekt zu sehen, das zu einer ansehnlichen Menge an gedruckter Musik führt, die dann niemand aufführt – wodurch der Zweck all dieser Bemühungen weitgehend untergraben wird. Aber in diesem Falle haben es die glücklichsten Umstände möglich gemacht, dass dieses lange, komplexe Projekt von Tausenden gehört und gesehen wurde – in der Hoffnung, dass dies auch für zukünftige Produktionen gelten möge. Steven Ledbetter
Dank an ORCA und Kevin Clarke, vor allem aber an Steven Ledbetter für die Freundlichkeit, uns seinen Artikel zu überlassen/ Übersetzung Daniel Hauser. Steven Ledbetter is a free-lance writer and lecturer on music. He got his BA from Pomona College and PhD from NYU in Musicology. He taught at Dartmouth College in the 1970s, then became program annotator at the Boston Symphony Orchestra from 1979 to 1997. Foto oben: The original Playbill for Di goldene Kale, 1923. Photo Steven Ledbetter Archive/ ORCA
Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.




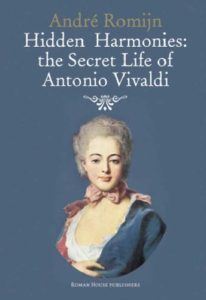
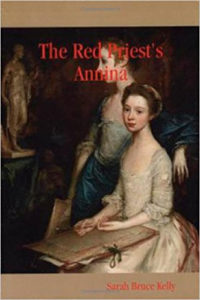
 Theater, die ridotti und die casini, öffnen wieder ihre Pforten.
Theater, die ridotti und die casini, öffnen wieder ihre Pforten.


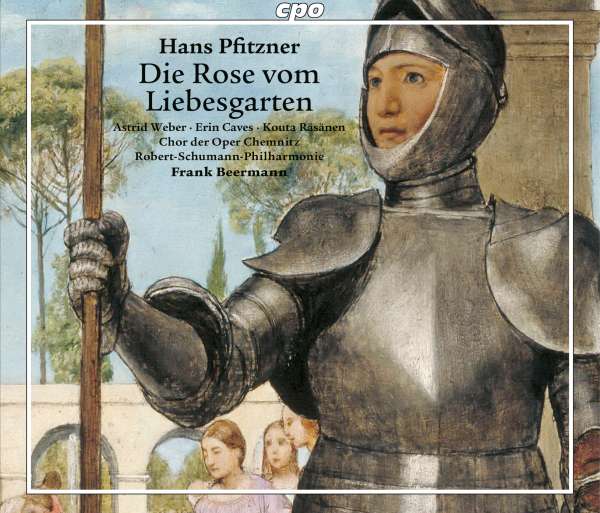













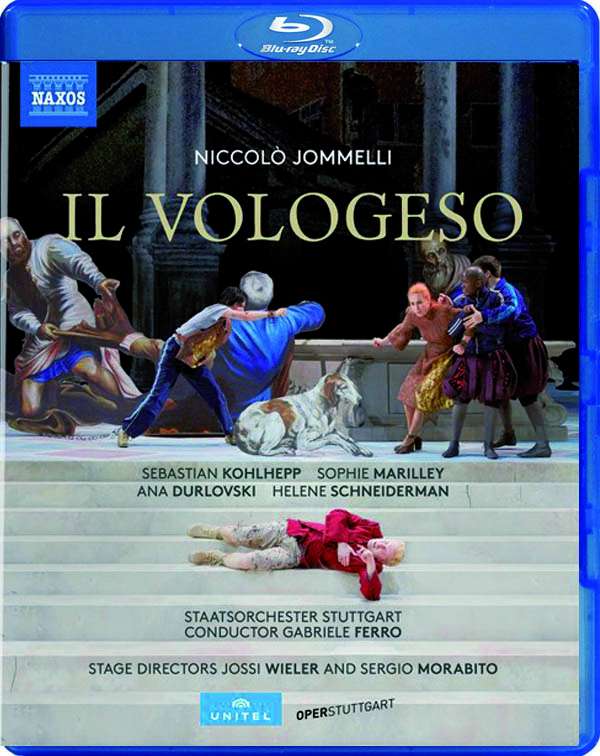


 Huguette Tourangeau:
Huguette Tourangeau: In 1977 Tourangeau became the first recipient of the Canadian Music Council’s artist of the year award. Her voice is a flexible mezzo-soprano adaptable to the wide range of the mezzo repertoire, from Rossinian coloratura to the robust sound required by the trouser roles of German opera or the lyric mezzo of the French heroines. She began teaching voice in Montreal in 1984. Her husband, Barry Thompson, was manager of the Vancouver Opera 1975-8 and of the Edmonton Opera Association. Huguette Tourangeau was appointed a Member of the Order of Canada in July, 1997.
In 1977 Tourangeau became the first recipient of the Canadian Music Council’s artist of the year award. Her voice is a flexible mezzo-soprano adaptable to the wide range of the mezzo repertoire, from Rossinian coloratura to the robust sound required by the trouser roles of German opera or the lyric mezzo of the French heroines. She began teaching voice in Montreal in 1984. Her husband, Barry Thompson, was manager of the Vancouver Opera 1975-8 and of the Edmonton Opera Association. Huguette Tourangeau was appointed a Member of the Order of Canada in July, 1997.