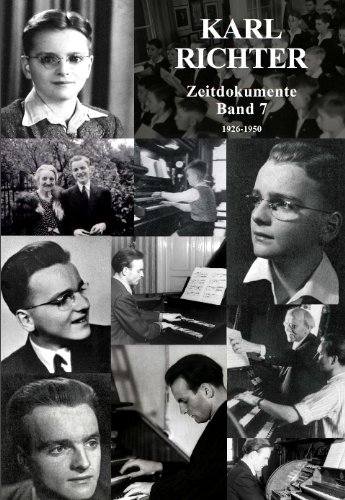.
„Wenn ein Sänger hohe Noten, die nicht in der Partitur stehen, der Tradition gemäß aber schon immer gesungen wurden, singen KANN, dann soll er sie auch singen……“
Er galt als der Grandseigneur unter den Tenören seiner Zeit, als überragender Stilist, als unerreichter Ritter vom hohen C (und darüber) – als Aristokrat des tenoralen Belcanto……Die Liste solcher und ähnlicher Attribute und Superlative ließe sich noch lange fortsetzen. Doch muss man nicht unbedingt auf die blumige Sprache begeisterter Fans und Kritiker (auch solche gab es in diesem Fall!) zurückgreifen, die reinen Fakten allein bestätigen den Ausnahmerang, den Alfredo Kraus rund vier Jahrzehnte lang im oft so schnelllebigen Musikbetrieb eingenommen hat. Vier Jahrzehnte ohne Krisen, ohne Skandale, ohne Absagen. Der Name Alfredo Kraus am Theaterzettel war stets eine mehr als hundertprozentige Garantie für ein unvergessliches künstlerisches Erlebnis.
Ein halber Österreicher
Geboren am 24. November 1927 in Las Palmas, Gran Canaria (die Mutter war Spanierin, der Vater Österreicher), erhielt er bereits als vierjähriger Klavierunterricht, sang mit acht Jahren im Schulchor, und begann schließlich ein Ingenieurstudium, als ihn ein singender Ingenieur so beindruckte, dass er beschloss, ebenfalls Sänger zu werden. Dieser singende Ingenieur war kein geringerer als der dänische Tenorstar Helge Rosvaenge, im bürgerlichen Beruf Chemie-Ingenieur, der nach dem Krieg nach Südamerika auswandern wollte und auf dem Weg dorthin ausgerechnet in Las Palmas hängen geblieben war, wo er sein 25. Bühnenjubiläum feierte und damit offenbar auch den jungen Alfredo Kraus begeisterte, der daraufhin ein ernsthaftes Gesangsstudium in Angriff nahm.
In Kürze zur Weltspitze
1956 hat Kraus dann in Kairo als „Rigoletto“-Herzog sein Bühnendebüt gefeiert und sich in kürzester Zeit schon einen hervorragenden Ruf erarbeitet, auch durch die Tatsache, dass er schnell gelernt hat „nein“ zu sagen (was ihm durch materielle Unabhängigkeit seitens seines Elternhauses auch leichter gefallen ist als anderen). So hat er etwa bereits seine zweite Bühnenrolle –den Cavaradossi in Puccinis „Tosca“- nur ganze zwei Mal gesungen, war er doch überzeugt davon, dass veristische Partien für seine Stimme absolut ungeeignet waren. Trotzdem hat er sich schnell die wichtigsten Opernhäuser der Welt erobert, angefangen vom Londoner Covent Garden bis zur Mailänder Scala, der Metropolitan und der Wiener Staatsoper, an die er allerdings erst auf einem Umweg über die Volksoper gelangt ist.
Späte Liebe
Richtig erkannt, welches Phänomen in Alfredo Kraus steckt, haben Wiener Operndirektoren und Publikum relativ spät, quasi erst im Herbst seiner Karriere, wenn diese auch nie einen stimmlichen Herbst erlebt hat, sondern im wahrsten Sinne des Wortes mit einem ewigen Frühling gesegnet gewesen ist. In diesen Jahren aber haben die Wiener Kraus dann so enthusiastisch gefeiert, als wollten sie alles Versäumte plötzlich nachholen. Und das nicht nur an der Staatsoper, auch bei Konzerten und bei zwei Sensationsgastspielen an der Volksoper, wo er sich hier endlich in zwei seiner wichtigsten Rollen präsentieren konnte, als Tonio in der „Regimentstochter“ und als „Hoffmann“.
Bruch mit der Staatsoper
Den „Hoffmann“ sollte er später auch an der Staatsoper singen, doch an diesem Projekt zerbrach sein zuletzt so hervorragendes Verhältnis zum Haus am Ring – zum Schaden des Publikums. Ausgerechnet sein früherer Agent war nun Chef des Hauses und verlangte plötzlich von ihm, mit einem seiner eisernen Prinzipien zu brechen, nämlich den „Hoffmann“ in zwei Einzelvorstellungen zu singen, noch dazu getrennt durch die Sommerferien und ohne Orchesterprobe, was gerade bei diesem Werk, von dem so viele Fassungen existieren, eine Zumutung darstellte. Kraus hat dankend abgelehnt und die Staatsoper nie mehr betreten.
Respekt vor Musik und Text
Auch in Bezug auf Regie und Ausstattung hatte Kraus feste Prinzipien, unterschrieb nie einen Vertrag, ohne genau zu wissen, was ihn bei dieser Produktion erwarten würde. Undenkbar, dass er den Faust in Jeans gesungen, oder sich bei einem Liebesduett am Boden gewälzt hätte. „Ich bin offen für neue Ideen“ meinte er in diesem Zusammenhang bei einem Publikumsgespräch der Opernfreunde: „Aber wir müssen immer Respekt haben für die Musik und für das Libretto. Auch für uns selbst und für das Publikum, von dem ich manchmal das Gefühl habe, dass es auf die Schaufel genommen wird. Und natürlich ist es viel schwieriger, in der Tradition zu bleiben und schöne Aufführungen zu machen, als irgendetwas Absurdes zu erfinden……“
Pult-Diktatoren
Im letzten Abschnitt seiner Karriere hat Alfredo Kraus sich verstärkt auch um den Nachwuchs bemüht, Meisterkurse abgehalten und sein reiches Wissen in puncto Gesangstechnik bereitwillig weitergegeben. Von einer Sänger- oder Opernkrise wollte er allerdings nichts wissen, eher konstatierte er eine Lehrer- bzw. Dirigentenkrise. In erster Linie hat er das Aussterben der großen, wissenden alten Maestri bedauert, die viel von Stimmen verstanden und ihre Sänger auch geliebt haben. „Und anders als viele junge arrogante Dirigenten von heute“ meinte Kraus in einem Interview mit der griechischen Musikjournalistin Helena Matheopoulos „spielten sich diese Männer nicht als Diktatoren auf. Sie sagten nie: So muss es sein!, sondern es hieß immer: Kraus, kommen sie, jetzt machen wir das einmal zusammen, ich zeige ihnen, wie es sein soll. Diese Art, einem Sänger etwas beizubringen, Wissen zu vermitteln und die Tradition der Operngesangskunst weiterzugeben, das ist so etwas wie eine Mission. Wenn das nicht weitergegeben wird, dann ist ein Glied der Kette zerstört, dann ist die Kette erst an einer Stelle, dann an einer zweiten, schließlich an vielen Stellen unterbrochen, bis irgendwann einmal nichts mehr vorhanden ist.“
Singen bis zum Tod
Mit dem Tod seiner Ehefrau im Jahr 1997 begann sich der Himmel über Alfredo Kraus zu verfinstern: „Ich habe nicht mehr den Willen zu singen“ meinte er in einem Interview, „aber ich muss es tun, weil es in gewisser Weise die einzige Möglichkeit ist, die Tragödie zu überwinden. Singen ist das, was mich am Leben erhält.“ Leider hat diese Selbsttherapie nicht allzu lange angehalten. Gerade ein Jahr lang ist er noch aufgetreten, hat Platten aufgenommen, ist dann aber selbst schwer erkrankt und schließlich am 10. September 1999 in Madrid gestorben.
(Gottfried Cervenka ist Wiener Professor und Musikwissenschaftler; seinen Beitrag für Ö1 überließ er uns zum Nachdruck, wofür wir ihm sehr danken/die Red.)


 Jaroussky hat lange gezögert, die Musik Porporas in sein Repertoire aufzunehmen, aber schließlich in dessen Kompositionen viele berührende Arien entdeckt, die seiner Stimme perfekt entsprechen. Diese sind es dann auch, die den stärksten Eindruck hinterlassen. Zweifellos ist Acis „Alto Giove“ aus Polifemo der Höhepunkt dieser Sammlung – in seiner Wirkung wahrhaft mirakulös durch die körperlos schwebende Stimme, den entrückten Ausdruck, die scheinbar unendlichen Atemreserven. Das Venice Baroqe Orchestra unter Andrea Marcon, das den Sänger insgesamt sehr einfühlsam begleitet, erschafft gerade in dieser Nummer wunderbare orchestrale Stimmungen. Aus dieser Oper erklingt noch eine weitere Arie des Aci („Nel già bramoso petto“), deren heroische Koloraturläufe der Interpret stupend meistert.
Jaroussky hat lange gezögert, die Musik Porporas in sein Repertoire aufzunehmen, aber schließlich in dessen Kompositionen viele berührende Arien entdeckt, die seiner Stimme perfekt entsprechen. Diese sind es dann auch, die den stärksten Eindruck hinterlassen. Zweifellos ist Acis „Alto Giove“ aus Polifemo der Höhepunkt dieser Sammlung – in seiner Wirkung wahrhaft mirakulös durch die körperlos schwebende Stimme, den entrückten Ausdruck, die scheinbar unendlichen Atemreserven. Das Venice Baroqe Orchestra unter Andrea Marcon, das den Sänger insgesamt sehr einfühlsam begleitet, erschafft gerade in dieser Nummer wunderbare orchestrale Stimmungen. Aus dieser Oper erklingt noch eine weitere Arie des Aci („Nel già bramoso petto“), deren heroische Koloraturläufe der Interpret stupend meistert.



 Wir wollen uns heute aber auf die Gräber bedeutender Sänger beschränken. Beginnen wir mit dem wuchtigen Granit-Findling, der das Grab der gefeierten, stimmlich eher filigranen Koloratrice Frieda Hempel markiert. Nach fulminantem Karrierestart entschwand sie einst schnell an die New Yorker Met, beendete früh ihre Karriere, und konzentrierte sich anschließend auf die Mehrung ihres beträchtlichen Vermögens. Auf Schallplatten ist uns ihre agile, zu unglaublichen Höhenflügen fähige Stimme erhalten geblieben (Grabstelle I-Erb-12). Unweit davon das schlichte Urnengrab der bedeutenden Mezzosopranistin Margarete Klose und ihres Ehemannes und Lehrers Walter Bültemann. Die lebenslange Geheimhaltung ihres korrekten Geburtsdatums setzt sie konsequent auf ihrem Grabstein fort – sie unterschlägt es (Grabstelle I Ur-8).
Wir wollen uns heute aber auf die Gräber bedeutender Sänger beschränken. Beginnen wir mit dem wuchtigen Granit-Findling, der das Grab der gefeierten, stimmlich eher filigranen Koloratrice Frieda Hempel markiert. Nach fulminantem Karrierestart entschwand sie einst schnell an die New Yorker Met, beendete früh ihre Karriere, und konzentrierte sich anschließend auf die Mehrung ihres beträchtlichen Vermögens. Auf Schallplatten ist uns ihre agile, zu unglaublichen Höhenflügen fähige Stimme erhalten geblieben (Grabstelle I-Erb-12). Unweit davon das schlichte Urnengrab der bedeutenden Mezzosopranistin Margarete Klose und ihres Ehemannes und Lehrers Walter Bültemann. Die lebenslange Geheimhaltung ihres korrekten Geburtsdatums setzt sie konsequent auf ihrem Grabstein fort – sie unterschlägt es (Grabstelle I Ur-8). Noch unauffälliger und schwer auffindbar ist die Grabstelle des Heldentenors Ludwig Suthaus, Furtwänglers Tristan in der gefeierten Nachkriegsinszenierung im Berliner Admiralspalast. Durch die spätere Plattenaufnahme des Werks unter Furtwängler hat er ein Stück Unsterblichkeit erlangt (Grabstelle II Ur-3124). Ein stilisiertes steinernes kleines Teehaus schmückt das Grab der japanischen Sängerin Michiko Tanaka, die vor ihrer Heirat mit dem Schauspieler Victor de Kowa als Opernsängerin, später Filmschauspielerin erfolgreich war (Grabstelle 16 G-29).
Noch unauffälliger und schwer auffindbar ist die Grabstelle des Heldentenors Ludwig Suthaus, Furtwänglers Tristan in der gefeierten Nachkriegsinszenierung im Berliner Admiralspalast. Durch die spätere Plattenaufnahme des Werks unter Furtwängler hat er ein Stück Unsterblichkeit erlangt (Grabstelle II Ur-3124). Ein stilisiertes steinernes kleines Teehaus schmückt das Grab der japanischen Sängerin Michiko Tanaka, die vor ihrer Heirat mit dem Schauspieler Victor de Kowa als Opernsängerin, später Filmschauspielerin erfolgreich war (Grabstelle 16 G-29). Geradezu ein Wallfahrtsort für Wagnerianer ist das Grab von Frida Leider, der vielleicht bedeutendsten Wagnersängerin des 20. Jahrhunderts. Ihre Schallplatten sind bis heute wahre Ikonen des Wagnergesangs, und höchster Gesangskultur ganz allgemein. Sie ruht neben ihrem jüdischen Ehemann Rudolf Deman, einst Konzertmeister der Staatskapelle Berlin, von den Nazis verfolgt, von seiner Frau löwenhaft verteidigt, und nach seinem Schweizer Exil glücklich heimgekehrt. Auch er hat zahlreiche Tondokumente seiner Kunst hinterlassen (Grabstelle 19N-26/27). Der hünenhafte Bass-Bariton Michael Bohnen, Liebling nicht nur der Frauen, zeitweiliger Ehemann der Tänzerin La Jana, Opern- und Filmstar in der alten wie der neuen Welt, muss sich mit einem winzigen Urnengrab bescheiden, selbst dieses stand vor Jahren schon kurz vor der Einebnung, eine beherzte Enkelin hat dies verhindert. Bohnen, der als Raubein galt, hatte sich in seinem Leben nicht nur Freunde gemacht (Grabstelle 18 B-9).
Geradezu ein Wallfahrtsort für Wagnerianer ist das Grab von Frida Leider, der vielleicht bedeutendsten Wagnersängerin des 20. Jahrhunderts. Ihre Schallplatten sind bis heute wahre Ikonen des Wagnergesangs, und höchster Gesangskultur ganz allgemein. Sie ruht neben ihrem jüdischen Ehemann Rudolf Deman, einst Konzertmeister der Staatskapelle Berlin, von den Nazis verfolgt, von seiner Frau löwenhaft verteidigt, und nach seinem Schweizer Exil glücklich heimgekehrt. Auch er hat zahlreiche Tondokumente seiner Kunst hinterlassen (Grabstelle 19N-26/27). Der hünenhafte Bass-Bariton Michael Bohnen, Liebling nicht nur der Frauen, zeitweiliger Ehemann der Tänzerin La Jana, Opern- und Filmstar in der alten wie der neuen Welt, muss sich mit einem winzigen Urnengrab bescheiden, selbst dieses stand vor Jahren schon kurz vor der Einebnung, eine beherzte Enkelin hat dies verhindert. Bohnen, der als Raubein galt, hatte sich in seinem Leben nicht nur Freunde gemacht (Grabstelle 18 B-9). Tatsächlich verschwunden und selbst in den Aufzeichnungen der Friedhofsverwaltung nicht mehr auffindbar ist das Grab Leo Schützendorfs, auch er Bass-Bariton und der bedeutendste Künstler von mehreren singenden Brüdern. Gleichsam zum Trost für das verlorene Grab hat man einen Weg auf dem Friedhof nach ihm benannt. Ebenfalls nicht mehr existent ist die Grabstelle des einst gefeierten Baritons Desider Zador. Der gebürtige Ungar wirkte an fast allen wichtigen europäischen Opernhäusern, zuletzt an der heutigen Deutschen Oper in Charlottenburg. Noch vorhanden ist das Grab des Tenors Harry Steier, lange Jahre Ensemblemitglied des Charlottenburger Opernhauses, mit häufigen Auftritten in Bayreuth in kleinen Rollen, der unzählige Volksliedplatten hinterlassen hat, aber auch eine höchst dubiose Aufnahme: „Adolf Hitlers Lieblingsblume“, die offenbar selbst den Nazis zu kitschig war, und alsbald wieder aus dem Katalog gestrichen wurde (Grabstelle 12B-19/20).
Tatsächlich verschwunden und selbst in den Aufzeichnungen der Friedhofsverwaltung nicht mehr auffindbar ist das Grab Leo Schützendorfs, auch er Bass-Bariton und der bedeutendste Künstler von mehreren singenden Brüdern. Gleichsam zum Trost für das verlorene Grab hat man einen Weg auf dem Friedhof nach ihm benannt. Ebenfalls nicht mehr existent ist die Grabstelle des einst gefeierten Baritons Desider Zador. Der gebürtige Ungar wirkte an fast allen wichtigen europäischen Opernhäusern, zuletzt an der heutigen Deutschen Oper in Charlottenburg. Noch vorhanden ist das Grab des Tenors Harry Steier, lange Jahre Ensemblemitglied des Charlottenburger Opernhauses, mit häufigen Auftritten in Bayreuth in kleinen Rollen, der unzählige Volksliedplatten hinterlassen hat, aber auch eine höchst dubiose Aufnahme: „Adolf Hitlers Lieblingsblume“, die offenbar selbst den Nazis zu kitschig war, und alsbald wieder aus dem Katalog gestrichen wurde (Grabstelle 12B-19/20). Prominentester „Neuzugang“ ist der große Dietrich Fischer-Dieskau, Kammersänger, Ehrenbürger Berlins, und auch sonst mit allen nur erdenklichen Ehrungen überschüttet. Das am häufigsten nachgefragte und von Legenden umwobene Grab existiert nicht mehr: die aufstrebende Hochdramatische Gertrud Bindernagel, nach einer Siegfried-Aufführung an der Berliner Bismarckstraße von ihrem alkoholisierten Noch-Ehemann Wilhelm Hintze angeschossen, erlag Tage später einer Embolie. Das Leben ist zumeist erheblich trivialer als die letzten von ihr gesungenen Worte: „Leuchtende Liebe, lachender Tod“. Tausende sollen ihrer Beerdigung als Zaungäste beigewohnt haben, heute ist ihr Name nur noch Kennern ein Begriff. Bei der Versammlung so vieler unvergesslicher Stimmen verwundert es nicht, dass Gerüchte von in hellen Vollmondnächten stattfindenden Tristan-Aufführungen wissen wollen, wie die Welt sie noch nicht gehört hat….
Prominentester „Neuzugang“ ist der große Dietrich Fischer-Dieskau, Kammersänger, Ehrenbürger Berlins, und auch sonst mit allen nur erdenklichen Ehrungen überschüttet. Das am häufigsten nachgefragte und von Legenden umwobene Grab existiert nicht mehr: die aufstrebende Hochdramatische Gertrud Bindernagel, nach einer Siegfried-Aufführung an der Berliner Bismarckstraße von ihrem alkoholisierten Noch-Ehemann Wilhelm Hintze angeschossen, erlag Tage später einer Embolie. Das Leben ist zumeist erheblich trivialer als die letzten von ihr gesungenen Worte: „Leuchtende Liebe, lachender Tod“. Tausende sollen ihrer Beerdigung als Zaungäste beigewohnt haben, heute ist ihr Name nur noch Kennern ein Begriff. Bei der Versammlung so vieler unvergesslicher Stimmen verwundert es nicht, dass Gerüchte von in hellen Vollmondnächten stattfindenden Tristan-Aufführungen wissen wollen, wie die Welt sie noch nicht gehört hat….
 Zusammengenommen mit der vor drei Jahren erfolgten Veröffentlichung aller RIAS-Einspielungen aus dem gleichen Zeitraum ist das ein gewaltiger Brocken. Allein deshalb ein Brocken, weil Celibidache nicht nur Brahms, Haydn und Mozart dirigiert, sondern Komponisten auf seine Programme setzt, die während des Nationalsozialismus verpönt oder gleich verboten waren. Einer von ihnen ist Günter Raphael, der einst die Nachfolge des Thomaskantors Karl Straube antreten sollte, als Halbjude jedoch mit totalem Berufsverbot belegt wurde. Nach Kriegsende konnte er dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten. Er starb 1960 in Köln, ist aber in Meiningen begraben, wo seiner gedacht wird. Raphaels expressive 4. Sinfonie ist erst 1947 entstanden. Darin überwindet er seinen an Brahms orientierten spätromantischen Stil. Der langsame Satz erinnert stark an den Beginn von Bartóks Blaubart, im Finale gibt es gar folkloristische Anklänge.
Zusammengenommen mit der vor drei Jahren erfolgten Veröffentlichung aller RIAS-Einspielungen aus dem gleichen Zeitraum ist das ein gewaltiger Brocken. Allein deshalb ein Brocken, weil Celibidache nicht nur Brahms, Haydn und Mozart dirigiert, sondern Komponisten auf seine Programme setzt, die während des Nationalsozialismus verpönt oder gleich verboten waren. Einer von ihnen ist Günter Raphael, der einst die Nachfolge des Thomaskantors Karl Straube antreten sollte, als Halbjude jedoch mit totalem Berufsverbot belegt wurde. Nach Kriegsende konnte er dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten. Er starb 1960 in Köln, ist aber in Meiningen begraben, wo seiner gedacht wird. Raphaels expressive 4. Sinfonie ist erst 1947 entstanden. Darin überwindet er seinen an Brahms orientierten spätromantischen Stil. Der langsame Satz erinnert stark an den Beginn von Bartóks Blaubart, im Finale gibt es gar folkloristische Anklänge.






 Sacchini ist einer der Komponisten aus dem Gluck-Umkreis und befand sich mit seinem Riesenerfolg an der Accadémie Royal zwischen den Fronten der Gluckisten und Piccinisten, der wie ein politischer Wahlkampf in Paris tobte, ähnlich wie der zwischen Händel und Porpora. Es war eine prä-revolutionäre, politisch-gesellschaftlich motivierte Ästetikdebatte für oder wieder die Reformoper, wie Gluck sie angeschoben hatte. Und es ist wieder einmal jene Zeit, in der die Pariser Musikszene von Ausländern beherrscht wird, wie vorher von Lully, später von Meyerbeer und Verdi – immer wenn´s musikalisch ein bisschen stagnierte kamen Italiener oder Deutsche, um die Pariser Szene aufzumischen, nicht ohne starke Ressentiments auszulösen (wie Wagners Tannhäuser). Die vorliegende Aufnahme bei Ediciones Singulares (Note 1) bietet dazu in der eleganten Buch-CD-Ausgabe einen spannenden Artikel von Benoit Dratwicki über den Anteil der Ausländer an der Académie Royal de la Musique (der Pariser Oper) von 1774 – 1789.
Sacchini ist einer der Komponisten aus dem Gluck-Umkreis und befand sich mit seinem Riesenerfolg an der Accadémie Royal zwischen den Fronten der Gluckisten und Piccinisten, der wie ein politischer Wahlkampf in Paris tobte, ähnlich wie der zwischen Händel und Porpora. Es war eine prä-revolutionäre, politisch-gesellschaftlich motivierte Ästetikdebatte für oder wieder die Reformoper, wie Gluck sie angeschoben hatte. Und es ist wieder einmal jene Zeit, in der die Pariser Musikszene von Ausländern beherrscht wird, wie vorher von Lully, später von Meyerbeer und Verdi – immer wenn´s musikalisch ein bisschen stagnierte kamen Italiener oder Deutsche, um die Pariser Szene aufzumischen, nicht ohne starke Ressentiments auszulösen (wie Wagners Tannhäuser). Die vorliegende Aufnahme bei Ediciones Singulares (Note 1) bietet dazu in der eleganten Buch-CD-Ausgabe einen spannenden Artikel von Benoit Dratwicki über den Anteil der Ausländer an der Académie Royal de la Musique (der Pariser Oper) von 1774 – 1789. Christoph Rousset (Foto oben/CVS)
Christoph Rousset (Foto oben/CVS)