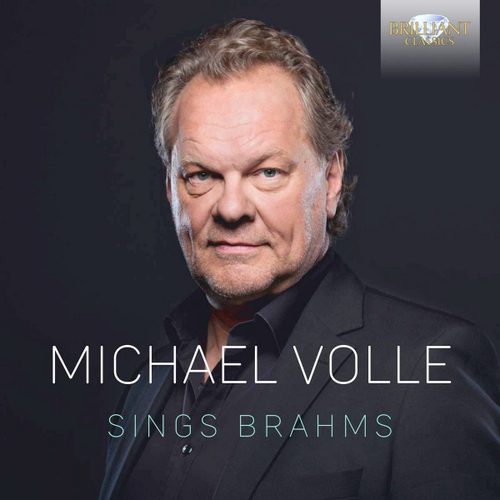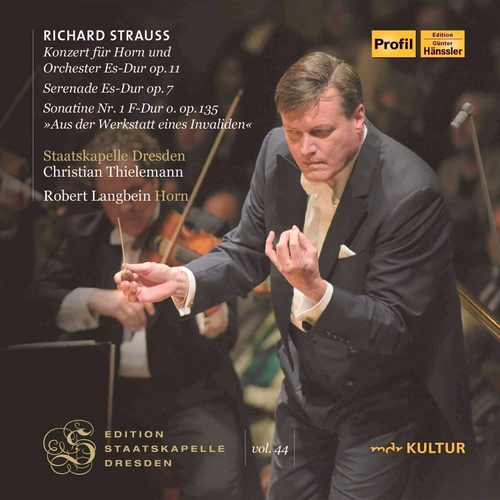„Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“: In seine neue Edition von Melodramen („Flügel musst du mir jetzt geben“) hat Peter P. Pachl dieses Werk von Rainer Maria Rilke gleich zweifach aufgenommen. Einmal von Casimir von Pászthory, der das Werk 1914 mit Klavierbegleitung versah, zum anderen in der Bearbeitung durch Viktor Ullmann aus dem letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges 1944. Erschienen ist die Sammlung bei Thorofon (CTH26453). Der 1886 in Budapest geborene Pászthory kam schon in jungen Jahren nach Deutschland, ging dann nach Wien, wo er Jura studierte und sich bald der Musik zuwandte. Er war NSDAP-Mitglied. Vornehmlich komponierte er musikdramatische Werke und Lieder, die vergessen sind. Einzig seine 1942 entstandene Oper Tilmann Riemenschneider kam 2004 in Würzburg wieder auf die Bühne. Ullmann, dessen Eltern vom jüdischen zum katholischen Glauben übergetreten waren, hatte – wie Pászthory – auch in Wien zunächst juristische Studien aufgenommen und war schließlich Kompositionsschüler Schönbergs geworden. Sein Melodram entstand im KZ-Ghetto Theresienstadt, wohin ihn die Nationalsozialisten verschleppt hatten. Dort fand auch die erste Aufführung statt. Wenige Wochen danach wurde Ullmann in Auschwitz ermordet.
Gegensätzlicher können die Hintergründe beider Kompositionen nicht sein. Rilkes Prosastück, das in seiner Verdichtung Züge eines Gedichts trägt, traf schon kurz nach seiner Veröffentlichung auf ein damals vorherrschendes fatalistisches Lebensgefühl. Der Erste Weltkrieg lag in der Luft. Allenthalben war die Begeisterung für den Waffengang weit verbreitet. Vor diesem Hintergrund hatten Heldentod-Geschichten Konjunktur. Rilkes Werk eröffnete 1912 mit der Nummer eins und einer Auflage von zehntausend Exemplaren die berühmte Inselbücherei und war sofort vergriffen. Inzwischen hat die Auflage die Millionen-Grenze weit überschritten. Das schmale Bändchen steht in fast jedem Bücherschrank, wurde genauso anteilnehmend gelesen – wie auch eklatant missverstanden. Bis auf den Vorspann verarbeitete Pászthory den gesamten Text. Er braucht dafür mehr als eine halbe Stunde. Es gibt sehr melodiöse und elegische Momente. Wenn – um ein Beispiel anzuführen – die Rede auf „ein altes trauriges Lied“ kommt, „das zu Hause die Mädchen auf den Feldern singen, im Herbst, wenn die Ernten zu Ende gehen“, dann tönt aus dem Klavier eine entsprechende Melodie. Und wenn das Wachtfeuer brennt, dann tanzen die Flammen wie am Schluss von Wagners Walküre. Ullmann hält am Vorspann, der nicht ganz unwichtig ist für das Verständnis der Geschichte, fest. Dafür kürzt er an anderen Stellen und verdichtet damit den dramatischen Gehalt. Seine Tonsprache wirkt härter und unsentimental. In Booklet vermerkt Pachl aber auch musikalische Gemeinsamkeiten beider Werke und kommt zu dem Schluss, „dass Ullmann Pászthorys Version nicht unbekannt war“.
Pachl ist nicht nur Herausgeber der Edition, er spricht auch selbst. Und das hört sich gut an. Geboren wurde er in Bayreuth. Sprachlich, so scheint es, schlägt die fränkische Herkunft noch immer durch. Ein sympathischer Zug der ungewöhnlichen Produktion. Pachl ist als Regisseur, Hochschullehrer und Musikschriftsteller hervorgetreten und steht jetzt als Intendant den Berliner Symphonikern vor. Seinem vielseitigen und umtriebigen Wirken hatte er schon mit der ersten Sammlung von Melodramen, die ebenfalls bei Thorofon (CTH2633/3) herausgekommen war, eine weitere Facette hinzugefügt. Am Flügel wird er von Rainer Maria Klaas begleitet, der in beiden Produktionen auch als Komponist vertreten ist – zunächst mit Die Tanzgilde (Otto Julius Bierbaum nach Arne Garborg), jetzt mit dem Zauberlehrling nach der gleichnamigen Ballade Goethes, die er als „Improvisation“ versteht und die vom Vortragenden viel schauspielerisches Können abfordert. Es wird deutlich, dass sich die im 18. Jahrhundert verwurzelte musikalische Form noch längst nicht erschöpft hat.

Alexander Ritter und seine Familie waren Richard Wagner eng verbunden. Sein Melodram „Graf Walther und die Waldfrau“ basiert auf der gleichnamigen Ballade von Felix Dahn. Foto: Booklet
Der 1950 geborene Klaas ist der jüngste Komponist der neuen Edition – Alexander Ritter (1833-1896) der älteste. Mit ihm kommt auch Richard Wagner ins Spiel. In Dresden hatte Ritter die Uraufführungen von Rienzi, Holländer und Tannhäuser erlebt. Seine Mutter Julie unterstützte Wagner finanziell, Bruder Karl lebte als Schüler in dessen Umfeld. Auch Alexander, der in Liszts Weimarer Hofkapelle Violine spielte, kannte Wagner persönlich. Sein Melodram Graf Walther und die Waldfrau basiert auf der gleichnamigen Ballade von Felix Dahn, in der Pachl im Booklet völlig zu Recht eine Paraphrase auf Wagners Tannhäuser sieht. Der Topos von der Verführerin „auf grünem Moos, unter dichtem Blättergitter“ geistert in vielerlei Gestalt durch die Literatur. Eine Bezug zu Wagner ist auch bei Max Zenger (1837-1911) zu finden, der eine Oper Wieland der Schmied komponierte, währen der Sagenstoff bei Wagner nur ein Entwurf blieb. Mit dem Melodram Die Kraniche des Ibykus, basierend auf der Ballade Schillers, ist laut Pachl erstmals eines seiner Werke eingespielt worden. Der prominenteste Name auf den Tracklisten der über drei CDs verteilten fünfzehn Werke ist Engelbert Humperdinck. Der hat den Epilog des Spielmanns in seiner Oper Königskinder zu einem Melodram verarbeitet, bei dem sich auf sein Verlangen die Deklamation „immer mehr bis zum Gesang“ steigern soll. Pachl: „Die Dichtung stammt von Elsa Bernstein, die unter ihrem Pseudonym Ernst Rosmer als Bühnenautorin und Schriftstellerin erfolgreich war. Die Tochter von Heinrich Porges, einem illegitimen Sohn von Franz Liszt, wurde 1942 zusammen mit ihrer Schwester Gabriele in das KZ Theresienstadt deportiert“, – hier ergibt sich ein Bezug zum Schicksal von Ullmann – „wo ihre Schwester starb, während Elsa Bernstein … überlebte.“
Max Steinitzer (1864-1936), der sich auch theoretisch mit der Gattung beschäftigt hat, komponierte auch selbst ein Melodram, nämlich Die Braut von Corinth nach Goethes Ballade. Wie Pachl vermerkt, zieht er „die Schlüsse aus der Crux der Melodramen anderer Komponisten, dem schwer zu vereinbarenden Fluss der Musik im Gegensatz zur Spezifik eigener Gesetzmäßigkeiten gestalteter Rede“. Steinitzer habe das Problem „durch ständige Taktwechsel, die dem Duktus der Sprache optimal nachempfunden sind“ gelöst. Nochmals als Textdichter tritt Felix Dahn in Die Mette von Marienberg von Ferdinand Hummel (1855-1928) in Erscheinung. Und auch Goethe wird mit der Ballade Der Gott und die Bajadere abermals bemüht – nunmehr von Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern (1859-1949), einem komponierenden Mitglied des Hochadels. Er stand seinem Vetter Ludwig II. bis zu dessen Tod im Starnberger See nahe. Mehr als Dirigent denn als Komponist ist Oskar Fried (1871-1941) in die Musikgeschichte eingegangen. Er setzte sich vor allem für Gustav Mahler ein und nahm dessen 2. Sinfonie mit der legendären Sopranistin Gertrud Bindernagel auf, die 1932 von ihrem eifersüchtigen Ehemann am Bühneneingang des Deutschen Opernhauses Berlin niedergeschossen wurde und wenige Tage später ihren Verletzungen erlag. Als Jude und bekennender Sozialist floh Fried, der zeitweise als Assistent von Humperdinck gewirkt hatte, vor den Nationalsozialisten in die damalige Sowjetunion, wo er auch starb. Für seine Melodram Die Auswanderer, das 2010 bei Capriccio als Orchesterfassung mit der Schauspielerin Salome Kammer herausgekommen ist, verwendete er Verse aus der Gedichtsammlung „Les Campagnes Hallucinées“ von Èmile Verhaeren, die Stefan Zweig ins Deutsche übersetzt hatte. „Sie kommen von weiß Gott woher und zieh‘n ins blinde Ungefähr aus Schicksalen, die keiner weiß durch Markt und Dörfer, Forst und Stadt. Sie wandern immer da im Kreis, der Tod nur bietet Ruhestatt.“ Solche Verse holen das Werk auf bedrückende Weise in die Gegenwart. Nur schade, dass diesmal die Texte im Booklet nicht abgedruckt wurden wie in der ersten Sammlung. Nicht alles ist in den eigenen Buchbeständen und im Netz verfügbar, um rasch nachgelesen zu werden.

„Das klagende Lied“ und „Mischka an der Marosch“: Mit diesen Melodramen ist Joseph Pembaur d. J. in beiden Teilen der Edition vertreten. Foto: Wikipedia
Neben Klaas ist nur noch Joseph Pembaur d. J. (1875-1950) in beiden Teilen der Edition vertreten – diesmal mit Das klagende Lied. Es beruht auf einem Gedicht von Martin Greif (1839-1919), der vor allem in seiner Geburtsstadt Speyer geehrt wird und vornehmlich durch sein Trauerspiel „Agnes Bernauer“ im Gedächtnis blieb. In diesem Melodram, an dessen Beginn ein sehr eingängiges musikalisches Thema steht, kommt neben dem Klavier eine Flöte (Uwe Mehlitz) zum Einsatz. Aus gutem Grund. Denn in der Handlung spielt ein kleiner menschlicher Knochen eine wichtige Rolle, der einer Flöte gleich von selbst zu singen ansetzt und die unheimliche Geschichte vom Geschwistermord berichtet. Die hat mehrere Quellen, bei den Brüdern Grimm genauso wie bei Ludwig Bechstein. Mal erschlägt ein Bruder den anderen, mal ein Prinz die schwesterliche Prinzessin. Mahler hat mit demselben Titel wie Pambaur seine frühe Kantate geschaffen. Im Melodram kommt die Prinzessin durch den Bruder zu Tode. Pachl nimmt die Dramatik des Geschehens in seine Interpretation wirkungsvoll auf. Wie im Fluge vergehen die knapp zwanzig Minuten. Überhaupt beruht die Wirkung aller Melodram darauf, dass Geschichten erzählt werden. Pembaur war mit Siegfried Wagner befreundet.
Peter P. Pachl, der renommierte Spezialist für Leben und Werk des Sohnes von Richard Wagner, verwendet sich gern für dessen musikalische Zeitgenossen und solche Komponisten, die in seiner musikalischen Nachfolge stehen. Mit Pembaur hatte er wieder so einen aus der Versenkung geholt: „Als Schüler von Ludwig Thuille gehört Josef Pembaur … zur so genannten ,Münchner Schule’, der unter anderen auch die Komponisten Walter Courvoisier, Julius Weismann, Ernest Bloch, Walter Braunfels, August Reuß, Franz Mikorey, Clemens von Franckenstein, Fritz Cortolezis, Edgar Istel, Hermann Wolfgang von Waltershausen, Hermann Abendroth, Paul von Klenau, Rudolf Ficker, Rudi Stephan und Joseph Suder angehörten. Der Sohn Josef Pembaurs d. Ä. unterrichtete ab 1921 selbst an der Münchner Akademie für Tonkunst. Hier war Siegfried Wagners illegitimer erster Sohn Walter Aign Schüler in Pembaurs Meisterklasse. Pembaur und seine Frau Marie gehörten auch zu den Gästen der Geda?chtnisfeier zum dreißigsten Todestag von Franz Liszt, zu der Siegfried Wagner am 31. Juli 1916 ins Haus Wahnfried geladen hatte.“ Nachzulesen im Booklet der ersten Sammlung, in der Pembaur mit Nikolaus Lenaus Mischka an der Marosch bedacht gewesen ist. Marosch ist – in deutscher Schreibweise – der Fluss Mureș, der durch Ungarn und Rumänien fließt. Mischka heißt ein Zigeuner, der sich an einem Grafen rächt, weil dieser seine Tochter verführte. Politisch korrekt ist das nicht. In der Literatur wimmelt es vor Begriffen und Anspielungen, deren Gebrauch riskant geworden ist, weil der Kontext verschwimmt und die historische Einordnung mühsam ist. Geschichte und Schauplatz haben beim Österreicher Lenau einen biografischen Bezug. Er wurde 1802 in Ungarn geboren, wo sein Vater als habsburgischer Beamter tätig war. Lenau, bei dem sich zahlreiche Komponisten von Robert Schumann bis Franz Liszt bedienten, lieferte mit seinem umfänglichen Poem Anna auch die Vorlage für das sehr melodiös gehaltene gleichnamige Melodram vom Heinrich Sthamer (1885-1955), des – so Pachl – „bedeutendsten romantischen Symphonikers der Stadt Hamburg“. Nach Auffassung von Pachl scheint die Dichtung, die einer schwedischen Sage folgt, „eine der uneingestandenen Quellen zur Frau ohne Schatten zu sein. Denn wie die Färberin in der Oper von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss, schwört Anna ihrer Mutterschaft zugunsten des Erhalts ihrer Jugend und Schönheit ab. Sie verliert ihren Schatten, was ihrem Gatten bei einem gemeinsamen Ritt in einer Mondnacht deutlich wird. Und auch Anna begegnen die Ungeborenen“.

Oskar Fried ist vor allem als Dirigent in Erinnerung. Er setzte sich für das Werks Mahlers ein und hinterließ zahlreiche Aufnahmen. In der Edition wird er mit dem Melodram „Die Auswanderer“ als Komponist vorgestellt.
Zur großen Oper von Strauss und Hofmannsthal gibt es noch einen anderen, formalen Bezug. Sie enthält nämlich selbst ein Melodram, das die Kaiserin zu sprechen hat, wenn sie in dritten Aufzug vor ihren Vater tritt und eingestehen muss, sich keinen Schatten erhandelt zu haben. Es besteht aus achtunddreißig Verszeilen. In den gängigen Aufführungen ist es stark gekürzt. Selbst der Strauss-Sachwalter Karl Böhm, der sich wie kaum ein anderer Dirigent für diese Oper eingesetzt hat, akzeptierte bei der ersten Platteneinspielung die Raffung. Erst Wolfgang Sawallisch, der die Frau ohne Schatten 1987 für die EMI komplett einspielte, ließ auch das Melodram durch die Sopranistin Cheryl Studer vollständig vortragen. Im Studio geht das, auf der Bühne erweist sich der scharfe Wechsel in den Sprechgesang für eine Sopranistin, die schon eine lange Partie in extremer Tonlage hinter sich und ein gigantisches Finale noch vor sich hat, als Torur. Zumal die Textzugabe inhaltlich nicht relevant ist.
Pachl weiter: „Auch in Operetten ist der dann für den Tonfilm so bezeichnende Einsatz von Sprechstimme zu symphonischem Orchester anzutreffen, – etwa in der burlesken Operette Die lustigen Nibelungen von Oscar Straus (1870-1954). Bereits unter den zahlreichen Überbrettl-Liedern des mit rund 50 Bühnenwerken besonders aktiven Komponisten findet sich ein Melodram. Den Dialog einer erfolgreichen Verführung ,Geflüster im Gange’, op. 74, hat Straus als eine Dauerbewegung des Klaviers ,Presto e leggiero’ und una chorda vertont. Das die huschende Komposition bestimmende Pianissimo verebbt mit dem schwindenden Widerstand des Mädchens gegenüber dem sie zum Beischlaf überredenden jungen Mann in ein Pianopianissimo. Das Gedicht stammt von dem wohl meistvertonten Lyriker der Wende zum 20. Jahrhundert, Otto Julius Bierbaum (1865 – 1910), der auch der literarische Vordenker des ersten deutschen Kabaretts, des am 18. Januar 1901 von Ernst von Wolzogen in Berlin eröffneten ,Überbrettl’ war.“ Das Stück, nicht viel mehr als eine Minute lang, ist im ersten Teil der Edition anzutreffen, wo es sich als freche Einlage zwischen den von Weltschmerz erfüllten Balladen sehr gut macht. Der Zuhörer kann aufatmen, um sich mit Anteilnahme und aller erforderlichen Aufmerksamkeit der nächsten großen Nummer hinzugeben.

Engelbert Humperdinck hat den Epilog des Spielmanns in seiner Oper „Königskinder“ auch als Melodram hinterlassen., Foto: Sammlung Manskopf
Für Die Nachtigall von Arnold Winternitz nach Christian Andersens sind fast vierzig Minuten einzuplanen, für Der Fluch der Kröte auf einen Text von Gustav Meyrink, den sein Roman „Der Golem“ berühmt gemacht hat, lediglich zwölf. Im Booklet reserviert Pachl dem Komponisten, der 1874 geboren wurde und 1928 gestorben ist, eine ausführliche Passage. Winternitz, der neben Opern auch „Pantomimen, Klavierstücke und eine Reihe von Liedern und Kinderliedern komponiert hat, wird im ,Lexikon der Juden in der Musik’ nur als Komponist der Melodramen ,Nachtigall’ und ,Kröte’ genannt. In diesen beiden Melodramen bewies er seine Meisterschaft, trefflich zu charakterisieren, mit wenig musikalischem Material, das er höchst variativ einsetzt. Sein Melodram ,Die Nachtigall’ für Sprechgesang und Orchester widmete er ,Dr. Ludwig Wüllner in dankbarer Verehrung’. Ludwig Wüllner (1858 – 1938), Sohn des Komponisten und Dirigenten Franz Wüllner, Philologe, Tenor und ,Herzoglich Meiningischer Hofschauspieler’, gastierte an allen großen Bühnen, u. a. als Tannhäuser und als Siegmund. Als Liedersänger führten ihn Konzertreisen nach ganz Europa und bis in die USA, wo er unter Gustav Mahler 1910 die amerikanische Erstaufführung der ,Kindertotenlieder’ sang. Offenbar gehörten auch Winternitz’ Lieder und Melodramen zu seinen reichhaltigen Programmen. ,Die Nachtigall’ interpretierte er als Deklamator beispielsweise am 6. Februar 1920 in einem Konzert des Philharmonischen Orchesters unter Werner Wolff, gekoppelt mit Bruckners Sechster und der Ouvertüre zu Peter Cornelius’ ,Der Barbier von Bagdad’ in der Berliner Philharmonie, und ebenda erneut am 7. Februar 1924.“ Solcherart waren seinerzeit Programme. Der Fischer wird in Goethes gleichnamiger Ballade von einer Nixe mit Gesang und süßen Versprechungen in die Tiefe gelockt. Dichter und Maler haben das Thema gern aufgegriffen. Goethes Verse wurden oft vertont, von Carl Loewe zum Beispiel und auch von Franz Schubert. Camillo Horn (1860-1941) hat sie für seine Melodram gewählt. Unter literarischen Gesichtspunkten überragt es die anderen Vorlagen der Sammlung. Stark hat sich der Komponist, dessen Namen mir bislang nicht geläufig war, von Goethe inspirieren lassen. Düster rauscht das Wasser im einleitenden Klavierpart. „Wie Wolff und Schreker wirkte der im böhmischen Reichenberg geborene Bruckner-Schüler Camillo Andreas Horn (1860 – 1941) in Wien. Er komponierte zwei Symphonien, Kammermusik sowie über 100 Chorwerke und Lieder“, so Pachl. Der Fischer gehört zu einer Werkgruppe aus drei Melodramen, die komplett eingespielt wurden. Dazu gehört das scheinbar mit Goethe korrespondierende Gedicht „Das Kind am Brunnen“ von Friedrich Hebbel, mit „der gefährlichen Verführung durch das Spiegelbild des Knaben im Wasser“, das sich „erst in den letzten drei Takten als heiteres Pendant“ erweist. Das dritte von Horn melodramatisch vertonte Gedicht, Die Zwerge auf dem Baum stammt von August Kopisch (1799–1853). Er ist vor allem durch die von Loewe komponierte Heinzelmännchen-Ballade in Erinnerung geblieben. Was noch in diesem Auftakt-Produktion von Melodramen? Von Franz Schreker fiel die Wahl auf sein Melodram Das Weib des Intaphernes nach Eduard Stucken, in dessen orientalischer nach Darstellung von Pachl „Pervertierung von Macht“ herrsche. „Intaphernes’ Weib erklimmt den Turm des Perserkönigs Darius, um den Diktator zur Freilassung ihrer inhaftierten Familie zu veranlassen. Darius aber ist nur bereit, als Preis für ihre körperliche Hingabe, einen der Ihren frei zu geben. Sie entflammt ein Feuer, in dem alle Beteiligten umkommen.“ Die Befreiung des Gatten durch seine liebende Frau ist gescheitert. In der Geschichte dreht sich der Fidelio-Stoff in sein Gegenteil um.

„Auf dem Meer der Lust in hellen Flammen“: Unter diesem Titel hat Peter P. Pachl den ersten Teil seiner Sammlung von Melodramen herausgegeben.
In ihrer Kompaktheit dürften beide Teile der Edition derzeit einzigartig sein auf dem Musikmarkt. Fortgesetzt macht Peter P. Pachl Lust darauf, sich mit dem Genre, das seinen Höhepunkt im 19. Jahrhundert hatte, erneut zu beschäftigen. Ein Melodram, das auch heute noch auf Konzertprogrammen steht und ebenfalls mehrfach eingespielt wurde, ist das Hexenlied von Max von Schillings (1868-1933) nach Ernst von Wildenbruch. Pachl trägt in der ersten Sammlung die Fassung mit Klavierbegleitung vor und legt dabei eine seiner besten Leistungen hin. Immerhin muss er sich gegen Konkurrenz behaupten, die ihm gut bekannt sein dürfte. Wieder sitzt jedem potentiellen Interpret Dietrich Fischer-Dieskau mit seiner Aufnahme bei der Deutschen Grammophon im Nacken. Unvergessen ist mir eine Aufführung in der Deutschen Oper Berlin mit dem Orchester des Hauses unter Christian Thielemann und Martha Mödl in der Spätzeit ihrer langen Karriere. Das Haus tobte, was wohl in erster Linien auf die Interpreten zurückzuführen gewesen sein dürfte. Doch auch das Werk selbst bekam seinen Teil des Beifalls ab. Eine Studioeinspielung der Mödl von 1992 ist bei cpo im Angebot (LC 8492). Pachl: „Der Gesang eines schönen, unschuldig zum Feuertod als Hexe verurteilten jungen Mädchens, lässt den jungen Mönch Medardus ein Leben lang, bis in den Tod, nicht los. Der Sänger, Schauspieler und Deklamator Ludwig Wüllner hat Schillings’ im Jahre 1902 erschienenes Melodram gleich zweimal unter der Leitung des Komponisten auf Schallackplatten eingespielt – zunächst akustisch, dann wenige Tage vor Schillings’ Tod, im Jahr 1933, als 74-jähriger Deklamator, nochmals elektrisch. Max von Schillings’ Schaffen wird heute aufgrund seiner Vita vielfach geächtet, denn der Komponist, Dirigent und Theaterleiter wurde 1932 Präsident der Preußischen Akademie der Künste, an der Franz Schreker und Arnold Schönberg lehrten; und ein Jahr später teilte Schillings seinen beiden Kollegen deren Suspendierung vom Amt mit. Als Opernintendant jedoch hatte Schillings Schrekers Opern durchaus gepflegt. Selbst im frühen ,Hexenlied’ wird heute bisweilen ein versteckter Antisemitismus gemutmaßt: die schwarzen Haare der Hexe in der Dichtung habe Schillings durch die ,talmudische Terz’ und sein ,Changieren zwischen Dur und Moll’ , das ins ,Shtetl’ verweise, als Jüdin gezeichnet, wohingegen der Choral der Mönche ,manche Wendung aus patriotischem Liedgut’ enthalte. Dabei wird allerdings übersehen und überhört, dass Schillings’ Tonsprache ein klares Plädoyer für die Hexe und gegen die Mönche bezieht.“ Wüllners späte Aufnahme findet sich im Katalog von Bayer-Records (BR 200 049 CD). Ich habe sie lange nicht gehört. Während ich mich mit der Edition von Pachl beschäftigte, suchte ich sie wieder hervor. Ein Vergleich wäre der völlig falsche Ansatz. Wüllner agiert mit dem Pathos des frühen 20. Jahrhunderts, Pachl sucht durch einen schlichten, klaren und schnörkellosen Vortragsstil das Melodram auch im 21. Jahrhundert zu platzieren. Mit der Interpretation von Wüllner aber wird deutlich, warum diese Gattung zwischen Oper und Schauspiel, an der sich auch das Bürgertum in seinen Salons versuchen konnte, einst so beliebt und verbreitet war (Foto Otto-Lilienthal-Denkmal von Peter Breuer (1914) im Park an der Bäkestraße 14a in Berlin-Lichterfelde/ Ausschnitt/ Foto Winter). Rüdiger Winter