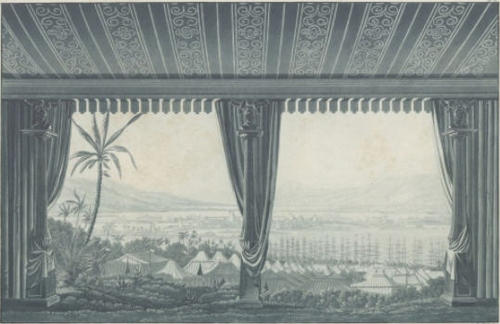.
Kaum eine andere Sängerin im französischen Bereich hat mich so enthusiasmiert wie Andrée Esposito. Sie hat so etwas in ihrer Stimme mit dem flirrenden Timbre, der energischen Höhe, der Sinnlichkeit im mittleren Bereich, das sie für mich un-austauschbar macht, sofort wieder erkennen lässt, etwas so Hochindividuelles, wie man das selten findet. Sie trifft mich direkt. und ist so immens vielseitig gewesen, dass ihr Repertoire staunen machen. Von der lyrischen Mireille bis zur bezaubernden Manon Massenets zur entschlossen-erotischen Thais duchmisst sie die Rollen ihres Fachs mit dem ihr eigenen Elan, und es ist diese Entschlossenheit der Gestaltung und Bewältigung, sie sie auszeichnen. Wäre es kitschig zu sagen, ich bin ihr verfallen? Reinakustisch natürlich, weil ich sie nicht auf der Bühne mehr gehört habe. Aber ihre vielen, vielen Dokumente lassen mich immer wieder staunen und schwelgen in dieser Flut reinfranzösischen Klangs, wie es ihn heute nicht mehr gibt. Die ganze Kunst der Esposito mit ihrer unglaublich sicheren, leuchtenden Höhe, ihrer zum Mitschreiben deutlichen Diktion und ihrem unverwechselbaren französischen Timbre par excellence ist in ihren Partien nachhörbar. Andrée Esposito gehörte zu den wirklich typischen Sänger/innen ihrer Zeit..

Andrée Esposito als Manon/Heinsen/Esposito
Sie ist neben ihren Kolleginnen Renée Doria, Berthe Monmart, Andréa Guiot, Georgette Cammart, Suzanne Sarrocca und vielen anderen eine jener Sängerinnen in Frankreich, die nach dem Krieg das französische Repertoire (und nicht nur das) zu einer hohen Qualität geführt haben, eine, die in würdiger Nachfolge der Vorgängerinnen wie Félia Litvinne, Germaine Lubin oder Ninon Vallin eben jenes spezifische Flair, jene unnachahmliche Diktion, jenen Strahl der unverwechselbar französisch geführten Stimme aufbrachte, jene sofortige Wiedererkennbarkeit der individuellen Stimme zeigt, die uns heute so vergessen scheint. Die Esposito ist nicht übermäßig oft „offiziell“ dokumentiert worden (viele Veröffentlichungen sind Radiomitschnitte, die erst nach ihrer Karriere veröffentlicht wurden). Sie steht damit nicht allein – ihre Kollegen Alain Vanzo, Albert Lance (kein originaler Franzose), Charles Richard (dto.), Julien Haas, die Crespin, die Doria, Michel Dens, Pierre Mollet, Andre Pernet, Guy Chauvet, Janine Collard, Hélène Bouvier aus der älteren Generation, natürlich Robert Massard ebenfalls unvergessen, und viele, viele andere waren von dem Umbruch betroffen, der mit Liebermanns Übernahme der Pariser Oper begann und der die französischen Sänger in die Provinz und ins Radio schickte, während in der Hauptstadt – bis heute – ausländische Sänger in der Originalsprache ein anderes Verständnis von Oper einführten und das Typische verdrängten.
Andrée Esposito, am 7. Februar 1934 in Algier geboren, trat ebendort erstmals bei einem Konzert 1951 auf, ging nach Studien bei Nougera und Panzera nach Nancy (1956 Debut in Erlangers Juif polonais), anschließend an alle großen französischen Bühnen, namentlich Nizza, wo sie sie mit ihrem späteren Mann, den Bass-Bariton Julien Haas, sang. 1959 gab sie ihr glanzvolles Debut als Violetta an der Pariser Oper (Palais Garnier), eine Rolle, mit der sie stets identifiziert wurde und die sie noch in den Neunzehnhundert-Achtzigern als Einspringerin sang. Auch an der Pariser Opéra-Comique hatte sie ihre Erfolge, namentlich mit Bondevilles Madame Bovary. Sie war eine der bedeutendsten dramatischen Koloratursopranistinnen in Frankreich mit einer hervorragenden Eignung zum dramatischen Repertoire, so als Violetta, Manon, Juliette oder Marguerite, aber auch mit weniger gängigen Partien. Zudem war sie eine bedeutende Liedsängerin, wie einige Dokumente belegen. Für mich hatte sie eine der attraktivsten und französischsten Sopranstimmen! Ein erstes Hören in den Siebzigern ließ mich diese hellen, glitternden, in allen Registern so vortrefflich durchgearbeiteten Sopranstimme verfallen. Viele Momente bleiben von ihr in Erinnerung, etwa das „Enfin“ in der Manon-St.-Sulpice-Szene, wenn Manon ihren Des Grieux endlich „rumgekriegt“ hat, ihr hochdifferenziert gesungenes Air de Bijoux im Faust, ihre vielschichtige angelegte erste Arie in der Thais, aber auch ihre barocken Ausflüge und für mich vor allem die Auftrittsarie der Teresa in Benvenuto Cellini: welcher Glanz, welcher Jubel, welche Persönlichkeit in der Stimme.
.

Alain Vanzo und Andrée Esposito/ Filmszene aus „Manon“/OBA
Andrée Esposito ist auf recht vielen Dokumenten erhalten (vor allem bei youtube), auch auf manchen Radiomitschnitten und davon wichtigen. Dies schreibe ich, während im Hintergrund ihre ganz wunderbare Marguerite in Gounods Faust singt, die Bella Voce (des umtriebigen Walter Knoeff) auf einem Mitschnitt des Faust mit Robert Massard und Albert Lance unter Roberto Benzi 1972 aus Amsterdam veröffentlicht hat. Die ganze Kunst der Esposito mit ihrer unglaublich sicheren Höhe, ihrer zum Mitschreiben deutlichen Diktion und ihrem unverwechselbaren, leuchtenden französischen Timbre par excellence ist hier nachhörbar. Diese junge Frau, Marguerite, auf dem Weg zum Wahnsinn, durch Keuschheit, Liebe, Verführung und Verrat, erzählt uns eine Geschichte, breitet ein Schicksal aus – und meistert die beträchtlichen Tücken der Partie ohne jede Schwierigkeiten mit Glanz.
Ein ehemaliger Philips-Querschnitt zeigt sie ebenfalls in einem Faust, sodann gibt es sie mit Rameau bei DG (Pygmalion, Les Indes Galantes, exc. Couraud mit Collard 1962), mit dem Chanson perpétuel von Chausson auf einer EMI-CD (Jacquillat), mit Kantaten von Vivaldi (dto.), als Glauce neben einer monströsen Médée der Rita Gorr bei La Voix de son maître (Prêtre) in einem Querschnitt der Oper, die Philine in einem Mignon-Querschnitt (dto.) mit der intensiven Jane Rhodes, die Inès in einem Africaine-Querschnitt neben Tony Poncet bei Philips sowie Saugets Caprices de Marianne unter Manuel Rosenthal 1959 bei Solstice. Sie singt auch Clérambault-Kantaten (Médée u. a./Blanchard) bei Pathé. Auf dem Gebiet der Operette war sie auch zu Hause, so in den Dragons de Village bei Decca/Accord und eine Chauve Souris, Sangue de Vienne und Kalmáns Comtesse Mariza unter Siebert von 1962 (Éditions Montparnasse) als DVD vom Fernsehen.

Andrée Esposito als Thais/Heinsen/Esposito
Es gibt viele Lieblingsaufnahmen von ihr für mich. Die wirklich grandiose Teresa im Berliozschen Cellini, die wunderbare Marguerite, ihre unübertroffene Thais, die leuchtende Rozenn im Roi d´Ys: ach eigentlich alle. Der französische Rundfunk hat vieles von ihr konserviert (und man dankt der INA, das ist das Institut National Audiovisuel, einmal mehr für die Sorge der Franzosen um ihre nationales Erbe, während ja sonst auf Frankreichs Bühnen davon nicht immer was zu merken ist). Ihr häufiger Partner war der kürzlich bei uns noch einmal vorgestellte Tenor Alain Vanzo, wie die Esposito und Robert Massard eine der Säulen der französischen Gesangs der Sechziger/Siebziger. Der Manon auf dem Philips-Querschnitt (Etcherverry) folgte die Radio-Version von (Standardlänge für Studio/Konzert-Opern im französischen Rundfunk, 120 Minuten oft mit Ansage und Einführung) 100 reine Minuten ebenfalls Massenets Oper von 1968. Mireille 1959 aus derselben Quelle gab es bei Chant du Monde in deren wunderbarer Reihe der französischen Opern und Operetten vom Radio, wo auch Reyers Sigurd erschien. Es gibt auch eine Luisa Miller vom ORTF unter Pierre-Michel Le Conte. Anders als ihre Kollegin Doria erotisiert sie ihre Thais, eine bei Chant du Monde von 1959 neben ihrem prachtvollen Kollegen Massard und eine spätere nicht veröffentlichte neben ihrem Ehemann Julien Haas. Die Chant du Monde-Ausgabe ist zudem interessant wegen der angekoppelten Arien und Szenen aus ihrem Standard-Repertoire: Faust, Phyrne, Benvenuto Cellini (letzter komplett vom ORTF 1969 bei Gala mit Vanzo sowie live aus Marseille 1969), Pêcheurs de Perles, Louise, Manon (das Duo Saint-Sulpice mit Vanzo, die Gesamteinspielung nur für Sammler), Traviata, Carmen, Gianni Schicchi, Rigoletto meist live aus dem Rundfunk 1958 – 1972. Wie vieles andere nur für Sammler kursieren ein Roi d´Ys von Lalo vom ORTF 1967 neben der tollen Kollegin Berthe Monmart und ihrem Ehemann Julien Haas. Ihre Juliette (Gounod) ist zweimal dokumentiert. Einmal nur als Band-Mitschnitt 1967 vom Rundfunk (ehemals auch MRF) und als gekürzte Gesamtaufnahme in sehr gutem Stereo aus Nizza 1976 bei Gala mit – wieder einmal und beglückend – Alain Vanzo; sowie bei der INA sogar eine Schmannsche Genevieve (!!!) 1977 unter Tony Aubin. Auch eine Webersche Euryanthe unter le Conte von 1965 sowie Bondevilles Madame Bovary unter demselben von 1967. Und sicher gibt’s noch mehr (s. nachstehend)! Was für eine Stimme und was für eine unverwechselbare Künstlerin. Une voix francaise jaimais oubliée! Geerd Heinsen
.

Andrée Esposito als Manon in Avignon/youtube
PS. Der meist zuverlässige Ommer (Andreas Ommer, Verzeichnis aller Operngesamtaufnahmen, DBSO26) listet noch einige andere Aufnahmen der Esposito auf, wobei zwischen Opernhaus-Mitschnitten, Industrie- und Radio-Aufnahmen zu unterschieden ist. So gibt es zwischen 1964 und 1979 allein vier mal Benvenuto Cellini (unter verschiedenen Dirigenten, auch einen aus Genf mit Gedda, dto bei Sammlern, kein guter sound), Dallapiccolas Ulisse unter Prêtre ohne Datum und wie die übrigen leider auch ohne Quelle; Iberts Persée et Andromède von 1973 unter Bigot (Bourg?); ebenso Martinus Julietta unter Charles Bruck ohne Datum (Bourg?), eine Butterfly unter Rappalo von 1969 – alle wahrscheinlich doch vom Radio.
Dazu auch die Buchempfehlung/ David Grandis:The Voice of France (The Golden Age of the R. T. L. N.) mit einem Vorwort von Roger Pines, 261 Seiten, Abbildungen/Fotos, Index, Tabellen, MJW Fédition Paris ISBN979-10-90590-16-8). G. H.
.
Und zum Schluss die Sängerin selbst in einem Interview von 2001: Man muss – nicht nur zum Singen, aber vor allem da – unbedingt Persönlichkeit haben, man muss eine Siegernatur sein, man muss musikalisch und intelligent sein und man muss vor allem ein bedingungsloser Arbeiter sein, unermüdlich und immer an sich arbeiten, wirklich. Wenn diese Eigenschaften fehlen, dann können Sie die schönste Stimme der Welt haben, und Sie sind nichts. Man muss zudem immer neugierig sein, immer suchen. Wenn man etwas erreicht hat, darf man nie glauben, schon am Ziel zu sein – nichts ist sicher! Und man muss stets zum Besseren wollen, sonst fällt man zurück. Die Stimme selbst ist ein Wunder. Es gibt ja viele Leute, die sich physiologisch usw. damit beschäftigen, die genau sagen können, welcher Muskel wann arbeitet – aber dann fehlt der Funke. Man öffnet den Mund, man bringt einen schönen Ton heraus – eine Gottesgabe, keine analytische Angelegenheit.

Andrée Esposito als Leila/“Pecheurs de Perles“/Heinsen/Esposito
Eine Sängerin, eine Künstlerin, muss demütig sein. Verzeihen Sie das Bild, aber man kommt zum Gesang wie zum Kloster, man steht im Dienst des Publikums wie im Priesteramt. Man darf nie eingebildet sein, denn man selber ist ja gar nichts: Die Kunst, die Stimme ist alles. Und sehen Sie: Der Erfolg, der Ruhm ist schnell vorbei. Wenn man auf dem Höhepunkt steht und man überall bekannt ist, ist man eigentlich schon wieder passé. Man erreicht den Gipfel, und alles beginnt zu kippen.
lch habe eigentlich immer gesungen, bereits als Kind. Auf Hochzeiten, bei Kommunionsfeiern hieß es immer: ,,Los, sing etwas!“ Meinen Unterricht begann ich sehr jung schon mit 14 Jahren; Vater wollte nicht, dass ich sang – seine anständige Tochter eine skandalumwitterte Künstlerin! Unvorstellbar! Sowas tat man früher einfach nicht. Aber ich war besessen. lch mogelte mit meinem Alter, um in Algier ins Konservatorium aufgenommen zu werden. Mit 18 gewann ich den 1. Preis, den Großen Preis von Algier, in einem Alter, in dem man normalerweise erst mit der Ausbildung beginnt. Der Wettbewerbspräsident war gleichzeitig der Direktor des Pariser Konservatoriums und half mir, dorthin zu kommen. lch hatte dann das Glück, auf Charles Panzéra zu treffen – ein großer Interpret und Musiker und ein wunderbarer Mensch, der alle Geheimnisse des Belcanto kannte und sie mir vermittelte , so wie ich sie und mehr darüber hinaus meinen Schülern vermittele .
Es gab auch Dirigenten, die für mich entscheidend waren, jeder hatte seine Quälitäten. Heute ist das anders, man lässt die vielen Talente, die Frankreich besitzt, sich nicht entfalten, man lässt ihnen nicht genug Raum zum Wachsen. In Sachen Kultur verarmt Frankreich. Wir spielen immer seltener und weniger von unserem reichen Repertoire, und wenn, dann mit Leuten, die die Feinheiten unserer Sprache nicht verstehen. Wir sind eine hochgebildete Kultur-Nation, und es ist sicher richtig, dass die Ausländer zum Singen kommen – ein Austausch ist immer gut. Aber unsere eigene Kultur wird immer geringer zugunsten einer aus tauschbaren, anonymen. Wenn wir nicht den Kopf erheben, sind wir kulturell in Kürze ausgestorben. Wenn wir nur noch auswärtige Gäste spielen lassen, werden wir bald keine musikalische Kultur in Frankreich mehr haben.
Künstler und Sängerin zu sein ist etwas Wunderbares. Es erlaubt, tausend Frauenleben zu gestalten – Violetta, Juliette, Marguerite , Louise. Die Bovary war ,,meine“ Bovary, eine zerrissene, vielschichtige Frau. Aber ich kann nicht sagen, dass ich eine Lieblingsrolle hatte – meine schwärmerische Charakter-Seite erklärt das Vergnügen, alle diese Frauen in einer (meiner!) Person zu sein. Es gab natürlich Partien, die mir mehr lagen als andere, schwierige Rollen, die man sich erobern musste und darum besonders liebte. lch hatte immer eine Schwäche für den Pagen Oscar bei Verdi gehabt, und ich überredete die Direktion des Palais Garnier dazu, ihn mir zu geben, als ich bereits die anderen großen Partien sang, nur so aus Vergnügen an diesem Charakter – einmal dieser freche, komplizierte Bengel auf der Bühne zu sein. Was für ein Spaß.

Andrée Espodito, privat/Heinsen/Esposito
lch liebte diesen Beruf und lebte für ihn. Man darf nicht außerhalb seines eigenen Faches singen, deshalb lehnte ich zum Beispiel die Desdemona ab, was ich heute bedaure, aber ich hatte nicht genügend Stimme dafür gehabt, einfach nicht die richtige Stimme. Manon aber war meine Partie, und ich habe sie oft gesungen, 30 Jahre lang, immer unterwegs damit. lch hatte dann nicht mehr dieses Kristall-Timbre meines Anfangs, sondern mein mir eigenes, was bewirkte, dass man mich mochte oder nicht. Daran schieden sich oft die Geister, an diesem typisch Französischen in meiner Stimme.
Aber am Ende – oder sicher noch davor – war ich mit diesen Halbnuancen meiner Stimmqualität nicht mehr zufrieden. lch wollte nach so vielen Jahren des Erfolges nicht hören: ,,Sie ist noch gut!“ Dieses ,,noch“ hatte mir wehgetan. lch sagte mir: Die jungen Leute können von meiner Erfahrung profitieren – und so bin ich Lehrerin geworden. Eigentlich war diese Neuorientierung ganz logisch. Gelegentlich will ich noch singen, ganz spontan, aber dann sage ich mir: „Bouf“ („Ach, wozu?“). lch freue mich am Erfolg der Schüler. Und ganz ehrlich, wenn ich noch singen müsste – was für ein Stress! lch möchte immer noch ständig in Form sein müssen, immer mein Leben nach meinem Beruf richten. Nein, nein, ich habe wirklich Lust, meine Koffer auf dem Speicher zu lassen. Ich brauche jetzt nicht mehr die vielen Cremes aufzutragen, um meine Haut zu schonen. Ich war lange und glücklich (mit Julien Haas) verheiratet. Jetzt will ich leben – dank meiner Schüler bleibe ich dem Theater und dem Leben verbunden, und ich gebe das weiter, was ich selber praktiziert habe. Das Wichtigste ist die Diktion, die deutliche Diktion! Der Zuhörer muss verstehen, das ist das mindeste. Zusammengestellt von Jean-Marc Schumann (2001/ Übersetzung Klaus Heinrich; Redaktion G. H.)










 PS.:
PS.:
 IMDB fährt fort: „Um die abenteuerlichen Aspekte der Handlung zu betonen, anstatt sie als Hintergrund zu belassen, wurden wichtige Änderungen an der Partitur vorgenommen, wobei Buckner und Florey diejenigen Aspekte eliminierten, die nicht zur Entwicklung der Handlung beitrugen. Die Musik unterstreicht die Handlung, zum Beispiel wenn ein einsamer Reiter die Rebellen zum ersten Angriff auf die französische Eisenbahnlinie aufruft, um die Gefangenen von Riff zu befreien. Die Ereignisse entwickeln sich während der musikalischen Nummern: Wüstenaufnahmen zeigen die subjektive Fantasie der Heldin, während die moralischen Instinkte eines französischen Beamten während eines patriotischen Tanzes zum Vorschein kommen. Buckner und Florey verwandelten die weibliche Hauptrolle in eine professionelle Sängerin anstelle des verliebten Mädchens aus der Operette. Der Humor wurde überarbeitet, indem ein amerikanischer Reporter hinzugefügt wurde, dessen „Scoops“ ständig von einem verweichlichten französischen Regierungsbeamten zensiert werden – eine spitzbübische Anspielung auf das Hays-Büro, aber auch eine unbeabsichtigte Vorahnung des Schicksals des Films durch die Zensurbehörden. Trotz der Zusammenarbeit an dem neuen Drehbuch wurden die Drehbuchautoren im Abspann nicht erwähnt. Der Hauptdarsteller der neuen Version von The Desert Song war eigentlich schon einige Jahre zuvor ausgewählt worden, nach zwei Probeaufnahmen Anfang 1939. Die erste war unter seinem richtigen Namen Stanley Morner, die zweite unter seinem neuen Namen Dennis Morgan. Es wurden keine anderen Schauspieler für die Hauptrolle getestet, und Dennis Morgan sollte Warners führender Star der 1940er Jahre werden.“
IMDB fährt fort: „Um die abenteuerlichen Aspekte der Handlung zu betonen, anstatt sie als Hintergrund zu belassen, wurden wichtige Änderungen an der Partitur vorgenommen, wobei Buckner und Florey diejenigen Aspekte eliminierten, die nicht zur Entwicklung der Handlung beitrugen. Die Musik unterstreicht die Handlung, zum Beispiel wenn ein einsamer Reiter die Rebellen zum ersten Angriff auf die französische Eisenbahnlinie aufruft, um die Gefangenen von Riff zu befreien. Die Ereignisse entwickeln sich während der musikalischen Nummern: Wüstenaufnahmen zeigen die subjektive Fantasie der Heldin, während die moralischen Instinkte eines französischen Beamten während eines patriotischen Tanzes zum Vorschein kommen. Buckner und Florey verwandelten die weibliche Hauptrolle in eine professionelle Sängerin anstelle des verliebten Mädchens aus der Operette. Der Humor wurde überarbeitet, indem ein amerikanischer Reporter hinzugefügt wurde, dessen „Scoops“ ständig von einem verweichlichten französischen Regierungsbeamten zensiert werden – eine spitzbübische Anspielung auf das Hays-Büro, aber auch eine unbeabsichtigte Vorahnung des Schicksals des Films durch die Zensurbehörden. Trotz der Zusammenarbeit an dem neuen Drehbuch wurden die Drehbuchautoren im Abspann nicht erwähnt. Der Hauptdarsteller der neuen Version von The Desert Song war eigentlich schon einige Jahre zuvor ausgewählt worden, nach zwei Probeaufnahmen Anfang 1939. Die erste war unter seinem richtigen Namen Stanley Morner, die zweite unter seinem neuen Namen Dennis Morgan. Es wurden keine anderen Schauspieler für die Hauptrolle getestet, und Dennis Morgan sollte Warners führender Star der 1940er Jahre werden.“









 Ein paar Jahre jünger als von Tilzer ist der 1887 in New York geborene
Ein paar Jahre jünger als von Tilzer ist der 1887 in New York geborene  Auf zwei CDs gibt es
Auf zwei CDs gibt es 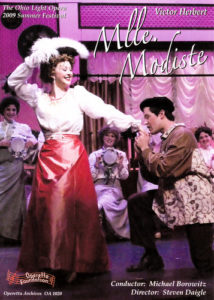 Der 1887 im westungarischen Nagykanizsa geborene Romberg, eigentlich Rosenberg, war, nachdem er u.a. in Wien bei Heuberger studiert hatte, 1909 nach Amerika ausgewandert, wo er in New York zuerst Erfolge als Caféhaus-Pianist hatte, 1914 als Hauskomponist der Shubert Brothers in die Fußstapfen von Hirsch trat und spätestens ab den 1920er Jahren mit rund 60 Bühnenwerken eine feste Größe am Broadway und in den 30er Jahren vorübergehend als Filmkomponist in Hollywood wurde. Rombergs europäisches Erbe erfüllte nicht nur bei seiner Alt-Heidelberg- Adaption The Student Prince oder der Operette über Franz Schubert The Blossom Time die amerikanische Sehnsucht nach der Alten Welt. In seinem 50. Musical
Der 1887 im westungarischen Nagykanizsa geborene Romberg, eigentlich Rosenberg, war, nachdem er u.a. in Wien bei Heuberger studiert hatte, 1909 nach Amerika ausgewandert, wo er in New York zuerst Erfolge als Caféhaus-Pianist hatte, 1914 als Hauskomponist der Shubert Brothers in die Fußstapfen von Hirsch trat und spätestens ab den 1920er Jahren mit rund 60 Bühnenwerken eine feste Größe am Broadway und in den 30er Jahren vorübergehend als Filmkomponist in Hollywood wurde. Rombergs europäisches Erbe erfüllte nicht nur bei seiner Alt-Heidelberg- Adaption The Student Prince oder der Operette über Franz Schubert The Blossom Time die amerikanische Sehnsucht nach der Alten Welt. In seinem 50. Musical 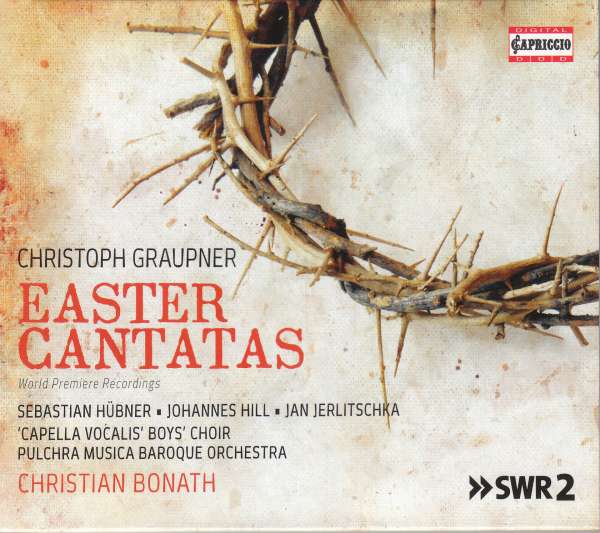


 In dieser ersten Fassung gelangte die Oper am 28. November 1809 zur Uraufführung. Die insgesamt ausgewogene Perspektive dieser Fassung, die die Glorifizierung der Eroberung und den teilnehmenden Blick auf die Situation der Eroberten gleichermaßen beinhaltet, hatte zur Folge, dass die gewünschte Propagandawirkung verfehlt wurde. Gleichwohl sorgte die prominent besetzte, durch spektakuläre Bühneneffekte angereicherte Produktion für gewisses Aufsehen und zog weitere Produktionen an europäischen Bühnen nach sich. Die von Spontini sorgfältig betreute, der Kaiserin gewidmete Drucklegung der Partitur erfolgte bei Imbault vermutlich knapp zwei Jahre nach der Uraufführung. Dass Fernand Cortez bereits in dieser ersten Fassung einen Ausnahmecharakter innerhalb der Opernproduktion der Zeit einnahm, bestätigte erst 2019 die erste moderne Wiederaufführung dieser Fassung in Florenz.
In dieser ersten Fassung gelangte die Oper am 28. November 1809 zur Uraufführung. Die insgesamt ausgewogene Perspektive dieser Fassung, die die Glorifizierung der Eroberung und den teilnehmenden Blick auf die Situation der Eroberten gleichermaßen beinhaltet, hatte zur Folge, dass die gewünschte Propagandawirkung verfehlt wurde. Gleichwohl sorgte die prominent besetzte, durch spektakuläre Bühneneffekte angereicherte Produktion für gewisses Aufsehen und zog weitere Produktionen an europäischen Bühnen nach sich. Die von Spontini sorgfältig betreute, der Kaiserin gewidmete Drucklegung der Partitur erfolgte bei Imbault vermutlich knapp zwei Jahre nach der Uraufführung. Dass Fernand Cortez bereits in dieser ersten Fassung einen Ausnahmecharakter innerhalb der Opernproduktion der Zeit einnahm, bestätigte erst 2019 die erste moderne Wiederaufführung dieser Fassung in Florenz.