Der Unterschied zwischen einer Studioeinspielung und dem Live-Erlebnis ist seit jeher eine der Gretchenfragen innerhalb der klassischen Musik. Gab es zu Beginn der Schallplattenaufzeichnung schon aufgrund der technischen Unwägbarkeiten praktisch nur Studioaufnahmen, so haben die Konzertmitschnitte in den letzten Jahrzehnten doch rasant aufgeholt und können aufgrund der von den Plattenlabels an den Tag gelegten Professionalität mitunter als „Quasi-Studio“ gelten, wird heutzutage doch nicht selten an zwei oder drei Tagen mitgeschnitten und das Bestmögliche aus dem Tonmaterial herausgeholt, bestenfalls gleichsam die Vorteile beider Welten vereint.
Erst Ende März erschien die hier bereits besprochene Gesamteinspielung aller sieben Sinfonien des finnischen Komponisten Jean Sibelius unter dessen gerade 26-jährigen Landsmann Klaus Mäkelä mit dem Oslo Philharmonic Orchestra bei Decca. Dass sich der ORF nun offenbar nicht für Rundfunkübertragungen des Live-Zyklus aus dem Wiener Konzerthaus (21., 22. und 23. Mai 2022) entschieden hat, dürfte auch diesem Hintergrund geschuldet sein. Aufgrund des Ergebnisses – und soviel darf hier bereits vorweggenommen werden – ist dies aus künstlerischer Sicht allerdings ein Versäumnis. Es darf insofern leise darauf gehofft werden, dass bei der anstehenden Wiederholung des Zyklus in der Hamburger Elbphilharmonie Toningenieure anwesend sein werden. Konnte die Studioeinspielung als „wirklich beachtlich“ gelten, so beseitigt das Live-Hörerlebnis letzte Zweifel, dass das Phänomen Mäkelä weit mehr ist als geschicktes Marketing.

Klaus Mäkelä, der finnische Nachwuchsstar unter den Dirigenten, eroberte Wien im Sturm. Foto im Ausschnitt: © Lukas Beck
Klaus Mäkeläs Debüt in Wien hätte eigentlich schon vorigen Dezember mit den Wiener Symphonikern erfolgen sollen, musste aber pandemiebedingt abgesagt werden. Insofern debütierte der Finne hier erst ein halbes Jahr später, dafür umso großangelegter, reiste er doch mit „seinem“ Osloer Klangkörper für besagte drei Konzertabende in die einstige Kaiserstadt. Dass die renommierten Orchester der Welt mittlerweile wieder in aller Herren Länder gastieren, gibt beredtes Zeugnis davon ab, dass auch im Klassikbetrieb (glücklicherweise) allmählich wieder Normalität einkehrt. Wie so häufig, war es auch diesmal das Wiener Konzerthaus, welches die Zeichen der Zeit erkannt und sofort zugegriffen hat. Sibelius hat in Wien nach wie vor einen eher schweren Stand, trotz der bereits zwischen 1963 und 1968 im Studio eingespielten Gesamtaufnahme der Wiener Philharmoniker unter Lorin Maazel (Decca). Dies wird schon dadurch ersichtlich, dass eine seiner Sinfonien, nämlich die Dritte, tatsächlich erst im Jahre 2002 ihre Wiener Erstaufführung erfuhr. Und selbst die Zweite, die populärste unter den sieben, erklang erst 1970 im Wiener Konzerthaus (wenngleich Felix Weingartner sie schon 1910 mit den Wiener Philharmonikern im Musikverein zur Aufführung brachte). Den ersten Versuch eines kompletten Live-Zyklus in Wien unternahm niemand Geringerer als Leonard Bernstein mit den Philharmonikern. 1986 begonnen, setzte sein Tod vier Jahre später dem Unterfangen leider ein vorzeitiges Ende (es fehlen die Sinfonien Nr. 3, 4 und 6). Der unsägliche Verriss Theodor W. Adornos, der Sibelius eine NS-artige „Blut und Boden“-Ideologie unterstellte, wirkte offenbar lange nach. Schon deswegen ist dieses verspätete Konzertereignis ausdrücklich zu begrüßen und dem Konzerthaus insofern ein herzliches „Vergelt’s Gott“ auszusprechen, denn idiomatischer als in der nordischen Kombination Mäkelä/Oslo kann man den finnischen Sinfoniker heutzutage nirgendwo erleben.
Den Anfang machte – wie könnte es anders sein – der sinfonische Erstling, 1899 vollendet und übrigens bereits 1921 im Konzerthaus unter Tor Mann in Wien erstaufgeführt. Die Vorbildwirkung Tschaikowskis, insbesondere seiner letzten Sinfonie, der Pathétique von 1893, wurde auch von Sibelius keineswegs geleugnet. Dies führt einmal mehr die politische Situation um 1900 vor Augen, als Finnland als Großfürstentum Teil des Zarenreiches war und Sankt Petersburg als musikalisches Zentrum stark ausstrahlte. Das finnische Streben nach Unabhängigkeit kann zudem als Motor für so manches Musikwerk dieser Zeit angesehen werden. War die erste Sinfonie bereits ein Höhepunkt in der Studioaufnahme, so überbot Mäkelä dies im Live-Konzert sogar noch. Die Tempi marginal straffer angelegt als im Studio, wurde bereits hier die Überlegenheit der Osloer Philharmoniker in diesem Repertoire offensichtlich, kongenial ihren Ausnahmerang in der nordischen Sinfonik demonstrierend. Überhaupt ist das Zusammenspiel zwischen Dirigent und Orchester sichtbar von größtem gegenseitigen Vertrauen und Respekt geprägt. Die klangliche Balance wurde meisterhaft gewahrt, jede Orchestergruppe gebührend repräsentiert. Ein besonderes Augenmerk hat Mäkelä in der Tat auf die Streicher gelegt – von einem Teil der Kritiker der Studioproduktion einseitig mokiert –, die man selten derart üppig, beinahe „karajanesk“ vernahm, freilich ohne die Holzbläser zu vernachlässigen. Das Blech und das Schlagwerk verschaffen sich schon naturgemäß Gehör. Man muss lange zurückgehen, um eine ähnlich überzeugende Darbietung der Sinfonie Nr. 1 in e-Moll zu finden; tatsächlich kann Mäkelä gar an Bernsteins Referenzaufnahme von 1990 (DG) anschließen.

Der Komponist Jean Sibelius hat in Wien nach wie vor einen schweren Stand./Wikipedia
Die zweite Hälfte des ersten Konzerttages war sodann den Sinfonien Nr. 6 und Nr. 7 gewidmet, was eine spannende Gegenüberstellung zwischen dem frühen und dem reifen Sinfoniker Sibelius ermöglichte. Besonders die Sechste von 1923, keiner eigentlichen Tonart zugeordnet, sondern im dorischen Modus stehend, ist die „Cinderella“ und erklang auch im Wiener Konzerthaus bis dato nur zweimal überhaupt. Als die am wenigsten pathetische, insofern auf den ersten Blick unscheinbarste der sieben Sinfonien leitet sie den Altersstil des Komponisten ein, den dieser mit der in enger Verbindung stehenden Siebenten (1924) zur Vollendung brachte. Hier auf einzelne Sätze komplett verzichtend, kehrte auch das Pathos wieder, wenngleich in abgeklärter und gänzlich anderer Weise als ein Vierteljahrhundert zuvor. Erschienen sowohl die Sechste als auch die Siebte innerhalb des Mäkelä’schen Studiozyklus vergleichsweise nüchtern, so lieferte der Dirigent live gerade bei ersterer ein flammendes Plädoyer der Extraklasse ab und konnte wohl so manchen Sibelianer, der die Sinfonie Nr. 6 bislang unter ferner abhakte, zur neuerlichen Überprüfung der eigenen Vorurteile anregen. Mit ihrer Nachfolgerin, quasi der Summe des sinfonischen Schaffens des Komponisten, wurde das Konzert regelrecht bekrönt. Als Zugabe verkündete der Dirigent sodann dem merklich in ekstatischer Verzückung stehenden Publikum noch in tadellosem Deutsch den beliebten Valse triste. Bescheiden hielt er unter stehenden Ovationen der geneigten Zuhörerschaft zuletzt die Sibelius-Partitur in die Höhe.
Konzertabend zwei begann mit der vierten Sinfonie von 1911, dem ob seiner düsteren Kargheit vielleicht am schwierigsten zugänglichen Werk des Finnen. Tatsächlich zeigt sich Sibelius hier als der Moderne durchaus nicht grundsätzlich verschlossener Tondichter und sprach selbst von seinem „am stärksten vergeistigten Werk“. Nie sollten sich Sibelius und Mahler, fast gleichaltrig aber grundverschieden, kompositorisch näherkommen (sie trafen sich tatsächlich einige Jahre zuvor). Die Sinfonie Nr. 4 war mit einigem Recht das absolute Highlight der Decca-Einspielung, weswegen die Messlatte besonders hoch angelegt war. Kurzum, die Osloer enttäuschten mitnichten, im Gegenteil. Zwar gab es – wohl werkbedingt – nicht die ganz große Emphase nach Verklingen des letzten Taktes, doch kann Mäkeläs Lesart in der Tat als mustergültig und moderne Referenz angesehen werden, brachte er doch das Kunststück zustande, auch bei der Vierten keinen Durchhänger aufkommen zu lassen.
Größer hätte der Kontrast freilich kaum sein können, schloss sich im zweiten Teil des Konzerts doch die beliebte Sinfonie Nr. 2, in D-Dur stehend, an (1902). Mit ihr konnte Sibelius seinen größten Erfolg überhaupt feiern und schuf seiner Nation gleichsam die ihr gebührende Nationalsinfonie. Inwieweit das Werk als antirussisch zu deuten ist, erlangt gerade dieser Tage wieder ungeahnte Brisanz. Insofern konnte man die Interpretation Mäkeläs auch als politisches Statement begreifen. Geradezu überirdisch der Klangteppich, den das Osloer Philharmonische Orchester hier entfaltete. Die Seriosität Mäkeläs musste angesichts seiner in jedem Moment hundertprozentigen Orchesterbeherrschung als über jeden Zweifel erhaben gelten. Der hymnische Ausklang wurde selbstredend zum Höhepunkt, und die strahlenden und formidabel aufspielenden Blechbläser schienen das zunächst finstere Dräuen der Pauken allmählich in einen finnischen Triumph umzudeuten. Diese patriotische Note unterstreichend, setzte eine ungemein zupackende Darbietung von Finlandia, mit den Worten Mäkeläs zutreffend als „das Einzige, was man nach der zweiten Sinfonie noch spielen kann“ bezeichnet, dem fulminanten Konzerterlebnis noch das Tüpfelchen auf das „i“. Die Orchestermusiker, ebenfalls sichtlich gerührt von der begnadeten Führung ihres Chefdirigenten, feierten Mäkelä stürmisch und standen wohl kurz davor, ihn mit einem sehr rar gesäten Tusch zu ehren.
Am letzten Abend des Sibelius-Marathons erklang vor der Pause zunächst die dritte Sinfonie in C-Dur, deren sonnige Heiterkeit im sinfonischen Septett des mitunter schwermütigen Finnen einzigartig dasteht. 1907 entstanden und somit kurz vor der lebensbedrohlichen Krise des Komponisten stehend – eine am Ende glücklich überwundene Krebserkrankung –, wurde sie gerade auch wegen ihrer vermeintlichen Schlichtheit eher zurückhaltend aufgenommen und teils gar als Rückschritt gegenüber der monumentalen Zweiten angesehen. Dabei enthält die Dritte den ohrwurmartigsten langsamen Satz von allen, den Mäkelä auch gebührend auszukosten wusste. Seine Interpretation betonte dann auch die Nachfolge der zweiten Sinfonie und kostete den durchaus enthaltenen heroischen Gestus besonders im Finalsatz aus, in dessen Coda die Überlagerung der verschiedenen Themen mit berückender Durchhörbarkeit gelang, wobei der Orchesterleiter es abermals verstand, die an dieser Stelle nicht selten überdeckten Streichergruppen mit besonderem Augenmerk zu bedenken.

An drei Abenden hintereinander führte Klaus Mäkelä im Wiener Konzerthaus mit dem Oslo Philharmonic Orchestra alle sieben Sinfonien von Jean Sibelius auf. Foto: © Lukas Beck
Mit der auch landläufig durchaus bekannten Fünften endete das offizielle Konzertprogramm. Tatsächlich hat Sibelius seine fünfte Sinfonie in Es-Dur sogar zweimal revidiert, wobei sich die ausgefeilte, von einiger Schroffheit befreite Letztfassung von 1919 im Standardrepertoire etablierte und auch diesmal erklang. Wenn noch eine Steigerung möglich war, dann hier. Im durchaus mächtigen Kopfsatz spielten die Osloer hörbar auf der Stuhlkante und legten eine derart brillante Coda hin, dass man im Saale kurz davor war, bereits an dieser Stelle spontane Ovationen zu vernehmen. Der darauffolgende langsame Satz wurde zur Überleitung zum Finale mit dem berühmten Schwanenmotiv. Die Streicher hatten dort einen ihren glänzendsten Momente. Und der oftmals viel zu verhaltene Paukenauftakt direkt vor der hymnenartigen Melodie gelang spektakulär. Zurecht wurde gerade der Paukist, der auch die schwierigen Schlusstakte weltmeisterlich hinlegte, danach auch mit besonders euphorischem Applaus bedacht. Spätestens als während des Beifalls der in der Sinfonie nicht gebrauchte Tubist hinzutrat, wusste man, dass es (natürlich) auch diesmal eine bereits erhoffte Zugabe geben würde. Mit Lemminkäinens Heimkehr trafen Mäkelä und die Osloer Philharmoniker auch am dritten Abend eine sehr geschickte Wahl, konnte mit diesem „Gassenhauer“ doch in der Tat noch eine weitere Klimax beigesteuert werden. Der Große Konzerthaussaal bedankte sich mit tosenden, nicht enden wollenden Bravorufen und neuerlichen Standing Ovations.
Zum Dirigat Klaus Mäkeläs sei ganz allgemein hinzugefügt, dass für ihn die Interaktion mit dem Orchester, das er zurecht als erlesene Ansammlung begnadeter Individuen begreift, zuvörderst steht. Dies geschieht nicht nur durch filigrane, bisweilen energische, niemals aber hohle Gestik, sondern auch durch eindrückliche Mimik. Niemand im Orchester muss befürchten, dass ihm der Dirigent zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. In den lyrischen Momenten legt er den Taktstock auch einmal bewusst beiseite und erzielt so eine beeindruckende Zartheit. Wie er hie und da gerade auch die linke Hand einsetzt, erinnert tatsächlich an Herbert von Karajan. Um der Präzision willen kommt der Baton freilich andernorts umso nachdrücklicher zum Einsatz. An einigen wenigen Stellen lenkt der Dirigent die Musiker allein mittels Augenkontakt und verschmilzt somit gleichsam idealtypisch mit seinem Klangkörper. Der Respekt vor der Partitur wird schon dadurch deutlich, dass Mäkelä nicht auf sie verzichtet, auch wenn man davon ausgehen kann, dass er die Sibelius-Notenschriften verinnerlicht hat.
Summa summarum darf festgehalten werden, dass das Osloer Philharmonische Orchester und sein junger Chefdirigent Klaus Mäkelä im Wiener Konzerthaus einen sensationellen Erfolg erzielten und Wien gleichsam im Sturm nahmen. Selbst gestandene Sibelianer, die alle möglichen Interpretationen der „großen Alten“ kennen, werden schwerlich umhin kommen, in Mäkelä und seinem kongenialen Klangkörper die heutige Referenz in Sachen Sibelius zu erblicken, die hinsichtlich Ausführung und Idiomatik nunmehr als Maß aller Dinge gelten darf. Die Wiener haben heuer übrigens noch zweifach Gelegenheit, Mäkelä im Konzerthaus zu erleben: Im November – wiederum mit „seinen“ Osloern – mit Tschaikowskis Pathétique und Schostakowitschs erstem Cellokonzert (Solistin: Sol Gabetta) sowie zum Jahreswechsel 2022/23 mit der traditionellen Neunten von Beethoven bei seinem verspäteten Debüt bei den Wiener Symphonikern. Und die in der Gesamtaufnahme enthaltene Tondichtung Tapiola, die im Konzerthaus fehlte, wird Mäkelä mit den Osloern bei seinem Einstand bei den diesjährigen BBC Proms im August darbieten. Daniel Hauser
.
Klaus Mäkelä, der finnische Nachwuchsstar unter den Dirigenten, lädt geradezu ein zu Superlativen. Mit erst sechsundzwanzig Jahren steht er bereits zweien der weltweit renommiertesten Klangkörper, nämlich dem Osloer Philharmonischen Orchester und dem Orchestre de Paris, als künstlerischer Leiter vor. Eine hohe Erwartungshaltung kann Fluch und Segen zugleich sein. Der 2021 abgeschlossene exklusive Kontrakt mit dem legendären Label Decca hat dies gewiss nicht unwesentlich befeuert, bedenkt man, dass Mäkelä nach Georg Solti 1947 und Riccardo Chailly 1978 tatsächlich erst der dritte Dirigent ist, dem diese Ehre zuteil wird. Ob ein Exklusivvertrag heutzutage nicht schon ein wenig aus der Zeit gefallen ist, darüber ließe sich trefflich debattieren. Es kommt darauf an, was die Plattengesellschaft und der Künstler daraus machen. Es ist nicht so, dass Mäkelä keine Vorläufer gehabt hätte, auf die sich viele Hoffnung konzentrierten. Man nehme beispielsweise seinen Landsmann Mikko Franck, der um die Jahrtausendwende herum mit von der Fachwelt gleichsam einhellig gepriesenen Einspielungen für Furore sorgte und als der kommende ganz große Star aus dem hohen Norden galt. Ein Quasi-Exklusivkontrakt mit dem in Helsinki ansässigen Label Ondine lief nach ein paar Jahren indes sang- und klanglos aus. Mittlerweile amtiert Franck, längst aus dem Rampenlicht in die vielleicht selbst gewählte sogenannte zweite Reihe verschwunden, als Leiter des Orchestre Philharmonique de Radio France – Ironie des Schicksals – neben Mäkelä, aber ohne all den Starrummel, ebenfalls in Paris.
 Äußerlichkeiten sollten neben der künstlerischen Leistung keine Rolle spielen, doch ist es ein offenes Geheimnis, dass sie es zumindest unbewusst häufig doch tun. Das adrette Auftreten Mäkeläs, häufig in feinen Zwirn gewandet und hinsichtlich seiner sartorialen Präferenzen erstaunlich konservativ (wann sah man zuletzt einen Dirigenten Mitte zwanzig im – noch dazu gut sitzenden – Zweireiher?), ist gewiss sein Nachteil nicht. Anders als zu Beginn seiner Karriere sah man ihn zuletzt meist ohne Brille, als wollte er die Sehhilfe negieren. Ob dies auch von Decca angeregt wurde, sei dahingestellt. Zumindest ist die photographische Inszenierung Mäkeläs ungemein professionell und erinnert in gewisse Weise gar an jene Herbert von Karajans durch die Deutsche Grammophon Gesellschaft. Jugendlich, hellhäutig, blond und blauäugig – diese Attribute werden in der Präsentation der Decca stark betont, die nun die erste heiß erwartete Veröffentlichung mit ihrem neuen Exklusivkünstler und Hoffnungsträger vorlegt. Dass die Wahl auf den finnischen Nationalkomponisten Jean Sibelius fiel, ist derart folgerichtig, dass man den nun vorgelegten Zyklus der sieben Sinfonien als zwangsläufig bezeichnen kann (Decca 28948522569). Einerseits geht Decca damit auf Nummer sicher, passt die nordische Dreifachkombination ja hinsichtlich ihrer Idiomatik wie angegossen. Andererseits aber entfällt auch jedwede Schonfrist, liefert Mäkelä sozusagen vom ersten Moment an der übermächtigen Konkurrenz aus. Es ist womöglich sogar beispiellos, dass die erste diskographische Hinterlassenschaft eines jungen Dirigenten bereits dergestalt ambitioniert daherkommt. Blickt man abermals zurück, so war Soltis erste Decca-Einspielung als Dirigent die Tanz-Suite von Béla Bartók, bei Chailly handelte es sich um eine Platte mit sieben Rossini-Ouvertüren. Kleine Brötchen im Vergleich.
Äußerlichkeiten sollten neben der künstlerischen Leistung keine Rolle spielen, doch ist es ein offenes Geheimnis, dass sie es zumindest unbewusst häufig doch tun. Das adrette Auftreten Mäkeläs, häufig in feinen Zwirn gewandet und hinsichtlich seiner sartorialen Präferenzen erstaunlich konservativ (wann sah man zuletzt einen Dirigenten Mitte zwanzig im – noch dazu gut sitzenden – Zweireiher?), ist gewiss sein Nachteil nicht. Anders als zu Beginn seiner Karriere sah man ihn zuletzt meist ohne Brille, als wollte er die Sehhilfe negieren. Ob dies auch von Decca angeregt wurde, sei dahingestellt. Zumindest ist die photographische Inszenierung Mäkeläs ungemein professionell und erinnert in gewisse Weise gar an jene Herbert von Karajans durch die Deutsche Grammophon Gesellschaft. Jugendlich, hellhäutig, blond und blauäugig – diese Attribute werden in der Präsentation der Decca stark betont, die nun die erste heiß erwartete Veröffentlichung mit ihrem neuen Exklusivkünstler und Hoffnungsträger vorlegt. Dass die Wahl auf den finnischen Nationalkomponisten Jean Sibelius fiel, ist derart folgerichtig, dass man den nun vorgelegten Zyklus der sieben Sinfonien als zwangsläufig bezeichnen kann (Decca 28948522569). Einerseits geht Decca damit auf Nummer sicher, passt die nordische Dreifachkombination ja hinsichtlich ihrer Idiomatik wie angegossen. Andererseits aber entfällt auch jedwede Schonfrist, liefert Mäkelä sozusagen vom ersten Moment an der übermächtigen Konkurrenz aus. Es ist womöglich sogar beispiellos, dass die erste diskographische Hinterlassenschaft eines jungen Dirigenten bereits dergestalt ambitioniert daherkommt. Blickt man abermals zurück, so war Soltis erste Decca-Einspielung als Dirigent die Tanz-Suite von Béla Bartók, bei Chailly handelte es sich um eine Platte mit sieben Rossini-Ouvertüren. Kleine Brötchen im Vergleich.
Es sei praktisch unmöglich, dass ein finnischer Musiker ohne den Einfluss von Sibelius aufwachse, so Klaus Mäkelä im kurzen Einleitungstext von Andrew Mellor. Zurecht wird darin auf die starke Sibelius-Tradition in Oslo (bis 1924 noch Christiania genannt) verwiesen. Mäkelä ist bereits der vierte aus Finnland stammende Osloer Chefdirigent, nach dem legendären Georg Schnéevoigt (1919-1921), Okko Kamu (1975-1979) und zuletzt Jukka-Pekka Saraste (2006-2013). Seit den fernen Tagen der unvergessenen Kirsten Flagstad haben die Osloer Philharmoniker jedenfalls nicht mehr mit der Decca zusammengearbeitet. Auch dies sei nun quasi Mäkeläs Verdienst. Dieser gibt sich ganz bescheiden und überaus kollegial, indem er auf die wichtigen Erfahrungen und lehrreichen Anstöße verweist, die er – noch als Cellist – unter den großen Repräsentanten der finnischen Sibelius-Tradition aufgesogen habe. Ganz ohne Frage ist die Messlatte allein unter den finnischen Dirigenten gewaltig hoch, legten neben den bereits genannten Kamu und Saraste doch auch Paavo Berglund, Osmo Vänskä und Leif Segerstam (jeweils sogar mehrfach) Zyklen der Sibelius-Sinfonien vor, die bis zum heutigen Tage als unverzichtbare Bausteine innerhalb der Diskographie gelten. Derzeit ist beim Label Alpha außerdem ein neuer Zyklus der Göteborger Sinfoniker unter Santtu-Matias Rouvali im Entstehen begriffen. Es müssen hier noch einzelne legendäre Aufnahmen finnischer Dirigenten, die außerhalb von Studiozyklen entstanden sind, extra hervorgehoben werden, denkt man etwa an die Ersteinspielungen unter Robert Kajanus oder einen im September 1939, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges also, in New York entstandenen, unglaublich expressiven Live-Mitschnitt der zweiten Sinfonie mit dem NBC Symphony Orchestra unter Schnéevoigt. Kurzum: Es mangelt mitnichten an Vergleichsmöglichkeiten.
Aber in medias res. Sibelius‘ sinfonischer Erstling von 1899 steht in e-Moll und zugleich in der Tschaikowski-Nachfolge. Dies sollte nicht weiter verwundern. Zum einen entstand die Symphonie Pathétique gerade sechs Jahre davor, zum anderen – und das darf nicht außer Acht gelassen werden – waren sowohl Tschaikowski als auch Sibelius seinerzeit Untertanen des Zaren, weswegen man Sibelius in Sankt Petersburg als „russländischen“ Komponisten durchaus für sich reklamieren konnte. Mäkelä schlägt bereits im Kopfsatz eine individuelle, mitunter expressive Lesart an, die indes vollauf überzeugt, wenn man sich darauf einlässt. Die genuine Qualität des Osloer Orchesters in diesem Repertoire überrascht nicht. Die erste Sinfonie gehörte auch schon zu denjenigen (neben Nr. 2, 3 und 5), die Mariss Jansons Anfang der 1990er Jahre für EMI einspielte. Rein von den Spielzeiten (40 Minuten insgesamt) bewegt sich Mäkelä völlig innerhalb der Norm. Zum ersten Höhepunkt gerät (fast schon naturgemäß) der 13-minütige Finalsatz, den der Komponist mit Quasi una fantasia bezeichnete und der auch eigenständig bestehen könnte. Mittels geschickter Agogik erzielt Mäkelä eine ähnliche Intensität wie weiland Leonard Bernstein mit den Wiener Philharmonikern – und das will wirklich etwas heißen. Auch klanglich weiß der Auftakt zu überzeugen und kann Decca, das in Sachen Tontechnik seit den frühen Tagen der Stereophonie stets einen Führungsanspruch stellte, den geweckten Erwartungen durchaus gerecht werden. So erscheint das 1977 eröffnete Konserthus in Oslo, in dem sämtliche hier versammelten Einspielungen entstanden sind und das akustisch als durchaus problematisch gilt – Jansons warf deswegen im Jahre 2000 gar als Chefdirigent hin –, gleichwohl als adäquates Aufnahmestudio.

Als finnischer Nationalvogel gilt wegen seiner Rolle in der finnischen Mythologie der Singschwan. Er darf nicht gejagt werden. Zählte man in den 1950er Jahren nur mehr 15 Brutpaare, so sind es heute wieder rund 1500. Sibelius setzte dem Vogel mit dem berühmten Schwanenruf am Ende seiner fünften Sinfonie ein musikalisches Denkmal. Foto/Wikipedia
Keine Sibelius-Symphonie ist populärer als die 1902 vollendete Zweite, keine wurde – mit Abstand – häufiger eingespielt. Entsprechend groß ist natürlich die Konkurrenz. Ein Mangel an bedeutenden Interpretationen besteht jedenfalls mitnichten, selbst wenn man allein das Stereo-Zeitalter gelten lässt. Vor allem können bei der Sinfonie Nr. 2 auch Dirigentennamen außerhalb der nordischen Hemisphäre nicht außer Acht gelassen werden, seien es Sir John Barbirolli und George Szell, Herbert von Karajan und Leonard Bernstein – um nur einige wenige zu nennen –, die alle auf ihre Art ungemein imponierende Lesarten hinterließen. Klaus Mäkeläs Deutung bewegt sich mit 46 Minuten tempomäßig auf der langsameren Seite, ohne einen Moment langatmig daherzukommen. Wundersam, dass sie zusammen mit der Ersten auf die erste Disc der Box passt, sage und schreibe 86 Minuten Musik beinhaltend. Ein untrügliches nordisches Idiom kommt in dieser neuesten Decca-Einspielung zum Tragen. Mätzchen sind Mäkeläs Sache nicht; alles ist in sich schlüssig und stringent. Tatsächlich schafft es der Finne nichtsdestotrotz, hie und da eine dezente persönliche Note einfließen zu lassen. Den Kopfsatz bringt er gewichtiger als andere und degradiert ihn nicht zur bloßen Quasi-Introduktion für den mächtigen langsamen zweiten Satz, der wie für ein musikalisches Abbild der rauen und unwirtlichen Landschaft hoch im Norden stehen könnte. Überhaupt ist Mäkeläs Sibelius urwüchsig und in der Natur verhaftet, teils introvertiert, jedenfalls fernab urbanen Trubels. Im Vivacissimo, dem rasanten Scherzo, kommt noch am ehesten der Eindruck der italienischen Reise durch, die der Tondichter während der Komposition absolvierte, um dann freilich abermals attacca und somit nahtlos in den Finalsatz übergehend in die heimischen nördlichen Gefilde einzumünden. Der bekrönende Abschluss will hart erkämpft sein. Mühelos lässt sich hier das Ringen der finnischen Nation um ihre Freiheit hineininterpretieren, gesteigert bis hin zur musikalischen Unabhängigkeitserklärung Finnlands an den Zaren. So verführerisch ein solches vermeintlich inkludiertes Programm auch anmutet, letztlich handelt es sich um absolute Musik. Bloßes Pathos nur um des Effekts willen wird man in dieser Aufnahme jedenfalls vergeblich suchen. Geschickt lässt der Dirigent in der Coda die Pauken ganz allmählich von dräuendem Grummeln in ein bezwingendes Grollen steigern und muss dabei noch nicht einmal die von Serge Kussewizki in Boston besorgten und von Sibelius höchstselbst abgesegneten Retuschen bemühen. Fulminant und doch nicht aufgesetzt klingt das viel gehörte Werk überzeugend aus.

Klaus Mäkelä dirigiert Sibelius/ Foto Decca Booklet
Der klassizistisch angehauchten dritten Sinfonie (1907) konnte manch bedeutender Sibelius-Dirigent wenig abgewinnen. Legendär ihr Fehlen im Repertoire Karajans (er spielte die übrigen sechs ein, teils mehrfach), der sie schlichtweg „nicht verstanden“ haben will. Ihr sonniges Gemüt drückt sich bereits in der C-Dur-Tonart aus. Nach den ersten beiden Kolossen haftet ihr eine für Sibelius untypische Leichtigkeit an. Tatsächlich scheint Klaus Mäkelä keine Schwierigkeiten damit zu haben, kommt seine Interpretation doch schlüssig daher. Bereits im Kopfsatz weiß er mit ungemeiner Detailgenauigkeit das Ohr auch fortgeschrittener Sibelianer zu erfreuen. Die dynamischen Ausdrucksmöglichkeiten der Osloer begeistern einmal mehr. Gerade der hier wirklich langsam gespielte zweite Satz zählt zu den melodisch eingängigsten des Komponisten. Im Finalsatz wird noch am ehesten das Pathos bedient. Mit triumphalem Gestus und voller Euphorie darf die Dritte ausklingen. Untypisch ist in diesem Zusammenhang die Behandlung der Streicher, die zuweilen sehr prominent in Erscheinung treten.
Wie Tag und Nacht unterscheidet sich die nachfolgende vierte Sinfonie von ihrer Vorgängerin. 1911 vollendet, entstand sie in einer für Sibelius persönlich sehr deprimierenden Phase seines Lebens, in der er mit einem bösartigen Halsgeschwür rang, das zwar operativ erfolgreich entfernt werden konnte, dessen etwaiges Wiederauftreten jedoch jahrelang wie ein Damoklesschwert dräute. Kein Wunder also, wenn es sich bei der gewählten Tonart um a-Moll handelt und die Stimmung, gerade im ersten Satz, düster und trostlos anmutet. Nie waren sich die Tonsprache von Sibelius und Gustav Mahler näher, die sich 1907 in Helsinki auch persönlich getroffen hatten. Es ist freilich eine nicht geringe Kunst, will ein Dirigent sowohl die Dritte als auch die Vierte in deren Janusköpfigkeit ähnlich überzeugend darbieten. Mäkelä darf sich zu denjenigen Orchesterleitern zählen, denen es gelingt. Gewiss nicht zu Unrecht beschreibt der Dirigent die Vierte im Booklet als die „persönlichste“ unter den Sinfonien seines Landsmanns und sieht gewisse Parallelen zum berühmten Gedicht The Raven von Edgar Allan Poe. Bereits die ersten Takte lassen in der Neueinspielung wahrlich aufhorchen. Derart packend vom ersten Moment an hört man dieses Werk nicht alle Tage. Die bassbetonte Decca-Aufnahmetechnik kommt gerade hier sehr entgegen. Zweifellos einer der Höhepunkte des Zyklus und mit dem vielfach bemühten Attribut referenzträchtig gut beschrieben.

Der englische Komponist und Dirigent Anthony Collins nahm bereits zwischen 1952 und 1955 für Decca alle Sibelius-Sinfonien mit dem London Symphony Orchestra in Mono auf.
Mit seiner Sinfonie Nr. 5 beginnt ein neues Kapitel im Leben von Jean Sibelius. Die Krebserkrankung war glücklich überwunden. Angeregt wurde das Werk von offizieller Seite und sollte seinen eigenen 50. Geburtstag musikalisch untermalen. Tatsächlich erklang sie an eben diesem 8. Dezember 1915 unter Leitung des Komponisten in Helsinki. Mit dieser Erstfassung war Sibelius allerdings bald schon unzufrieden, so dass es – untypisch für ihn – zu einer Umarbeitung kam, die 1916 vollendet wurde. Auch sie stellte nicht der Weisheit letzten Schluss dar, denn erst die Drittfassung von 1919 sollte seinen hohen Ansprüchen an sich selbst genügen. Diese Letztfassung dominiert heutzutage absolut, so dass es nicht wunder nimmt, dass sich auch Mäkelä ihrer bedient. Als sie am 24. November 1919 der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde, war Finnland tatsächlich ein unabhängiges Land, der Zusammenbruch des Zarenreiches hatte dies ermöglicht. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Tilgung der Schroffheit, welche der Urfassung noch anhaftete, zugunsten einer positiveren Grundstimmung zu verstehen. Der junge Dirigent jedenfalls sieht in der Fünften eine Reaktion von Sibelius auf die europäische Moderne. Seine Lesart nimmt für sich ein. Gewisse Akzentuierungen sind wie Reminiszenzen an frühere Interpreten. Das sehr nachdrückliche Einsetzen der Streicher zu Beginn des Schlusssatzes erinnert an Bernsteins Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern. Die ohrwurmartige „Schwanenhymne“ im Finalsatz hörte man indes schon ausdrucksstärker. Die schwierigen Schlussakkorde geraten etwas zu verhalten.
Mit „reinem Quellwasser“ assoziierte Jean Sibelius persönlich seine sechste Sinfonie von 1923. Sie leitet gewissermaßen den Spätstil des Komponisten ein, steht im dorischen Modus und gemahnt stellenweise beinahe an Palestrina. Klaus Mäkelä sieht in ihr „eine Übung in höchster Ausdrucksreinheit“. Tatsächlich kommt die Sechste deutlich entschlackter daher als ihre Vorgängerinnen. Als „Cinderella der sieben Sinfonien“ (Gerald Abraham) steht sie im Schatten der anderen, wird auch von der im Jahr später fertiggestellten Siebenten überstrahlt, die dem Dirigenten als letzte vollendete Sinfonie des Komponisten als die „vollkommenste“ erscheint. Hier kehrt auch die Monumentalität wieder, die der Sechsten abgeht. Es gibt gleichwohl eine enge Verbindung zwischen beiden Werken, die im Konzert teilweise auch schon ohne Pause, gleichsam als Einheit, ineinander nahtlos übergehend gespielt wurden. Sibelius‘ reifer Altersstil gelangt hier jedenfalls zu seiner Vollendung. Da wie dort genehmigt sich Mäkelä mehr Zeit als die meisten anderen Interpreten, erreicht aber nicht ganz die Emphase eines Leonard Bernstein oder auch Charles Munch (Nr. 7), die ähnliche Ansätze verfolgten.
Mit der Tondichtung Tapiola schrieb Sibelius 1926 sein letztes großes Orchesterwerk überhaupt. Mit dieser, gewiss seiner reifsten sinfonischen Dichtung kehrte der damals 61-Jährige zurück zur finnischen Mythologie des Kalevala, die seine frühen Jahre so nachhaltig geprägt hatte. Die Waldgottheit Tapio ist es, nach der das Werk benannt ist, und „des Nordlands düstre Wälder“ mit ihrer Unendlichkeit sind das Thema. Insofern lässt sich auch Tapiola durchaus als absolute Musik verstehen. Mäkeläs Lesart ist hier überzeugender als in der siebten Sinfonie.
Also Bonus darf die Beigabe dreier später Fragmente (HUL 1325, 1236/9 und 1327/2) begriffen werden, rekonstruiert von Timo Virtanen. Diese wurden bislang erst einmal eingespielt, nämlich durch das BBC Philharmonic unter John Storgards für Chandos. Wiederum wählt Mäkelä im direkten Vergleich getragenere Zeitmaße. Ob die besagten Fragmente zur geplanten, aber bekanntlich niemals zu Ende gebrachten achten Sinfonie gehören, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen.
Als Konklusion lässt sich festhalten, dass Klaus Mäkelä und das Osloer Philharmonische Orchester eine wirklich beachtliche Gesamtaufnahme vorgelegt haben, die zwar kein neues Kapitel in Sachen Sibelius-Interpretation aufschlägt und auch keine der bisherigen Referenzaufnahmen vollauf ersetzen kann, jedoch eine hörenswerte Erweiterung in der zunehmend unüberschaubaren Diskographie bedeutet. Besonders hervorzuheben sind die Interpretationen der ersten, zweiten und vierten Sinfonie. Ob die hie und da auffällige Streicherlastigkeit allein auf dem Konzept des Dirigenten beruht oder ob dies auch Produkt der Klangphilosophie der Decca-Tontechniker ist, lässt sich an dieser Stelle nicht abschließend beantworten. Die Textbeigabe (Englisch, Französisch, Deutsch) fällt relativ bescheiden aus (Foto oben/ Klaus Mäkelä/ Booklet zur Decca-Ausgab). Daniel Hauser






 Dieses ärgerliche Manko wird freilich dadurch abgemildert, dass es letztlich auf den Inhalt ankommt. Dieser ist in der Summe überaus gediegen. Was sofort auffällt, ist, dass nicht der durchaus bei EMI erschienene klassische
Dieses ärgerliche Manko wird freilich dadurch abgemildert, dass es letztlich auf den Inhalt ankommt. Dieser ist in der Summe überaus gediegen. Was sofort auffällt, ist, dass nicht der durchaus bei EMI erschienene klassische  Auch im Falle der drei anderen Opern des Komponisten darf von Volltreffern gesprochen werden.
Auch im Falle der drei anderen Opern des Komponisten darf von Volltreffern gesprochen werden. 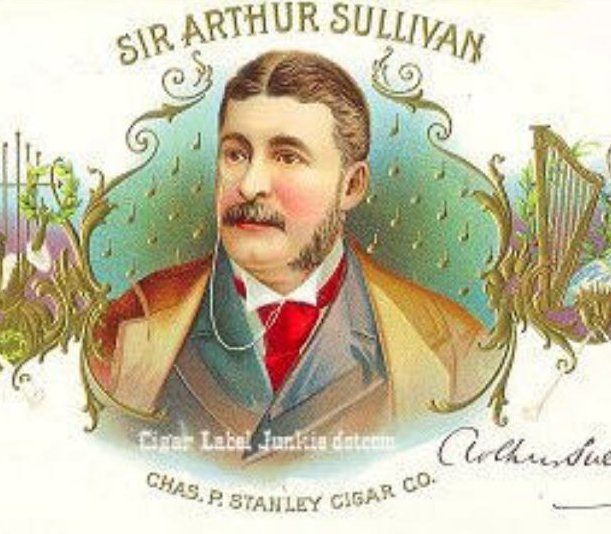
 Schon vor etwa 30 Jahren spielte Marco Polo die Musik zum Ballett L’île Enchantée erstmals ein (später bei Naxos neu aufgelegt), doch bedient sich der Bearbeiter
Schon vor etwa 30 Jahren spielte Marco Polo die Musik zum Ballett L’île Enchantée erstmals ein (später bei Naxos neu aufgelegt), doch bedient sich der Bearbeiter  Heiterkeit herrscht in den Day Dreams vor, welche bereits 1934
Heiterkeit herrscht in den Day Dreams vor, welche bereits 1934  Bekanntlich beruht
Bekanntlich beruht  Den Gesangspart übernehmen die bestens disponierten
Den Gesangspart übernehmen die bestens disponierten  Gilbert und Sullivan
Gilbert und Sullivan











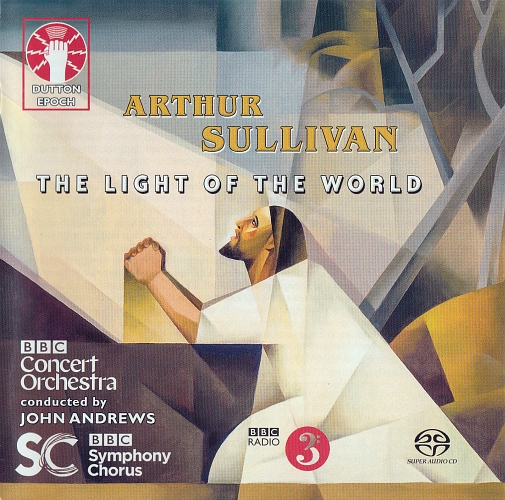


 Die großartig gelungene und von wahrem Pioniergeist getragene Weltersteinspielung dieses Oratoriums, das mit seinem Pathos stellenweise an spätere Hollywood-Filmmusik erinnert, hat nun das britische Label
Die großartig gelungene und von wahrem Pioniergeist getragene Weltersteinspielung dieses Oratoriums, das mit seinem Pathos stellenweise an spätere Hollywood-Filmmusik erinnert, hat nun das britische Label 