.
Das goldene Byzanz mit seiner Hauptstadt Konstantinopel (heute Istanbul) lag bereits in seinen letzten Zügen, als es zu einer historisch bedeutsamen Zusammenkunft kam, die Ost und West zusammenführte. Die Reise von Manuel II. Palaiologos (1350-1425), dem drittletzten byzantinischen Kaiser (reg. 1391-1425), nach Westeuropa in den Jahren 1399 bis 1403 war zuvörderst ein Hilfeschrei gen Westen, das über tausendjährige Römische Reich, dessen östlicher Teil anachronistisch später als „byzantinisch“ bezeichnet wurde, vor der osmanischen Bedrohung zu retten. Bereits damals bestand das Imperium, das einst das Mittelmeer umspannt hatte, fast bloß noch aus Konstantinopel, welches an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert nur mehr etwas über 50.000 Einwohner vorzuweisen hatte und sich seit 1394 einer Belagerung durch die Osmanen ausgesetzt sah. Manuel II. besuchte im Zuge seiner Reise Italien, Frankreich und zum Jahreswechsel 1400/01 eben auch England. Diesem einzigen Besuch eines oströmischen Kaisers auf der Insel widmet das Label Capella Records nun eine mit A Byzantine Emperor at King Henry’s Court – Christmas 1400, London betitelte Neuerscheinung (CR427). Mit King Henry ist der englische König Heinrich IV. (1367-1413) gemeint, der erst kurz davor als Usurpator auf den Thron gekommen war und die Dynastie des Hauses Lancaster, einer Nebenlinie der Plantagenets, etablierte. Opernfreunden dürfte dieser König von England durch Verdis Falstaff und Nicolais Lustige Weiber von Windsor zumindest peripher ein Begriff sein, sind beide Shakespeare-Vorlagen doch in dessen Regierungszeit (reg. 1399-1413) angesiedelt.
 Bei Capella Records handelt es sich im Übrigen um das Eigenlabel der 1991 von Alexander Lingas in Portland, Oregon, gegründeten Cappella Romana. Das Ensemble hat sich auf slawische und byzantinische Musik in deren Originalsprache spezialisiert und sich in der Vergangenheit in diesem Bereich große Meriten erworben. Die Neuerscheinung – übrigens eine hybride SACD, die auch das Mehrkanalton-Format aufweist – ist bereits die 30. Veröffentlichung der Portlander. Frühere Erscheinungen widmeten sich beispielsweise den Hymnen der legendären byzantinischen Komponistin Kassia aus dem 9. Jahrhundert und dem Fall von Konstantinopel im Jahre 1453. Bereits mit der Namenswahl bewies Lingas, Musikwissenschaftler und langjähriger Professor an der City University in London und nun in Cambridge, das richtige Händchen für historische Zusammenhänge, bezieht sich die Bezeichnung als „Römische Kapelle“ doch auf das byzantinische Konzept der römischen Oikumene, also der gesamten bewohnten damals bekannten Welt. Die sogenannten Byzantiner betrachteten sich selbst bis zuletzt als Rhomaioi, also als Römer (Rhomäer), auch wenn sie im lateinischen Westen „Griechen“ genannt wurden. Das A-Cappella-Ensemble besteht jedenfalls aus zwei Sopranistinnen, zwei Altistinnen, drei Tenören, einem Bariton und drei Bassisten, sämtlich ausgewiesenen Spezialisten für dieses exotische Gebiet der Alten Musik.
Bei Capella Records handelt es sich im Übrigen um das Eigenlabel der 1991 von Alexander Lingas in Portland, Oregon, gegründeten Cappella Romana. Das Ensemble hat sich auf slawische und byzantinische Musik in deren Originalsprache spezialisiert und sich in der Vergangenheit in diesem Bereich große Meriten erworben. Die Neuerscheinung – übrigens eine hybride SACD, die auch das Mehrkanalton-Format aufweist – ist bereits die 30. Veröffentlichung der Portlander. Frühere Erscheinungen widmeten sich beispielsweise den Hymnen der legendären byzantinischen Komponistin Kassia aus dem 9. Jahrhundert und dem Fall von Konstantinopel im Jahre 1453. Bereits mit der Namenswahl bewies Lingas, Musikwissenschaftler und langjähriger Professor an der City University in London und nun in Cambridge, das richtige Händchen für historische Zusammenhänge, bezieht sich die Bezeichnung als „Römische Kapelle“ doch auf das byzantinische Konzept der römischen Oikumene, also der gesamten bewohnten damals bekannten Welt. Die sogenannten Byzantiner betrachteten sich selbst bis zuletzt als Rhomaioi, also als Römer (Rhomäer), auch wenn sie im lateinischen Westen „Griechen“ genannt wurden. Das A-Cappella-Ensemble besteht jedenfalls aus zwei Sopranistinnen, zwei Altistinnen, drei Tenören, einem Bariton und drei Bassisten, sämtlich ausgewiesenen Spezialisten für dieses exotische Gebiet der Alten Musik.
Vom musikalischen Leiter Alexander Lingas stammt auch der vorzügliche, sehr umfassende und mit Quellenverweisen angereicherte Einführungstext (allerdings nur auf Englisch), der wichtige und unerlässliche Hintergrundinformationen bietet. Die Zusammenkunft von byzantinischem Kaiser und englischem König war nicht zuletzt eben auch ein direktes Aufeinandertreffen von östlicher und westlicher Musik. Nach seinem Aufbruch im Dezember 1399 war Kaiser Manuel II. zunächst über Italien nach Paris gereist, wo ihn der französische König Karl VI. im Juni 1400 mit allen Ehren empfing. Die Hauptstadt Frankreichs wurde in den kommenden zwei Jahren dann auch die Ausgangsbasis für den Autokrator der Rhomäer in seinen Beziehungen zu den Herrschern des lateinischen Abendlandes. Im Oktober 1400 war Manuels Besuch in England diplomatisch auf den Weg gebracht worden, so dass der Kaiser samt seines Gefolges zunächst ins seinerzeit noch englische Calais übersiedelte. Am 11. Dezember 1400 kam es schließlich zur Kanalüberquerung nach Dover, wo ihn zunächst der Klerus von Canterbury willkommen hieß. Am 21. Dezember 1400 kam es dann endlich zum Herrschertreffen in Blackheath bei London. Das Weihnachtsfest verlebte der Kaiser als Ehrengast des Königs im Eltham Palace. Nach den Festtagen wurde die Konstantinopeler Delegation in London als Gast des Johanniterordens beherbergt. Die tiefe Frömmigkeit des Kaisers und seines Hofstaates im Verbund mit Manuels asketischer und doch kaiserlicher Ausstrahlung beeindruckte die Engländer nachhaltig. Wirklich bedeutsame finanzielle oder militärische Unterstützung konnte ihm Heinrich indes nicht liefern, so dass Manuel im Februar 1401 nach Paris zurückkehrte, wobei ein Teil seiner Abordnung in England verblieb, um die Verhandlungen weiterzuführen. Eine kostbare Reliquie aus Konstantinopel, ein Stück des nahtlosen Gewandes der Gottesgebärerin und Jungfrau Maria, wurde Englands König in diesem Zusammenhang zum Geschenk gemacht. Da die Versuche, Waffenhilfe zu erlangen, auch dort fruchtlos blieben, reiste der Kaiser von Byzanz im November 1402 nach Konstantinopel zurück, wo er bei seiner Rückkehr im Juni 1403 immerhin feststellen konnte, dass die osmanische Belagerung infolge der Niederlage Sultan Bayezids gegen Tamerlan in der Schlacht bei Ankara (28. Juli 1402) nach achtjähriger Dauer mittlerweile aufgehoben worden war.

Charles, Duke of Orléans, in the Tower of London from a 15th-century manuscript/ Quelle: Gedichte von Herzog Karl von Orléans, Brügge 1483 u. 1492-1500 (British Library, Royal MS 16 F II, f. 73r)/ Wikipedia
An Weihnachten 1400 kamen im Eltham Palace die Kleriker und Sänger sowohl der kaiserlich byzantinischen als auch der königlich englischen Hofkapelle zusammen. Genaue Quellenbeschreibungen der dort gespielten Musik haben sich erhalten, einzig der Hinweis auf prächtige und aufwendige Festlichkeiten. Die englischen Chronisten berichten jedenfalls von täglichen Gottesdiensten der kaiserlichen Geistlichen. Aufgrund des seinerzeitigen Schismas zwischen der römisch-katholischen und griechisch-orthodoxen Kirche ist anzunehmen, dass beide Monarchen an Festgottesdiensten teilnahmen, die gemäß ihren jeweiligen Riten gefeiert wurden. Dies ermögliche eine Rekonstruktion der Inhalte mittels anderweitiger Text- und musikalischer Quellen.
Hinsichtlich des heute sogenannten byzantinischen Ritus ist bedauerlicherweise nichts über die Musik bekannt, die im Zuge dessen von Blechbläser, Holzbläsern und Schlagwerk gespielt wurde – eine musikalische Notation ist hier praktisch nicht existent. Geläufig ist dafür die Vokalmusik der sogenannten Prokypsis durch liturgische Sammlungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Stilistisch mannigfaltig, reicht diese von einfachen Formen der Psalmodie und traditionellen Melodien für vorwiegend syllabische Hymnodien bis hin zu anspruchsvollen und teils langatmigen Werken in kalophonischem („schön klingendem“) Idiom. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts standen in der kaiserlichen Kapelle die Gesänge zweier Schüler des Protopsaltis (Erster Kantor) Johannes Glykes (Mitte 13. Jahrhundert-um 1320) im Mittelpunkt: Der hl. Johannes Papadopoulos Koukouzeles (vor 1270-vor 1341) und Xenos Korones (spätes 13. Jahrhundert-Mitte 14. Jahrhundert).
Was die englische Hofkapelle betrifft, befand sich diese um 1400 in einer bereits unter Richard II. (reg. 1377-1399) begonnenen und unter Heinrich V. (reg. 1413-1422) gipfelnden personellen Vergrößerung. Für das Weihnachtsfest 1400 sind 33 Mitglieder belegt, wovon in den frühen Regierungsjahren Heinrichs IV. üblicherweise 18 reife Sänger waren, etwa fünf jüngere Sänger und neun bis zehn Chorknaben. Liturgisch bediente man sich des sogenannten Sarum Use, des Salisburger Ritus.
Trotz aller offenkundigen Unterschiedlichkeit, die sich schon in den beiden Sprachen Griechisch und Latein zum Ausdruck kamen, gab es auch Parallelen. So gab es weder in Byzanz noch in England seinerzeit einen wirklich einheitlichen, überall identischen Ritus, sondern lokale Unterschiede. Man stützte sich da wie dort auf traditionelle Gesänge, die ein Gros der im Gottesdienst gesungenen Musik ausmachten. Während spätbyzantinische Komponisten vor allem um die Virtuosität bedacht waren, war man im englischen Falle um eine Verschönerung der Musik durch Mehrstimmigkeit bemüht. Improvisierte Polyphonie scheint im frühen 15. Jahrhundert die Regel gewesen zu sein. Infolge des Bruchs im religiösen Leben in England nach der protestantischen Reformation ist bedauerlicherweise kein einziges Manuskript englischer Polyphonie aus dem 14. Jahrhundert erhalten geblieben. Aus den erhaltenen Fragmenten lässt sich erahnen, dass die komplexesten Werke der seinerzeitigen englischen Polyphonie Massensätze und Motetten für vier Stimmen waren, wobei eine Ähnlichkeit zu kontinentalen Komponisten wie Guillaume de Machaut (um 1300-1377) festzustellen ist.
Die Capella Romana versucht aus den genannten Gründen keine strenge Rekonstruktion, die aufgrund der Quellenlage unmöglich erscheint, sondern bedient sich einer Auswahl von Gesang und Polyphonie zur Geburt Christi, welche stilistisch das Repertoire der byzantinischen und englischen Kapelle um 1400 repräsentiert. Hierbei war eine gewisse Flexibilität unabdingbar. So stellt man die Musik in eine ungefähre liturgische Reihenfolge, beginnend mit dem Heiligen Abend und endend mit dem Magnificat für den Gottesdienst der zweiten Vesper, die am Abend des 25. Dezember gefeiert wird. Die griechische und lateinische Auswahl legt Wert auf gemeinsame Themen und parallele musikalische Technik. Tatsächlich ist die Quellenlage hinsichtlich der byzantinischen Musik um 1400 aufgrund der Klosterbibliotheken des Sinai und des Bergs Athos in diesem Falle sogar die bessere.
Mit dem lateinischen Iudea et Hierusalem, einem Responsoriumsgesang, beginnt die Vesper für die Vigil der Geburt des Herrn am Heiligen Abend. Byzantinischerseits wird auf dem Höhepunkt der neunten Stunde an Heiligabend zunächst die Anwesenheit des Kaisers besungen und anschließend Akklamationen für ihn und seine Familie dargebracht. Danach kam der Kaiser in vollem Ornat hinter einem Vorhang hervor, betrat die Bühne (Prokypsis) und empfing den Beifall des versammelten Hofes. Auf Reisen war dieses Zeremoniell reduziert und wurde auf die Fanfaren der Blechblasinstrumente verzichtet, die in Konstantinopel ebenfalls beteiligt gewesen wären. Gleichsam als Coda beendet ein sogenanntes Polychronion die Abfolge der Huldigungen.

Eine Abbildung von Konstantinopel um 1420/Quelle: Cristoforo Buondelmonti, Liber insularum Archipelagi, 1465-1475 (Bibliothèque nationale de France, GE FF-9351 RES, f. 37r)/ Gallica/ BNF
Den eigentlichen Weihnachtstag eröffnet Ovet mundus letabundus, eine anonyme Vertonung eines nicht-liturgischen Weihnachtstexte für vier Stimmen aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die ersten traditionellen byzantinischen Morgengesänge an Weihnachten stellen die Pentekostaria-Hymnen dar, mittels derer die jungfräuliche Geburt Jesu betont wird. Das lateinischsprachige O magnum mysterium hat ebendieses Wunder zum Thema, was neuerlich die gemeinsame Tradition verdeutlicht, trotz jahrhundertelanger unterschiedlicher Entwicklung in Ost und West. Mit dem ersten Kanon der Weihnachtsmatutin, des nächtlichen Offiziums zwischen Mitternacht und frühem Morgen, folgt wiederum eine griechische Hymne, die auf Kosmas von Jerusalem im 8. Jahrhundert zurückgeht. Gleich anschließend folgt ein majestätisches kalophonisches Megalynarion von bald neun Minuten Länge. Als westliches Gegenstück erklingt sodann die Sequenz Te laudant alme Rex, gefolgt von Hodie Christus natus est, also die Hervorhebung der heutigen Geburt Christi. Das griechische Gegenstück stellt der Prolog zum Kontakion des hl. Romanos Melodos dar. Ein Überbleibsel des liturgischen Erbes der Antike, welches sich die griechischen und lateinischen Christen des Mittelalters teilten, war das Singen des Kyrie eleison in der Messe. Hier hat sich der griechische Wortlaut auch im lateinischen Westen erhalten. Das nachfolgende polyphone Gloria in excelsis ist ein anonymes Werk, welches anhand zweier Quellen (Fountains Abbey in Yorkshire und das sogenannte Old Hall Manuscript) rekonstruiert werden konnte. Der Kommunionsvers für den Weihnachtstag schließlich geht zurück auf den Mönch Agathon Korones (erste Hälfte des 14. Jahrhunderts) und beschließt den zweiten Teil.
Den letzten großen lateinischen Gottesdienst, der am 25. Dezember 1400 im Eltham Palace gefeiert wurde, stellt das Abendgebet der zweiten Vesper dar. Als Höhepunkt desselben erklingt das Magnificat mit dem sich anschließenden Antiphon Hodie Christus natus est. Bruchstückhaft ist die polyphone Vertonung dieses Mariengesangs aus dem 15. Jahrhundert an der Universität Cambridge überliefert.
Die künstlerische Qualität dieser Einspielung ist über jeden Zweifel erhaben und bietet einen spannenden Einblick in eine musikalisch nahezu unbekannte Welt fernab des üblichen Repertoires. Hierzu ist es lediglich notwendig, sich auf den für heutige Ohren ungewohnten, teils sehr reduzierten A-Capella-Gesang einzulassen, was aufgrund des ausgezeichneten Klangs idealtypisch erfolgen kann (Aufnahme: The Madeleine Parish, Portland, Oregon, 18.-22. September 2022). Dass die Gesangstexte vollständig auf Griechisch und Lateinisch jeweils nebst englischer Übersetzung abgedruckt sind, versteht sich von selbst. Daniel Hauser





 Eben dieser Sonderfall, die
Eben dieser Sonderfall, die 



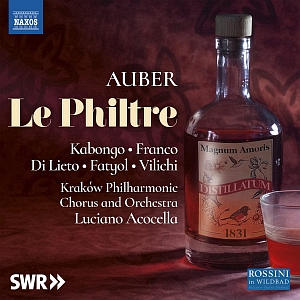






 Bei Capella Records handelt es sich im Übrigen um das Eigenlabel der 1991 von
Bei Capella Records handelt es sich im Übrigen um das Eigenlabel der 1991 von 


