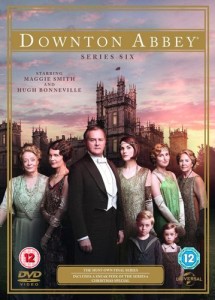Es ist eher selten, dass ein Dirigent gut fünfzig Jahre nach seinem Tod durch Neuerscheinungen von sich reden macht. Aufnahmen also, die es bisher noch nicht gab auf Tonträgern. Hans Knappertsbusch (1888 – 1965) ist so ein Dirigent. Posthum widmet ihm Orfeo durch Ausgrabungen in Archiven einen eigenen Katalog, der nach oben noch offen zu sein scheint. Es kommen mehr und mehr Titel hinzu. Obwohl die Aufnahmen akustisch nicht so punkten können wie die anderer bedeutender Dirigenten seiner Generation, die Wirkung wird dadurch offenbar nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil. Es ist sein Stil, der sich über die Zeit gerettet hat. Seine unkonventionelle, hoch individuelle Art, Musik zu zelebrieren. Das kommt an. Auch nach vielen Jahrzehnten. Bei Knappertsbusch stellt sich die Frage nach Stereo oder Mono zuletzt. Nun kam ein Album mit bislang unveröffentlichten Werken von Beethoven auf den Markt. R.W.

Hans Knappertsbusch bei einer Probe im Wiener Musikverein. Zu sehen ist es auf dem Cover der herkömmlichen DVD-Ausgabe von Arthaus, die die Leonoren-Ouvertüre, das 4. Klavierkonzert sowie Vorspiel und Liebestod aus Tristan und Isolde enthält. Sie ist mit der Katalognummer 109213 ebenfalls noch auf dem Markt.
Die Beziehung zwischen Hans Knappertsbusch und den Wiener Philharmonikern stand von Anfang an unter einem guten Stern. Die erste Begegnung des Dirigenten mit dem österreichischen Orchester von Weltrang fand 1929 in Salzburg statt. Bis 1964, dem Jahr des krankheitsbedingten Rückzugs, gestalteten der aus Elberfeld stammende Kapellmeister und die Wiener Philharmoniker nicht weniger als 210 Konzerte miteinander. Beethoven, der Wegbereiter der romantischen Symphonik, nahm in seinem Repertoire einen ganz besonderen Platz ein. Das Label Orfeo stellt auf seiner Internetpräsenz treffend heraus, der Beethoven unter der Stabführung von Hans Knappertsbusch sei „ein Sonderfall innerhalb des Sonderfalls“. Abgesehen von der Pastorale, zu der er offenbar keinen Zugang fand, dirigierte er alle Beethoven-Symphonien, auch wenn sich von der Neunten nur Auszüge und von der Vierten überhaupt kein Tondokument erhalten haben.
Zwei zentralen Symphonien, der Eroica und der Siebenten, widmet Orfeo nun in Mitschnitten aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins eine neues Doppel-CD-Album (C 901 162 B). Ergänzt wird das Programm durch das Klavierkonzert Nr. 4 mit dem kongenialen Wilhelm Backhaus am Klavier sowie durch die Coriolan-Ouvertüre. Bereits in den ersten Takten der Ouvertüre hört man, dass dies kein Beethoven aus unseren Tagen sein kann. Da ist der ganz große Gestus, das heutzutage verpönte Pathos in überbordendem Maße. Coriolan fungierte als Präludium des ersten hier festgehaltenen Konzerts vom 17. Januar 1954. Im besten Sinne zeitlos ist die pharmacy online Interpretation des Klavierkonzerts, die gleichsam das Zusammentreffen zweier Giganten dokumentiert. Auf der einen Seite steht die Klarheit des Pianisten Backhaus, auf der anderen der sich bewusst zurücknehmende Dirigent Knappertsbusch, der sich damit als online pharmacy reviews cialis idealer Begleiter erweist. Beiden gemein ist die heutzutage altmodisch erscheinende Spontaneität, welche jedem Streben nach vermeintlicher Perfektion eine Absage erteilt. Dass vorab viel geübt wurde, ist eher nicht anzunehmen. Dass das Ergebnis trotzdem dermaßen überzeugt, mag auch an der besonderen, beinahe ein halbes Jahrhundert währenden Beziehung zwischen Knappertsbusch und den Wiener Philharmonikern liegen. Der Autor des Textes im Booklet, Gottfried Kraus, zitiert den Wiener Musikpublizist Alexander Witeschnik (1909-1993) mit treffenden Beobachtungen: „Interpretationsprobleme und Taktstockfragen haben ihn nie bekümmert. Sein Verhältnis zur Musik ist kein intellektuelles, sondern ein durchaus emotionelles. Wie keiner hat er die Gnade, sich der Gunst des Augenblicks zu überlassen. Er vertraut der Intuition des Abends mehr und lieber als dem Schweiß der Proben. Ja es scheint, dass er die gewisse Spannung des Risikos braucht und sucht. Aus ihr gewinnt er die lebende Unmittelbarkeit seines Musizierens, aus ihr den herrlichen Mangel an geheimnisloser Perfektion. Knappertsbusch ist der größte und genialste Improvisator am Pult.“

Brahms und Wagner, produziert 1953 beim WDR: Eines der zahlreichen Hans-Knappertsbusch-Alben von Orfeo (C 723 071 B)
Das breite Zeitmaß ist in diesem Beethoven-Bild, das zweifellos dem Verständnis des späten 19. Jahrhunderts verhaftet ist, vorherrschend. Kraus ist beizupflichten, wenn er betont, dass beim „Kna“ jede Diskussion über Tempo- oder Stilfragen gegenstandslos erscheint. Seine Siebente, der Schluss- und Höhepunkt dieses ersten Konzertes, baut sich gemächlich, aber unaufhaltsam auf, den alles bestimmenden Rhythmus immer klarer herausstellend. Das Vivace bricht mit Vehemenz herein. Die Blechbläser dürfen dionysisch schmettern und müssen sich nicht unter dem schwelgerischen Streicherklang verstecken. Es überwiegt das Triumphale, das Erhebende im Kopfsatz. Das berühmte Allegretto wird hier ganz altmodisch in der real canadian superstore pharmacy surrey Art eines feierlichen Trauermarsches aufgefasst und bildet den natürlichen Kontrast zum Kopfsatz. Geschickte Temporückungen dienen der Akzentuierung. In dieser Monumentalität fühlt man sich beinahe an eine frühe Reminiszenz an Siegfrieds Trauermarsch aus der Götterdämmerung erinnert. Das Scherzo entbehrt nicht der Dramatik. Gemessen und, wenn nötig, doch impulsiv herausfahrend. Das bukolische Trio ist in seiner monumentalen Statik im besten Sinne unzeitgemäß. Zum Höhepunkt gerät der Finalsatz, der zwar kaum einem Allegro con brio entsprechen dürfte, in seiner Wuchtigkeit aber die Raserei sogar noch besonders unterstreicht. Unbeirrbar hält Knappertsbusch am einmal angeschlagenen Grundtempo fest. So gerät dies zwar nicht zum revolutionären Tanz, entfaltet aber dennoch eine Sogwirkung, der man sich nicht entziehen kann. Die Bedrohlichkeit in der Coda wird durch schneidend scharfes Blech noch verstärkt. Geheimnisvoll schlängelt sich die Musik voran, fast an einen Lindwurm erinnernd. Die Pauken, Trompeten und Hörner legen sich zuletzt besonders in Zeug. Erschütternd klingt die Symphonie aus und veranlasst das Publikum zu überbordendem Applaus.
Mächtig und gewaltig beginnt auch das zweite Konzert des CD-Albums, das am 17. Februar 1962 stattfand. Bereits nach wenigen Augenblicken wird bei der Eroica offenkundig, dass es Knappertsbusch mit der Tempobezeichnung Allegro con brio nicht allzu ernst nimmt. Es ist eher ein majestätisches Dahinschreiten ohne jeden Anflug von Eile. Die Wiederholung fällt weg. Die Wiener Philharmoniker können sich problemlos auf den getragenen Stil einstellen. Tänzerisch ist hier zwar eher nichts, doch es lässt sich gut nachempfinden, was an dieser Symphonie heroisch angelegt ist. Im Verlaufe des Satzes wird immer deutlicher, dass das langsame Grundtempo dem Werk keinesfalls zum Nachteil gereicht, wenngleich ein gänzlich anderes Klangerlebnis erzielt wird, als dies bei modernen Interpretationen auf historischem Instrumentarium der Fall ist. Die Spannung steigt spürbar bei der Überleitung zur Coda. Die Streicher, Holz- und Blechbläser der Wiener Philharmoniker präsentieren sich von ihrer besten Seite. Der Gestus am Gipfelpunkt des längsten Kopfsatzes Beethoven’scher Symphonik gerät naturgemäß triumphal.

Anklänge aus Wagners „Götterdämmerung“ gibt es unter Knappertsbusch auch bei Beethoven: dieser Mitschnitt der „Götterdämmerung“ von 1955 stammt aus München (Orfeo C 356 944 L)
Im sich anschließenden Trauermarsch, der mit Adagio assai überschrieben ist, hält sich der Dirigent freilich enger an die Vorgaben des Komponisten. Es wechseln sich tieftraurige und trostvolle Stellen ab. Beides klingt gleichermaßen groß(artig). Der dramatische Höhepunkt dieser Marcia funebre hat bereits Wagner’sche Dimensionen und erinnert — noch deutlich mehr als der langsame Satz in der 7. Symphonie — an den Trauermarsch in der Götterdämmerung. Deutlich gelöster ist die Stimmung im sich anschließenden feurigen Scherzo, das mit Allegro vivace bezeichnet ist und auch unter Knappertsbuschs Stabführung einen deutlichen Kontrast zum Trauermarsch darstellt. Geheimnisvoll die Streichereinleitung, schließlich abgelöst durch ein formidabel dargebotenes Trio der Hörner. Das Hauptmotiv im Fortissimo stellt das Highlight dar. Mit einem Allegro molto setzt der Finalsatz ein, wobei sich Knappertsbusch auch hier nicht zum Sklaven des Metronoms machen lässt. Nun klingt wieder das Heldenhafte des Kopfsatzes an. Gemessen setzen die Blechbläser und die Pauken ein und verleihen dem Satz etwas wahrlich Staatstragendes. Ganz allmählich und geradezu zelebriert baut sich der große Zenit der gesamten Symphonie auf. Das strahlende Wiener Blech trägt dazu einen maßgeblichen Teil bei. Die mit Presto bezeichnete Coda offenbart noch ein letztes Mal die hohe Spielkultur der Wiener Philharmoniker. Mit Pauken und Fanfaren wird das Werk beschlossen. Zurecht Beifall und Jubel im Auditorium. Obwohl diese Eroica knapp 56 Minuten dauert und damit zu den langsamsten Aufnahmen zu rechnen ist, kommt aufgrund der Intensität der Darbietung kein Augenblick Langeweile auf.
Insgesamt eine sehr begrüßenswerte Veröffentlichung, welche Orfeo nun offiziell in Kooperation mit dem ORF auf der Grundlage der Originaltonbänder herausgebracht hat. Man fragt sich allerdings, wieso nicht auch die 2. Symphonie, welche das Konzert von 1962 eingeleitet hat, gleich ebenfalls inkludiert wurde. Dies ist allerdings ein verschmerzbarer Wermutstropfen. Das überragende Dirigat und die trotz der stets spürbaren Spontanität sehr gute Orchesterleistung ohne seelenlosen Perfektionismus sind ein schönes Zeugnis für die praktische Umsetzung der Traumpartnerschaft zwischen Hans Knappertsbusch und den Wiener Philharmonikern. Tonqualität und Remastering sind in Anbetracht des hohen Alters des Mitschnitts mehr als akzeptabel gelungen. Daniel Hauser
 Für die Anhänger von Knappertsbusch war es die Nachricht des Jahres 2015: Orfeo hat einen Lohengrin unter seiner Leitung aus dem Münchener Prinzregententheater ausgegraben (C 900 153D). Es handelt sich um einen Mitschnitt vom 2. September 1963 im Rahmen der Opernfestspiele. An diesem Trag dirigierte Knappertsbusch diese Oper zum letzten Mal. Im Haus, das er so sehr liebte, herrschte Endzeitstimmung. Der Umzug ins wiederaufgebaute Nationaltheater am Max-Joseph-Platz stand unmittelbar bevor. Danach sollte das dem Bayreuther Festspielhaus nachempfundene Prinzregententheater in einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf verfallen. Es wurde erst 1996 in seiner ursprünglichen Form wieder in Betrieb genommen nach einer provisorischen Zwischennutzung. Bislang gab es keinen kompletten Lohengrin mit diesem Dirigenten, obwohl er die Oper bereits vor dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise in Wien geleitet hat. Auszüge haben sich in der in den 1990er Jahren bei Koch/Schwan erschienen Edition von Mitschnitten aus diesem Opernhaus, erhalten. Vorspiele gibt es auch mehrfach aus dem Studio. Bei Decca begleitete er Kirsten Flagstad mit „Einsam in trüben Tagen“. In Bayreuth hatte Knappertsbusch den Lohengrin nie dirigiert, dafür sechzehn Vorstellungen zwischen 1954 und 1963 in München.
Für die Anhänger von Knappertsbusch war es die Nachricht des Jahres 2015: Orfeo hat einen Lohengrin unter seiner Leitung aus dem Münchener Prinzregententheater ausgegraben (C 900 153D). Es handelt sich um einen Mitschnitt vom 2. September 1963 im Rahmen der Opernfestspiele. An diesem Trag dirigierte Knappertsbusch diese Oper zum letzten Mal. Im Haus, das er so sehr liebte, herrschte Endzeitstimmung. Der Umzug ins wiederaufgebaute Nationaltheater am Max-Joseph-Platz stand unmittelbar bevor. Danach sollte das dem Bayreuther Festspielhaus nachempfundene Prinzregententheater in einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf verfallen. Es wurde erst 1996 in seiner ursprünglichen Form wieder in Betrieb genommen nach einer provisorischen Zwischennutzung. Bislang gab es keinen kompletten Lohengrin mit diesem Dirigenten, obwohl er die Oper bereits vor dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise in Wien geleitet hat. Auszüge haben sich in der in den 1990er Jahren bei Koch/Schwan erschienen Edition von Mitschnitten aus diesem Opernhaus, erhalten. Vorspiele gibt es auch mehrfach aus dem Studio. Bei Decca begleitete er Kirsten Flagstad mit „Einsam in trüben Tagen“. In Bayreuth hatte Knappertsbusch den Lohengrin nie dirigiert, dafür sechzehn Vorstellungen zwischen 1954 und 1963 in München.
Diese Aufnahme ist kein Rundfunkmitschnitt. Von einer bisher unentdeckten „Rarität aus dem Archiv von Herbert List, der von 1938 bis Kriegsende Betriebsdirektor und Regisseur sowie von 1952 bis 1977 auch Stellvertreter des Intendanten der Bayerischen Staatsoper war“, ist im Booklet die Rede. Das kann alles Mögliche bedeuten. Offenbar wurde die Vorstellung im Haus selbst aufgezeichnet. Nicht sehr professionell, nicht auf spätere Veröffentlichung zielend. Ein Hausmitschnitt für den Hausgebrach. Mehr nicht. Schon deshalb sind keine akustischen Wunder zu erwarten von dieser Oper, in der das Wunder eine so entscheidende Rolle spielt. Techniker haben herausgeholt, was herauszuholen war. Gewisse Schwankungen bleiben. Mitunter ist der Ton hallig und unsauber. Als würde er geschleift oder mit Sandpapier bearbeitet.
Das mit historischen Aufnahmen vertraute Ohr hört darüber gnädig hinweg, andere werden sich abwenden. Dieser Lohengrin eignet sich nicht dazu, jemanden für das Werk einzunehmen, gar zu begeistern. Er ist etwas für Eingeweihte, die darauf gefasst sind, dass ihnen einiges zugemutet und abverlangt wird. Die Aufnahme fliegt einem nicht zu. Sie will erkundet werden. Vor allem werden diejenigen etwas davon haben, die sich genauer mit Hans Knappertsbusch und seinem Dirigierstil beschäftigt haben, die ihm auch zugetan sind. Beim ersten Hören fühlte ich mich hin und her geworfen viagra für männer zwischen Hingabe und Verwunderung. Warum? Es ist, als würde sich ein Fenster öffnen, das einen Blick zurück ins 19. Jahrhundert freigibt, aus dessen Tradition und Geist Knappertsbusch kommt. Ja, so könnte es seinerzeit geklungen haben. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Ganz dem Ausdruck verpflichtet und weniger der Exaktheit des Zusammenspiels im Orchester. Es lohnt sich, seine Aufnahmen und Mitschnitte wieder einmal in Zusammenhängen zu hören, also auch den Jahren ihres Zustandekommens nach. Mir kommt es manchmal so vor, als habe sich sein Stil in die Vergangenheit zurückentwickelt und sei auch dunkler und herber geworden, je älter er wurde. Als sei er ein Verweigerer.

Hans Knappertsbusch/Arthaus.de
Seine Herangehensweise ist nicht durch die Erfahrungen der Studios gegangen, wo der Hang zur Perfektion auf faszinierende Weise immer weiter angestachelt und mitunter sogar auf die Spitze getrieben wurde. Es wurde mir bei diesem Lohengrin wieder mehr als klar, warum er, Knappertsbusch, der die Partituren immer und immer wieder studierte und aus dem Effeff beherrschte, Proben verabscheute und unter Studiobedingungen nicht zu seiner Hochform auflief. Er brauchte den Moment – und auch das Risiko. Denn riskant klingt es oft in diesem Lohengrin. Nicht nur einmal fragte ich mich, nanu, was war das denn? Ob ein Beckenschlag, der Einsatz des Triangels oder eine Bläsergruppe, manches klingt ganz anders, als man es kennt. Dabei aber nicht falsch. Knappertsbusch nimmt offenbar ganz bewusst in Kauf, dass nicht immer alles zusammen ist. Mitunter entsteht sogar der Eindruck, als würde er die Orchestermusiker und Solisten etwas hängen lassen. Dadurch wird es vieles spannender. Nach der Beschäftigung mit der Aufnahme kommt mir sogar der Verdacht, Knappertsbusch agiere mit durchaus schrägen Details bewusst hinterlistig und schelmisch, wobei schelmisch das letzte sein dürfte, was einem bei Lohengrin einfällt.
Die Steigerungen sind – wie immer bei ihm – atemberaubend. Leider musste die Szene vor dem Münster aus Platzgründen geteilt werden, der Schluss findet sich schon auf CD 3. Dadurch wird eben auch die unglaubliche Spannung unterbrochen, die er aufbaut, je weiter das Geschehen voranschreitet. Der Bogen muss neu gespannt werden. Einen Einblick in Knappertbuschs Arbeitsweise vermittelt auch das Vorspiel zum dritten Aufzug, in den das Hochzeitsfest rauschhaft gefeiert wird. Er betritt den Graben. Das Publikum rast, und mitten in den Beifall hinein gibt er den Einsatz. Musik und Beifall vermischen sich. Allein dadurch hat er die Menschen im Saal auf seiner Seite. Er reist sie regelrecht mit, zieht sie in die Oper hinein. Ist das seine eigentliche Absicht? Oder sollte er doch – wie immer kolportiert wird – aus Scheu vor dem Publikum die Verbeugung vermieden und ganz unvermittelt losgelegt haben?

Hans Knappertsbusch/ vergl. die website hansknappertsbusch.de
Die Besetzung bewegt sich auf damaligem Münchener Opernfestspielniveau. Hans Hopf sang den Lohengrin. Bisher hatte diese Rolle in seiner Diskographie gefehlt. Auch deshalb ist die Neuerscheinung von Belang. Hopf neigt stets zur Robustheit, so auch hier. Im richtigen Moment aber bringt er betörend schöne und lyrische Momente zustande, die einem den Atem stocken lassen. Ich bin geneigt, gar von italienischem Schmelz zu reden, wohl wissend, dass er sich gewöhnlich weit davon entfernt bewegte. Ihm zur Seite steht Ingrid Bjoner als Elsa, die im lyrischen Fach viel besser aufgehoben ist als später im hochdramatischen. Der bevorstehende Wechsel hat ihr nicht sehr gut getan. Ortrud vom Dienst ist Astrid Varnay, die mit einer Stimme, so scharf wie ein Schwert, durch die Aufführung rast. Als Telramund hinterlässt Hans Günter Nöcker einen der stärksten Eindrücke im Ensemble. Männlich, kernig, gradlinig, dabei nicht sehr hell im Kopf. Kein geborener Bösewicht, sondern einer, dem zu spät klar wird, wie er sich hat missbrauchen lassen für die machtpolitischen Ziele Ortruds. Unter seiner mächtigen alten Gerichtseiche am Ufer der Schelde thront ebenso mächtig Kurt Böhme als König Heinrich der Vogler. Josef Metternich ist ein kerniger und rasanter Heerrufer. Luxuriöser lässt sich diese undankbare Rolle nicht besetzen. Die kleinste solistische Aufgabe fällt in Lohengrin den Edelknaben zu. Deshalb wird kaum Aufhebens um sie gemacht. Vor dem Münster bahnen sie Elsa den Weg durch die Massen: „Macht Platz für Elsa, unsre Frau. Die will in Gott zum Münster gehn.“ Wer genau hinhört, wird die junge Brigitte Fassbaender mit ihrem unverwechselbaren Mezzo heraushören.
 Wie kaum ein anderes Label hat Orfeo in seinen diversen höchst verdienstvollen Live-Serien dem Dirigenten Hans Knapperstbusch, dessen Todestag sich am 25. Oktober 2015 zum 50. Mal jährte, ein Denkmal gesetzt. Sieben einzelne CDs enthalten sinfonisches Repertoire von Beethoven, Bruckner, Brahms und Schubert. Aus München wurden vor dem jetzt erschienen Lohengrin bereits Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, Götterdämmerung sowie Die lustigen Weiber von Windsor vorausgeschickt. Von den Bayreuther Festspielen folgten auf den Fliegenden Holländer, den Ring des Nibelungen sowie Parsifal jetzt noch die Meistersinger von Nürnberg (C 917 1541). Damit sind alle Werke, die Knappertsbusch in Bayreuth geleitet hat, im Orfeo-Katalog vollständig dokumentiert. In die Meistersinger hat er sich free coupon for viagra bei zu Beginn der Nachkriegsfestspiele 1951 noch mit Herbert von Karajan geteilt. 1952 bestritt er alle Vorstellungen, trat rx viagra dann erst wieder 1960 letztmalig bei diesem Werk in der ersten Inszenierung von Wieland Wagner ans Pult. Der Mitschnitt ist die Eröffnungspremiere vom 23. Juli, der vier weitere Vorstellungen folgten – für Knappertsbusch ein überwältigender Erfolg, wie Pressestimmen, die im Booklet zitiert werden, verdeutlichen. „Dabei lag über dieser magistralen Interpretation der Reiz des Improvisatorischen, wie er nur einem Dirigenten dieses Formats zu Gebote steht“, hatte die „Augsburger Allgemeine“ beobachtet und damit die Arbeitsweise des Dirigenten, die so schon beim Lohengrin zutage tritt, auf den Punkt gebracht.
Wie kaum ein anderes Label hat Orfeo in seinen diversen höchst verdienstvollen Live-Serien dem Dirigenten Hans Knapperstbusch, dessen Todestag sich am 25. Oktober 2015 zum 50. Mal jährte, ein Denkmal gesetzt. Sieben einzelne CDs enthalten sinfonisches Repertoire von Beethoven, Bruckner, Brahms und Schubert. Aus München wurden vor dem jetzt erschienen Lohengrin bereits Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, Götterdämmerung sowie Die lustigen Weiber von Windsor vorausgeschickt. Von den Bayreuther Festspielen folgten auf den Fliegenden Holländer, den Ring des Nibelungen sowie Parsifal jetzt noch die Meistersinger von Nürnberg (C 917 1541). Damit sind alle Werke, die Knappertsbusch in Bayreuth geleitet hat, im Orfeo-Katalog vollständig dokumentiert. In die Meistersinger hat er sich free coupon for viagra bei zu Beginn der Nachkriegsfestspiele 1951 noch mit Herbert von Karajan geteilt. 1952 bestritt er alle Vorstellungen, trat rx viagra dann erst wieder 1960 letztmalig bei diesem Werk in der ersten Inszenierung von Wieland Wagner ans Pult. Der Mitschnitt ist die Eröffnungspremiere vom 23. Juli, der vier weitere Vorstellungen folgten – für Knappertsbusch ein überwältigender Erfolg, wie Pressestimmen, die im Booklet zitiert werden, verdeutlichen. „Dabei lag über dieser magistralen Interpretation der Reiz des Improvisatorischen, wie er nur einem Dirigenten dieses Formats zu Gebote steht“, hatte die „Augsburger Allgemeine“ beobachtet und damit die Arbeitsweise des Dirigenten, die so schon beim Lohengrin zutage tritt, auf den Punkt gebracht.

Hans Knappertsbusch/ vergl. die website hansknappertsbusch.de
Akustisch kommt dieser Mitschnitt wesentlich besser rüber als der Lohengrin, weil auf die Originalaufnahme des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen werden konnte. Knappertsbusch hatte wohl auch das bessere Orchester zur Verfügung, das seinen Wagner auch ohne Notenblätter hätte spielen können. Die Präsenz der Aufnahme ist bestechend. Als Zuhörer fühlt man sich mittendrin. Lässt die Besetzung Wünsche offen? Jein! Josef Greindl, Urgestein der Festspiele, sang seinen ersten Hans Sachs in Bayreuth. Sein nasaler Bassbariton ist nicht jedermanns Sache. Es scheint, als sänge er manchmal zu sehr an der Oberfläche, nicht inhaltlich, sondern stimmlich. Greindl ist weniger der Intellektuelle viagra over the counter als vielmehr der Listige, der die Geschicke lenkt und Genugtuung verspürt, wenn er kräftig an „des Wahnes Faden“ zieht. Schöngesang gibt er für Ausdruck. Jedes Wort ist zu verstehen. Mit diesen Mitteln führt er die großen Szenen mit Beckmesser, der in Gestalt von Karl Schmitt-Walter ebenfalls betont charaktervoll agiert, zu den Höhepunkten der Aufführung. Mit dem Pogner arbeitete sich Theo Adam zum Sachs vor, den er erst acht Jahre später übernahm. Er singt passabel, klingt aber zu jung. Wolfgang Windgassen, der bei seinem Rollendebüt 1956 so draufgängerisch, frisch und neu wirkte, offenbart vier Jahre später deutliche Anzeichen von Routine. Er hatte nicht seinen besten Tag. Dabei standen ihm noch Lohengrin, Siegmund und Erik bevor. Ich muss mich immer erst mit dem eigenwilligen Timbre von Gerhard Stolze abfinden. Ist das geschehen, kann ich mich nicht satt hören an seiner stimmlichen und darstellerischen Gewieftheit, mit der als David durch die Aufführung fegt.
Ihren vorletzten Festspielsommer bestritt Elisabeth Grümmer als Eva. Mir fällt es schwer, sie anhand des Tondokuments mit dem „Mägdlein“ in Übereinstimmung zu bringen. Sie klingt zu reif und kann mittels ihrer immer noch faszinierenden Stimmittel ihre 49 Jahre nicht glaubhaft kompensieren. Fotos aller Solisten mit den dazugehörigen Lebensdaten verleiten dazu, einige genealogische albany college of pharmacy and health sciences Betrachtungen anzustellen. Demnach ist Eva fünfzehn Jahre älter als ihr Vater. Sie würde den Jahren nach bestens zu Sachs, der ja auch in sie verliebt ist, passen. Der ist nämlich sogar ein Jahr jünger, was im wirklichen Leben nicht ins Gewicht fiele. Spaß beiseite. Gespart wurde jedenfalls nicht bei der Besetzung. Ludwig Weber sang den Kothner nicht can you buy viagra over the counter immer ganz astrein in den schwierigen Koloraturen der Tabulatur. Auch für die übrigen Meister wurden Sänger aufgeboten, deren Namen noch heute einen guten Klang haben: Frithjof Sentpaul (Hermann Ortel), Hans Günter Nöcker (Hans Schwarz), Eugen Fuchs (Hans Foltz), Hermann Winkler (Augustin Moser), Heinz-Günther Zimmermann (Bathasar Zorn) und aus der DDR neben dem schon als Pogner benannten Theo Adam angereist Harald Neukirch (Ulrich Eisslinger) und Wilfried Krug (Kunz Vogelgesang). Elisabeth Schärtel sang die Magdalena, und der kanadische Bassbariton Donald Bell – damals erst sechsundzwanzig – den Nachtwächter.
Das letzte Worte sollen Wieland Wagner gehören, mit denen er Knappertsbusch zum 70. Geburtstag gratulierte, etwas bruchstückhaft nachzulesen im Booklet: „Sein Name weckt Liebe und Ehrfurcht – Gefühle der Verehrung also… Sie gelten, glaube ich, weniger seinem ehrwürdigen Alter…, als seiner Persönlichkeit. Diese ist ,unzeitgemäß‘ im besten Sinne dieses Wortes – aristokratisch, idealistisch, selbstbewusst und demütig zugleich“. Rüdiger Winter
 An Hans Knappertsbusch erinnert eine Blu-ray von Arthaus (109213) mit zwei Sonderkonzerten von den Wiener Festwochen 1962 und 1963 aus dem Theater an der Wien mit den Wiener Philharmonikern, die auch für den Opernliebhaber interessant sind. Im ersten finden sich Werke von Beethoven und Wagner, das zweite ist ganz Wagner mit dem ersten Akt der Walküre vorbehalten. Das Konzert aus dem Jahre 1962 beginnt mit der Ouvertüre zu Leonore III und ist noch einmal Anlass, die knapp-präzise Schlagtechnik, die Spannung, die der Dirigent trotz der streckenweise extremen Tempi zu erzeugen weiß, zu bewundern. Es folgt Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 in G-Dur, Solist ist wiederum Wilhelm Backhaus, der den ungewöhnlich verhaltenen Beginn in seiner einmaligen pharmacy technician jobs in canada hospitals Zartheit auskostet, mit dem Dirigenten eins ist in der Herausarbeitung des Kontrasts zwischen Miteinander und Gegeneinander von Solist und Orchester.
An Hans Knappertsbusch erinnert eine Blu-ray von Arthaus (109213) mit zwei Sonderkonzerten von den Wiener Festwochen 1962 und 1963 aus dem Theater an der Wien mit den Wiener Philharmonikern, die auch für den Opernliebhaber interessant sind. Im ersten finden sich Werke von Beethoven und Wagner, das zweite ist ganz Wagner mit dem ersten Akt der Walküre vorbehalten. Das Konzert aus dem Jahre 1962 beginnt mit der Ouvertüre zu Leonore III und ist noch einmal Anlass, die knapp-präzise Schlagtechnik, die Spannung, die der Dirigent trotz der streckenweise extremen Tempi zu erzeugen weiß, zu bewundern. Es folgt Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 in G-Dur, Solist ist wiederum Wilhelm Backhaus, der den ungewöhnlich verhaltenen Beginn in seiner einmaligen pharmacy technician jobs in canada hospitals Zartheit auskostet, mit dem Dirigenten eins ist in der Herausarbeitung des Kontrasts zwischen Miteinander und Gegeneinander von Solist und Orchester.
Bereits 1950 hatte der Dirigent eine Live-Gesamtaufnahme von Tristan und Isolde aus München vorgelegt, nunmehr erklingen Vorspiel und Liebestod, dessen Solistin Birgit Nilsson ist. Auffallend ist die Feierlichkeit, mit der das Vorspiel zelebriert wird, wobei natürlich der Klang der Wiener besonders ausgekostet werden kann. La Nilsson ist unvergleichlich, was Schönheit und technische Reife der Stimme, die Fähigkeit zu einer reichen Agogik betreffen und lässt den Hörer nur staunend zurück.
Wenn der 1. Akt der Walküre ausgesprochen altmodisch klingt, liegt das nicht am Dirigenten, sondern am Tenor Fritz Uhl, für den als Siegmund lediglich die gute Diktion spricht, während das helle Timbre, das um Korrektheit bemüht klingende Singen in manchmal direkt süßlich zu nennender Art Figur und Situation nicht gerecht werden, einfach langweilig erscheinen. Ganz anders Claire Watson als dunkel timbrierte Sieglinde, deren Sopran leuchten kann und sowohl die Innigkeit wie den strahlenden Jubelton der Befreiten dem Herzen des Zuhörers nahe bringt. Josef Greindls etwas knarziger Bass passt gut zur Figur des grimmen Hunding (Blu-ray Arthaus 109213). Ingrid Wanja






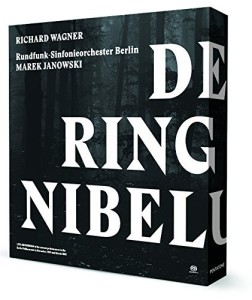









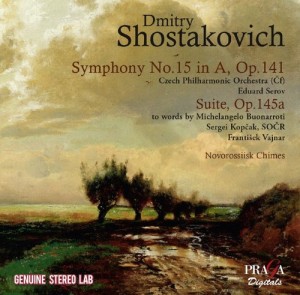




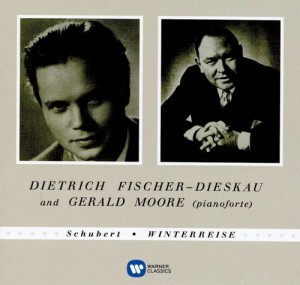


















 Und dann ist da noch der ehemalige Regensburger Domspatz
Und dann ist da noch der ehemalige Regensburger Domspatz