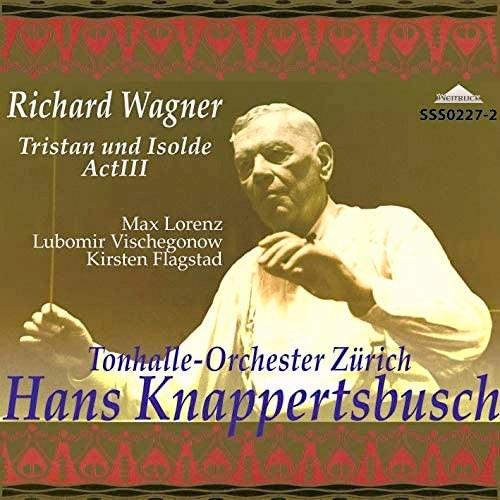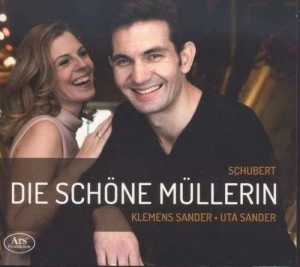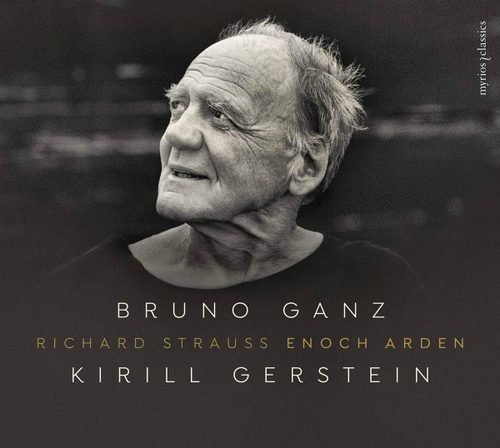Diese Leonore erweist sich als sehr anhänglich. 1976 in der Dresdener Lukaskirche eingespielt, wurde die Urfassung von Ludwig van Beethovens Fidelio von 1805 in die Gesamtausgabe seiner Werke auf Schallplatten eingegliedert, mit der in der DDR zum 200. Geburtstag des Komponisten auf Eterna begonnen wurde. Sie geht also auf die Fünfzig zu und hat sich erstaunlich frisch gehalten. Im Westen Deutschlands war sie bei der EMI/ Electrola erschienen. Edda Moser, die in den Osten ausgeliehene Titel-Sängerin der Titelpartie (daher die Vermarktung der Aufnahme auch in der BRD) ist nach wie vor eine gesuchte Gesprächspartnerin, wenn es um das Musiktheater geht. Längst gestorben sind Richard Cassily (Florestan), Theo Adam (Pizarro) und Karl Ridderbusch (Rocco). Noch immer am Pult steht gelegentlich der rüstige, 1927 geborene Herbert Blomstedt. Ein ideales jugendliches Paar sind Helen Donath und Eberhard Büchner als Marzelline und Jaquino. Reiner Goldberg, der es später als Florestan bis an die Metropolitan Opera schaffte, muss sich noch mit dem ersten Gefangenen bescheiden. Und für Siegfried Lorenz, der im Jahr darauf als Wolfram an der Berliner Staatsoper entdeckt wurde, fiel der zweite Gefangene ab. Die Aufnahme ist also aus vielerlei Gründen historisch. Klanglich ist sie es nicht. Im Gegenteil. Sie hat sich erstaunlich gut gehalten. Aus den Lautsprechern tönt es rasant und frisch. Bei ihrem ersten Erscheinen sorgte die Leonore als erste Einspielung der Version von 1805 noch für Furore. Kaum einer hatte bis dahin dies Oper so intensiv und so ausführlich gehört, geschweige denn diese Fassung gekannt. Die Überraschung war groß, als ein völlig eigenständiges Opus, das sich vom späteren Fidelio deutlich unterschied, zum Vorschein kam. Erst heuter wissen wir so viel mehr über den Werdegang der Oper und ihrer verschiedenen Erscheinungsformen.
 Naxos hat sich für seine Complete Edition, die es auf neunzig CDs bringt, diese Leonore gesichert und gut daran getan. Wer eine neue Aufnahme scheut und deshalb auf den Bestand zurückgreifen muss, hat keine sehr große Auswahl. Leonoren sind nicht häufig wie Fidelio, eine Naxos-Eigenproduktion von 1999. Als Leonore ist die 2008 verstorbenen Dänin Inga Nielsen zu hören, die in den Höhen ihrer großen Arie wunderbar aufblüht. Mit der von Michael Halász am Pult der Nicolaus Esterházy Sinfonia-Einspielung hat ihr Naxos ein würdiges Denkmal gesetzt. Prominenz ist mit Gösta Winbergh (Florestan), Alan Titus (Pizarro) und dem menschlich sehr berührenden Kurt Moll (Rocco) auch für andere Rollen aufgeboten. Naturgemäß sind die Erwartungen an so eine große Edition unterschiedlich. Die einen sind auf neue Interpretationsansätze der großen sinfonischen Werke aus, andere interessieren sich zuvörderst für das reiche kammermusikalische Schaffen, wieder andere hören zuerst die Lieder und dann die großen vokalen Werke. Oder sie werfen zunächst einen Blick auf die Ränder im Schaffen Beethovens, wo es noch immer vieles zu entdecken gibt. Ausgaben wie diese können Anstöße geben. Eine praktische optische Lösung erleichtert den Zugang. Die Covers der jeweiligen Werkgruppen sind an den Rändern mit eigenen Farben gekennzeichnet und stehen wie Karteikarten in der kastenähnlichen Box. Einundzwanzig laufende Zentimeter Beethoven. Im digitalen Zeitalter ist das sehr viel. Auf der Innenseite des Deckels ist der Bestand blockweise farblich gespiegelt und beschriftet: Orchestra (Rot), Concerto (Orange), Keyboard (Gelb), Chamber (Grün), Stage (Blau), Choral (Violett), Vocal (Rosa). Kammermusik ist der mit Abstand größte Posten.
Naxos hat sich für seine Complete Edition, die es auf neunzig CDs bringt, diese Leonore gesichert und gut daran getan. Wer eine neue Aufnahme scheut und deshalb auf den Bestand zurückgreifen muss, hat keine sehr große Auswahl. Leonoren sind nicht häufig wie Fidelio, eine Naxos-Eigenproduktion von 1999. Als Leonore ist die 2008 verstorbenen Dänin Inga Nielsen zu hören, die in den Höhen ihrer großen Arie wunderbar aufblüht. Mit der von Michael Halász am Pult der Nicolaus Esterházy Sinfonia-Einspielung hat ihr Naxos ein würdiges Denkmal gesetzt. Prominenz ist mit Gösta Winbergh (Florestan), Alan Titus (Pizarro) und dem menschlich sehr berührenden Kurt Moll (Rocco) auch für andere Rollen aufgeboten. Naturgemäß sind die Erwartungen an so eine große Edition unterschiedlich. Die einen sind auf neue Interpretationsansätze der großen sinfonischen Werke aus, andere interessieren sich zuvörderst für das reiche kammermusikalische Schaffen, wieder andere hören zuerst die Lieder und dann die großen vokalen Werke. Oder sie werfen zunächst einen Blick auf die Ränder im Schaffen Beethovens, wo es noch immer vieles zu entdecken gibt. Ausgaben wie diese können Anstöße geben. Eine praktische optische Lösung erleichtert den Zugang. Die Covers der jeweiligen Werkgruppen sind an den Rändern mit eigenen Farben gekennzeichnet und stehen wie Karteikarten in der kastenähnlichen Box. Einundzwanzig laufende Zentimeter Beethoven. Im digitalen Zeitalter ist das sehr viel. Auf der Innenseite des Deckels ist der Bestand blockweise farblich gespiegelt und beschriftet: Orchestra (Rot), Concerto (Orange), Keyboard (Gelb), Chamber (Grün), Stage (Blau), Choral (Violett), Vocal (Rosa). Kammermusik ist der mit Abstand größte Posten.
Obwohl mengenmäßig eine sehr kleine Abteilung, eröffnen die Sinfonie – traditionell von links – die Sammlung. Sie gelten als der Gipfel des Werkes von Beethoven, der vielleicht vollkommenste Ausdruck seiner Genialität. Generationen von Dirigenten haben sich daran versucht. Keine Interpretation gleicht der anderen. Die Zahl der Aufnahmen geht in die hunderte. Es grenzt an Wunder, dass immer neue Ansatzpunkte gefunden und herausgearbeitet werden. Naxos hat sich für einen seiner Hausdirigenten entschieden, den Ungarn Béla Drahos. Ursprünglich Flötist, erschien er 1992 erstmal selbst vor einem Orchester. Seine Liebe und Aufmerksamkeit gehört den musikalischen Details. Wie beim Fidelio spielt wieder die Nicolaus Esterházy Sinfonia. Deren Chor sowie Hasmik Papian (Sopran), Ruxandra Donose (Mezzo), Manfred Fink (Tenor) und Claudio Otelli kommen im Schlusssatz der „Neunten“ hinzu. In der Gruppe mit den Sinfonien finden sich die einzelnen Ouvertüren, „Wellingtons Sieg“, die „Musik zu einem Ritterballett“ sowie die diversen Tänze. Beim „Triumphmarsch zum Trauerspiel Tarpeja von Kuffner“ von 1813, der Seltenheitswert hat, tritt erstmals der charismatische finnische Dirigent Leif Segerstam mit dem Turku Philharmonic Orchestra hervor. Es existiert seit 1790 und gilt weltweit als einer der ältesten Klangkörper. Segerstam leitet es seit 2012 und setzt durch viele neue Einspielungen wichtige Akzente in der Edition.

Auch Berlin Classic hat die Leonore von 1976 aus dem eigenen Archiv hervorgeholt (0301499BC). Damit ist sie aktuell – Naxos und Brilliant Classics dazugezählt – gleich dreifach auf dem Markt. Das sollte genügen. Wer sie einzeln begehrt, muss also nicht die Editionen der Mitbewerber anschaffen. Berlin Classics entschied sich für die ursprüngliche originale Aufmachung des DDR-Label Eterna. Und was hat es nun mit dem Hinweis „Gesamtausgabe“ auf sich? Gemeint ist damit nicht die vollständige Einspielung dieses Vorläufers von Fidelio. Zum 200. Geburtstag Beethovens war in der DDR eine Gesamtausgabe seiner Werke auf Schallplatten in Angriff genommen worden, die es zu erstaunlicher Fülle brachte. Sie wurde über den Anlass hinaus immer wieder ergänzt und um neue Produktionen erweitert ohne letztlich den Anspruch einer vollständigen Werkaufgabe zu erfüllen. Ihr durchgängiges äußeres Markenzeichen waren Fresken und Zeichnungen von Michelangelo, die einen hohen Wiedererkennungswert garantierten. Der Klang dieser Wiederauflage lässt keine Wünsche offen. Der nachträglichen Erläuterung bedarf die Nennung von Gunther Emmerlich als Erzähler (Narrator) auf der Rückseite des Albums. Es gibt in dieser Produktion keinen Erzähler. Der Dresdener Bassist und Entertainer übernahm für den Florestan des Amerikaners Richard Cassily dessen knappe Dialoge, während alle anderen Sängerinnen und Sänger selbst sprachen. R.W.
Der Tarpeja-Marsch leitet den zweiten Akt der Tragödie ein, in deren Mittelpunkt die Vestalin Tarpeja steht, die den Sabinern, die unter dem Kommando ihres Königs Titus Tatius Rom angriffen hatten, den Zugang zum Kapitol gewährte. Im Gegenzug sollte sie das bekommen, was die Sabiner am linken Arm trugen. Sie dachte an Goldschmuck. Die Sabiner aber griffen zu einer List, indem sie die Vestalin unter ihren Schilden begruben, die sie ebenfalls am linken Arm hielten. In Erinnerung an ihren Verrat heißt der Felsen des Kapitols, über den später Verräter zu Tode gestürzt wurden, Tarpejischer Felsen. Christoph Kuffner lebte zwischen 1780 und 1846 in Wien. In seinem Trauerspiel griff er lediglich Motive des Mythos auf, der noch in einer modifizierten Form überliefert ist. Es ging 1813 nur einmal über die Bühne und verschwand danach in der Versenkung. Komponist und Dichter kannten sich gut. Von Kuffner stammt auch der Text zur Chorfantasie, mit dem Beethoven nicht zufrieden gewesen sein soll. Dargeboten wird das beliebte Werk federnd und schwungvoll von den Gesangssolisten Claire Rutter, Matilde Wallevik, Marta Fontanals-Simmons, Peter Hoare, Julian Davies, Stephen Gadd, dem City of London Choir und dem Royal Philharmonic Orchestra unter Hilary Davan Wetton. Am Klavier sitzt Leon McCawley. Bis auf Davis und Fontanals-Simmons ist dieses Ensemble auch bei der Kantate „Der glorreiche Augenblick“ im Einsatz, die Beethoven zur Eröffnung des Wiener Kongresses am 1. November 1814 schuf und die bis heute angesichts der Huldigung der Aristokratie umstritten ist, in der sich aber auch ein aufschlussreicher Ausspruch zur künftigen Bestimmung Wiens findet: „Europa bin ich – und nicht mehr eine Stadt.“ Wenn es nach Emanuel Schikaneder, dem Librettisten von Mozarts Zauberflöte gegangen wäre, hätte auch Beethoven einen Text von ihm komponiert: „Vestas Feuer“, ebenfalls eine Vestalinnen-Geschichte. Er vertonte lediglich die erste Szene und ließ den Plan wieder fallen. Segerstam begleitet für die elf Minuten ein Vokalquartetts aus Kaisa Ranta, Niina Keitel, Tuomas Katajala und Nicholas Söderlund. Leonore, die wenig später in Angriff genommen wurden, kündigt sich an. Ranta, Keitel, Söderlund, erweitert um den Tenor Topi Lehtiuu bilden das Solistenensemble bei der C-Dur-Messe, die wiederum von Segerstam betreut wird.
Naxos hat wichtige Bestandteile der Edition, darunter die Messe – teils in anderer Zusammenstellung – auch einzelnen veröffentlicht. Das ist praktisch und kundenfreundlich. Es muss nicht gleich das Gesamtpaket anschaffen, wer nur ein ganz bestimmtes Stück haben will. Für die Schauspielmusik zu Dunkers Drama „Leonore Prohaska“ gilt das allerdings nicht. Einzeln ist sie nur bruchstückhaft gemeinsam mit „König Stephan“ auf den Markt gelangt. Komplett findet sie sich ist nur in der Edition. Immerhin wird eine neue Produktion geboten, was höchst verdienstvoll ist. Die 1785 in Potsdam geborene Unteroffizierstochter hatte sich ein männliche Identität zugelegt und sich 1813 unter dem Namen August Renz Zugang zum Lüzowschen Freikorps verschafft. Noch im selben Jahr wurde sie so schwer verwundet, dass sie wenig später starb. Ihr Schicksal hat der Königlich Preußische Geheimsekretär Friedrich Duncker 1815 in einem Schauspiel dargestellt, zu dem Beethoven die Musik schrieb. Das Drama ist verschollen. Überlebt haben lediglich die von Beethoven vertonten drei Szenen sowie ein Trauermarsch. Als Melodram, begleitet von einer Glasharmonika, ist die Abschiedsszene der Leonore angelegt. Naxos hat sie in künstlerischer Personalunion dem französischen Komponisten Thomas Bloch übertragen. Er gilt als gesuchter Experte für historische Instrumente. Reetta Haavisto singt das von einer traditionellen Harfe begleitete Lied innig.
Für die Schauspielmusik zu Goethes „Egmont“ gönnte sich Naxos ebenfalls eine neue Produktion mit Segerstam und seinem Orchester. Sie wirkt erdenschwer und wuchtig, teils sogar etwas rau und setzt sich dadurch von anderen Interpretationen deutlich ab. Zusätzlich wird die Andersartigkeit dieser Einspielung noch durch die Besetzung mit Matti Salminen verdeutlicht, dem sein gewaltiger Bass der Sprechrolle etwas im Wege zu stehen scheint. Ein anrührendes Clärchen ist Kaisa Ranta. Made in Finnland mit Segerstam und bereits anderweitig in Erscheinung getretenen Solisten, sind auch die „Kantate auf die Erhebung Leopold II. zur Kaiserwürde“, „Christus am Ölberge“ sowie die „Kantate auf den Tod Kaiser Joseph II.“, während für die „Missa Solemnis“ auf eine Produktion mit Lori Phillips (Sopran), Robynne Redmon (Mezzo), James Taylor (Tenor), Jay Baylon (Bassbariton) und dem Nashville Symphony Orchestra and Chorus unter Kenneth Schermerhorn zurückgriffen wurden, die bereits 2004 bei Naxos erschien. Bereits separat auf den Markt gebracht und von Operalounge ausführlich besprochen stechen „König Stephan“ und „Die Ruinen von Athen“ als die Highlights der Edition hervor. Großer Verbreitung auf Tonträgern und im Konzertsaal erfreuen sich die Ouvertüren zu diesen Festspielen. Auch die einzelnen musikalischen Nummern – Chöre, Zwischenmusiken, Märsche, Arien, Duette – sind nicht nur einmal vollständig aufgenommen worden. Naxos legt erstmals die kompletten Werke vor, zur Musik auch den gesprochenen Text. So gehört sich das in einem Gedenkjahr. Beethoven hatte die Bühnenmusiken für das neue Theater in Pest, das seinerzeit noch eine selbstständige Stadt war und erst 1873 mit den ebenfalls eigenständigen Buda zu Budapest zusammengelegt wurde, komponiert. Revolutionäre Theaterstücke, die dem Freiheitsgedanken huldigen wie Fidelio oder die 9. Sinfonie, sind nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Dem Anlass gemäß werden Pathos und Heldenverehrung historisch verbrämt und mit antiker Garnierung gereicht. Auch das ist Beethoven. Er lebte von Aufträgen. Ohne die Eibettung in das Gesamtwerk bleiben die musikalischen Nummern unverständlich. Andererseits ist es schwer vorstellbar, diese Schöpfungen einem heutigen Publikum bei einer öffentlichen Aufführung zuzumuten. Umso verdienstvoller ist es, die Stück als Ganzes wenigstens in dieser Form zugänglich zu machen, zumal in einem Jubiläumsjahr, in dem solche Ausgrabungen mehr wiegen sollten als eine neue Einspielung aller Sinfonien. Zu danken ist die Ausgrabung wiederum Leif Segerstam, dem Chorus Cathedralis Aboesis und dem Turku Philharmonic Orchestra. Es war eine glückliche Wahl, für beide Werke deutschsprachige Schauspieler zu verpflichten. Sie garantieren die Textverständlichkeit: Angela Eberlein,Claus Obalski, Roland Astor, Ernst Oder. Die drei Gesangspartien in den „Ruinen von Athen“, das griechische Mädchen, der Grieche sowie der Hohepriester sind mit Reetta Haavisto und Juha Kotilainen besetzt.
Allein sieben CDs werden für die irischen, walischen, schottischen und englischen Songs gebraucht, die in Konzerten ein Schattendasein führen, in Editionen aber respektvoll behandelt werden. Portionsweise sind sie sehr gut anzuhören. Naxos hat verschiedene Quellen angezapft. Die Reihe der Namen der Sänger ist lang. Antonia Bourvé, Rebekka Stöhr, Haakon Schaub, Georg Poplutz, Rainer Trost, Paul Armin Edelmann vertreten die aktive Generation. Die Seniorenabteilung ist von Sängern, die in der DDR sehr populär waren, belegt, darunter der inzwischen dreiundneunzigjährige Günther Leib, Eberhard Büchner und Ingeborg Springer, die die achtzig erreicht haben, sowie der Mittsiebziger Siegfried Lorenz. Etwa gleichalt ist die Engländerin Pamela Coburn, die sich klassischer Lieder annimmt. Bereits seit mehr als zwanzig Jahren tot ist Hermann Prey, der sich mit „Adelaide“ und dem Zyklus „An die ferne Geliebte“ auf den Höhnen von Beethovens Liedkunst bewegt als könnte ihm niemand das Wasser reichen. Berücksichtigt sind unterschiedliche Fassungen von Liedern. Von „Sehnsucht“ nach Goethe gibt es deren vier. Auch Clärchens „Freudvoll und leidvoll“ aus dem Egmont existiert zusätzlich in drei Versionen mit Klavierbegleitung.
Obwohl – wie erwähnt—die Kammermusik der größte Brocken ist, übersteigt es den Rahmen dieser Betrachtung, alle Werke und Mitwirkenden zu nennen. Nur so viel: Die Streichquartette werden vom Kodály Quartet gespielt. Es handelt sich um eine Aufnahme aus den späten neunziger Jahren. Interpret der mit Abstand meisten Klaviersonaten ist der Ungar Jenö Jandó, unterstützt vom israelischen Pianisten Boris Giltburg. Ein durch und durch europäisches Projekt sind die fünf Klavierkonzerte mit dem Österreicher Stefan Vlader als Solist und der vom englischen Dirigenten Barry Wordsworth geleiteten Capella Istropolitana aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Die Slowakische Philharmonie unter der Leitung von Kenneth Jean spielt mit der Japanerin Takako Nishizaki das Violinkonzert (Naxos 90 CDs 8.500250 /weitere Information zu den CDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.).
Wer hat, der hat. Ein anderes Etikett. Und schon wird aus der von Brilliant Classics bereits vor einiger Zeit herausgegeben Ludwig-van-Beethoven-Edition eine aktuelle Würdigung zu seinem 250. Geburtstag. Auf 85 CDs ist nach Angaben des Labels das Gesamtwerk des Komponisten gebannt. Nicht ganz. Wer ganz genau hinschaut und die Track-Listen durchforstet, findet immer eine Lücke. Und sei sie noch so klein. Wo ist Leonore Prohaska mit den Bruchstücken aus der Schauspielmusik? Dafür finden sich in der Edition die kompletten musikalischen Teile der 1812 in Pest, das damals noch nicht mit Buda zu Budapest verbunden war, uraufgeführten Festspiele König Stephan und Die Ruinen von Athen. Hans Hubert Schoenzeler leitet den Berliner Konzertchor und die Berliner Symphoniker. Ein Wiederhören gibt es mit der packenden Egmont-Musik wie sie 1970 für das DDR-Label Eterna mit der Staatskapelle Berlin unter Heinz Bongartz, der Sopranistin Elisabeth Breul und dem Schauspieler Horst Schulze eingespielt wurde. Diese Aufnahme hat insofern besonderen historischen Wert, weil sie schon einmal zu einer Jubiläumsedition gehörte, die zum 200. Geburtstag Beethovens in der DDR herauskam.
 Gleiches gilt für eine Arien-CD, deren Inhalt auch zu dieser Sammlung gehörte, die auch über das Jahr 1970 hinaus vervollständigt wurde. Die Solisten Hanne-Lore Kuhse, die unter anderen „Ah! Perfido“ und „Primo amore“ singt, Eberhard Büchner und Siegfried Vogel. Die Leitung hat Arthur Apelt, ein Kapellmeister alter Schule, dem das Publikum der Staatsoper Unter den Linden bewegende Aufführungen zu danken hatte. Für die Kantaten Auf den Tod Josephs II. und Auf die Erhebung Leopolds II. zur Kaiserwürde wurden Mitschnitte aus Tallinn mit dem von Tönu Kaljuste geleiteten Estonia National Symphony Orchestra, Fiona Cameron (Sopran), Teele Jöks (Mezzo), Mati Körts (Tenor) und Leonid Savitski (Bass) gewählt, die deutlicher hätten gesungen werden können, der Edition aber einen gewissen europäischen Touch verleihen. Aus Lugano wird – ebenfalls als Mitschnitt – die Kantate Der Glorreiche Augenblick, die mit dem Ausruf „Europa steht!“ anhebt, beigesteuert. Sie wurde bekanntlich zur Eröffnung des Wiener Kongresses 1814 komponiert. Das Solistenquartett setzt sich hier aus Alla Simoni, Francesca Pedaci, Jeremy Ouvenden und Robert Gierlach zusammen. Dirigent von Chor und Orchester des Schweizerischen Rundfunks ist Diego Fasolis, der sich als Spezialist für Barockmusik einen Namen gemacht hat. In sprachlicher Umkehrung tragen Eike Heilmann (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), Daniel Johannsen (Tenor) und Manfred Bittner – allesamt deutschsprachig – begleitet von Elisabeth Grünert am Klavier „Mehrstimmige italienische Gesänge“ vor. Diese Sänger sind auch mit Vokalwerken wie dem Opferlied und dem Hochzeitslied beschäftigt, während die Provenienz der Kantate Meeresstille und Glückliche Fahrt bis nach Minnesota reicht. Dem Saint Louis Symphony Chorus an Orchestra mit dem Dirigenten Jerzy Semkow und dem Pianisten Walter Klien ist die berühmte Chorfantasie anvertraut. Für den entschlossenen finalen Gesang „Es ist vollbracht“ des Singspiels Die Ehrenpforten wurde wieder auf DDR-Bestände zurückgegriffen. In der Blüte seiner Karriere ist der Bassist Siegfried Vogel zu hören. Der Text zu diesem Singspiel stammt von Georg Friedrich Treitschke, der auch das Fidelio-Libretto verfasste.
Gleiches gilt für eine Arien-CD, deren Inhalt auch zu dieser Sammlung gehörte, die auch über das Jahr 1970 hinaus vervollständigt wurde. Die Solisten Hanne-Lore Kuhse, die unter anderen „Ah! Perfido“ und „Primo amore“ singt, Eberhard Büchner und Siegfried Vogel. Die Leitung hat Arthur Apelt, ein Kapellmeister alter Schule, dem das Publikum der Staatsoper Unter den Linden bewegende Aufführungen zu danken hatte. Für die Kantaten Auf den Tod Josephs II. und Auf die Erhebung Leopolds II. zur Kaiserwürde wurden Mitschnitte aus Tallinn mit dem von Tönu Kaljuste geleiteten Estonia National Symphony Orchestra, Fiona Cameron (Sopran), Teele Jöks (Mezzo), Mati Körts (Tenor) und Leonid Savitski (Bass) gewählt, die deutlicher hätten gesungen werden können, der Edition aber einen gewissen europäischen Touch verleihen. Aus Lugano wird – ebenfalls als Mitschnitt – die Kantate Der Glorreiche Augenblick, die mit dem Ausruf „Europa steht!“ anhebt, beigesteuert. Sie wurde bekanntlich zur Eröffnung des Wiener Kongresses 1814 komponiert. Das Solistenquartett setzt sich hier aus Alla Simoni, Francesca Pedaci, Jeremy Ouvenden und Robert Gierlach zusammen. Dirigent von Chor und Orchester des Schweizerischen Rundfunks ist Diego Fasolis, der sich als Spezialist für Barockmusik einen Namen gemacht hat. In sprachlicher Umkehrung tragen Eike Heilmann (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), Daniel Johannsen (Tenor) und Manfred Bittner – allesamt deutschsprachig – begleitet von Elisabeth Grünert am Klavier „Mehrstimmige italienische Gesänge“ vor. Diese Sänger sind auch mit Vokalwerken wie dem Opferlied und dem Hochzeitslied beschäftigt, während die Provenienz der Kantate Meeresstille und Glückliche Fahrt bis nach Minnesota reicht. Dem Saint Louis Symphony Chorus an Orchestra mit dem Dirigenten Jerzy Semkow und dem Pianisten Walter Klien ist die berühmte Chorfantasie anvertraut. Für den entschlossenen finalen Gesang „Es ist vollbracht“ des Singspiels Die Ehrenpforten wurde wieder auf DDR-Bestände zurückgegriffen. In der Blüte seiner Karriere ist der Bassist Siegfried Vogel zu hören. Der Text zu diesem Singspiel stammt von Georg Friedrich Treitschke, der auch das Fidelio-Libretto verfasste.
Die Oper selbst kommt als Live-Produktion des London Symphony Orchestra von 2006 aus London. Colin Davis, der die Oper bereits für RCA aufnahm, hat die musikalische Leitung. Er lässt sich viel Zeit und zelebriert das Quartett wie ein kleines Drama im Drama. Die Wirkung ist hin, wenn sich die Sänger – allesamt des Deutschen hörbar nicht mächtig – an den Dialogen abarbeiten müssen. Christina Brewer ist die Leonore, Sally Metthews die Marzelline, John Mac Master der Floresten, Kristinn Sigmundsson der Rocco. Den Pizarro singt Juha Usitalo, Daniel Borowski den Minister und Andrew Kennedy den Jaquino. Als gute alte Bekannte hält – wie auch bei Naxos – die Leonore Einzug in der Edition. Dass es sich dabei um die Erstfassung des Fidelio von 1805 handelt, wird vorausgesetzt – und nicht mehr erwähnt. Als diese deutsch-deutsche Gemeinschaftsproduktion neu auf den Markt kam, war der Hinweis auf die Fassung die entscheidende Information. Edda Moser (Leonore), Helen Donath (Marzelline), Richard Cassily (Florestan) und Karl Ridderbusch (Rocco) kamen aus dem Westen zu den Aufnahmesitzungen 1976 in der Dresdener Lukaskirche. Die DDR stellte mit Theo Adam den Pizarro, mit Hermann Christian Polster den Ferrando und mit Eberhard Büchner den Jaquino. Rainer Goldberg, der später selbst ein berühmter Florestan werden sollte, sang neben Siegfried Lorenz einen der beiden Gefangenen. Ein Heimspiel hatte die Staatskapelle Dresden, während aus Leipzig der Rundfunkchor angereist war. Bis auf Cassilly, der von dem Dresdner Bassisten Gunter Emmerlich gedoubelt wird, sprechen die Sänger die Dialoge selbst, was bei Brilliant Classic auch unter den Tisch fällt. Horst Seeger, der für sein mehrfach im Henschel aufgelegtes Opernlexikon noch immer geschätzt ist, führte Regie. Um der Sprachmelodie Willen gibt es nur kleine Änderungen am Originaltext. 1973 in Leipzig eingespielt, hat auch die Missa Solemnis ihren Platz in diversen Katalogen behauptet. Als Sopran war Anna Tomowa-Sintow verpflichtet worden, die auf dem Sprung in die internationale Karriere war, die Peter Schreier bereits eingeschlagen hatte. Annelies Burmeister, in Bayreuth als Fricka geschätzt, ist der Alt, Polster, dessen Name bereits als Don Ferrando gefallen war, der Bass. Dabei ist wiederum der Leipziger Rundfunkchor. Am Pult des Gewandhausorchesters steht dessen damaliger Chef Kurt Masur. Mehr als zwanzig Jahre später entstand die Einspielung der Messe in C-Dur mit der Gächinger Kantorei und dem Bach-Collegium Stuttgart unter Helmuth Rilling. Die Solisten sind Katherine von Kampen (Sopran), Ingeborg Danz (Alt), Keith Lewis (Tenor) und Michel Brodard (Bass). Christus am Ölberge ist eine Ausgrabung von 1963, die zunächst nur bei Vox auf Vinyl in Umlauf war, später beim Label Concerto Royale auf CD gelangte. Dirigent des einzigen Oratoriums von Beethoven ist Josef Bloser, der fast nur im Zusammenhang mit dieser Aufnahme Erwähnung findet. Er leitet die Stuttgarter Philharmoniker. Liselotte Rebmann trägt die Sopranpartie des Seraph etwas spitz vor. Tiefgang als Jesus lässt Reinhold Bartel vermissen, der vornehmlich in Operetten unterwegs war. Er hat sich zu einer betont irdischen Deutung entschlossen hat. Den Petrus singt August Messthaler, dem auf Rückseite der entsprechenden CD (72) die letzten beiden Buchstaben genommen sind. In Grenzen hält sich die Klangqualität besonders in den Chorpassagen. Nun die Lieder. Wieder hat sich Brilliant bei alten DDR-Beständen bedient und ist mit einer der schönsten Deutungen des Zyklus An die Geliebte fündig geworden, der den Gipfel von Beethovens Liedschaffen markiert und zu seinen populärsten Schöpfungen gehört. Solist ist Peter Schreier, der nie schöner gesungen hat als in dieser Aufnahme. Auf dem Höhepunkt seiner Kunst war er Ende der 1960er Jahre mit Walter Olbertz ins Studio gegangen, der den schwierigen Klavierpart mit Leichtigkeit und bei der Wahl des Tempos überraschende Lösungen anbieten. Beide harmonieren auch bei zahlreichen anderen Nummern, verteilt über drei CDs. Dass auch die ewig junge Adelaide dabei ist, versteht sich von selbst. Unverständlich hingegen ist es, die Sopranistin Adele Stolte bei einem Duett mit italienischem Text nicht namentlich zu erwähnen. Die Mezzosopranistin Anna Haase bringt auf der CD, die sie mit dem Bariton Florian Prey bestreitet, in Erinnerung, dass es auch ein Lied „An den fernen Geliebten“ gibt. Diese von Norbert Groh pianistisch begleitete Zusammenarbeit ist eine Spurensuche nach seltenen Titeln. So hat Beethoven auch seine Mignon auf den Text von Goethe komponiert und sich bei dem Dichter auch für „Neue Liebe, neues Leben“, „Sehnsucht“ sowie für „Der edle Mensch ist hülfreich und gut“ bedient. Ein Kapitel für sich sind im Werke Beethovens sind Bearbeitungen schottischer, irischer und walischer Volkslieder, die über sieben CDs verteilt sind. Auftraggeber war der in Edinburgh ansässige Sammler und Verleger Georges Thomson. Rückbesinnungen auf Volkslieder waren in der Romantik weit verbreitet, entsprechen dem Geist der Zeit. Beethoven verstand die Arbeiten, die zwischen 1815 und 1818 in Wien entstanden, vor allem als Broterwerb. Ein finanzieller Erfolg dürften sie für den Verleger trotz des berühmten Tonsetzers nicht gewesen sein. Noch 1821 klagte Thomson einem bei Wikipedia zitierten Brief: „Ich gebe mich nicht der Erwartung hin, jemals einen Gewinn aus dem zu ziehen, was Beethoven für mich geleistet hat; er komponiert für die Nachwelt. Ich hatte gehofft, sein Genius würde sich hinabneigen und sich dem schlichten Charakter der Nationalmelodien anpassen, doch er erwies sich im allgemeinen als zu gelehrt und zu exzentrisch für meine Zwecke und alle meine Golddukaten … waren weggeworfenes Geld.“ Unter den zahlreichen Solisten sind Renate Krahmer, Antonia Bourvé, Dorothee Wohlgemuth, Barbara Emilia Schedel (Sopran), Ingeborg Springer, Kerstin Wagner, Christine Wehler, Rebekka Stöhr (Mezzosopran bzw. Alt), Eberhard Büchner, Daniel Schreiber, David Mulvenna Hamilton, Georg Poplutz, Armin Ude (Tenor), Haakon Schaub, Günther Leib, Jens Hamann, Siegfried Lorenz, Daniel Raschinsky (Bariton bzw. Bassbariton). Die den vokalen Werken gewidmete Ausführlichkeit will die Proportionen im Schaffen Beethovens nicht verschieben. Es ist so gewollt, weil sich Operalounge – wie es der Name schon sagt – vornehmlich dem Gesang verschrieben hat. Gemessen am Volumen von CDs werden zwei Drittel für Sinfonik, Konzerten und Kammermusik in Anspruch genommen. Im Zentrum stehen dabei nach wie vor die neun Sinfonien. Die Wahl fiel auf die von Herbert Blomstedt betreute Einspielung der Staatskapelle Dresden, die sich von 1976 bis von 1980 hinzog. Blomstedt war zu dieser Zeit Chefdirigent. Helena Döse, Marga Schiml sind die Damenbesetzung, Schreier und Adam – wie in Dresden dieser Jahre nicht anders zu erwarten, die Herrenriege. Alfred Brendel, spielt die Klavierkonzerte, die er mehrfach aufgenommen hat und ist auch mit dem Klaviersonaten vertreten. In dieser frühen Produktion wird er von den Wiener Symphonikern unter Heinz Wallberg (1 bis 4) und Zubin Mehta (5) begleitet. Mit dem Violinkonzert und den beiden Romanzen für Violine und Orchester ist die niederländische Geigerin Emmy Verhey zu hören. Stanislaw Skrowacewski dirigiert das Minnesota Orchestra bei diversen Ouvertüren – und nun kommt sie am Ende doch noch ins Spiel: beim Trauermarsch aus Lenore Prohaska (Brilliant Classics 85 CDs 95510). Rüdiger Winter