Heute mehr als früher scheint Siegfried Wagners Homosexualität ein brennendes Thema, wann immer man von Siegfried Wagner spricht – vielleicht zu sehr seine Verdienste als Komponist, Organisator und Dirigent überdeckend? Heute, wo Personen des öffentlichen Lebens schon beim geringsten Anzeichen sogar im Staats-Fernsehen geoutet werden und das Privatleben eines Donald Trump grelle Schlagzeilen produziert, ist Intimes von öffentlichem Interesse, oft überproportional und auf Kosten der Betroffenen, so auch hier.

Das Foto ist ein Screenshot auf dem ZDF-Film „Der Wagner Clan – eine Familiengeschichte“, der in Kooperation mit dem ORF 2014 im deutschen ZDF lief und als DVD zu beziehen ist (Mona-Film).
Dennoch – das Leben und die Lebensumstände dieses so im immer wieder publizierten Bannkreis der Bayreuther Familie Stehenden nun mit einer eigenen Ausstellung (zudem erstmals in Berlin) nachzuvollziehen, ist ein reizvolles Projekt, dem sich das Schwule Museum in Berlin bis zum Ende Juni 2017 mit einer umfangreichen Ausstellung widmet. Wir berichteten darüber.
Noch bevor die Pläne zur Berliner Ausstellung bekannt wurden baten wir den Autor und Professor für vergleichende Literaturwissenschaften Nikolai Endres um die Genehmingung zum „Nachdruck“ seines Artikels zur Homosexualität Siegfried Wagners, den er bereits in den Mitteilungen der Internationalen Siegfried Wagner Gesellschaft veröffentlicht hatte. Wir danken ihm und der Gesellschaft (Achim Bahr) für die Erlaubnis, fügen doch Nikolai Endres´ Ausführungen eine wichtige Facette dem Gesamtbaild dieses in seiner Zeit gefangenen Mannes, Siegfried Wagner, hinzu.

Siegfried Wagner (nebenstehend in einer für die Zeit bemerkenswert knappen Badehose/ Foto Flyer Schwules Museum Berlin/ Internationale Siegfried Wagner Gesellschaft) wurde am 6. Juni 1869 als Sohn von Richard Wagner und Cosima von Bülow geboren. (Cosima war noch offiziell mit Hans von Bülow verheiratet.) Nietzsche war bei der Geburt präsent und Ludwig war Siegfrieds Taufpate. Mit einem berühmten Vater und ebenso illustren Großvater (Franz Liszt) schien alles auf eine großartige Karriere hinauszulaufen. Erstes Interesse an Architektur wich dem Studium der Musik. Insgesamt 18 Opern hat Siegfried komponiert und ab 1896 dirigierte er in Bayreuth, dessen künstlerischer Direktor er von 1908 – 1930 war. Siegfried lebte seine Homosexualität mehr oder weniger offen aus. Er nahm mit Vorliebe an Männertreffen teil, wo zum Beispiel Platons Gastmahl auf griechisch rezitiert wurde. Kleinere Skandale wurden immer wieder entschärft und Erpresser wurden mit Geld zum Schweigen gebracht. Im Jahr 1914 kam es dann anders. Maximilian Harden, der schon 1906 – 1909 durch die berüchtigte Eulenburg-Affäre einige von Kaiser Wilhelm II engsten Freunden und Beratern zum Fall gebracht hatte (siehe dazu mein Artikel The Eulenburg Affair Scandalizes Germany’s Leadership), drohte Siegfried bloßzustellen.
Prinz Philipp zu Eulenburg spielt übrigens eine interessante Rolle in der Wagner-Saga. Am Morgen des 14. Juni 1886 war er einer der ersten, der Ludwigs Leiche sah, nachdem der tote König ans Ufer des Starnberger Sees geschwemmt wurde. Er hat diesen Tag in Das Ende König Ludwigs II und andere Erlebnisse festgehalten. (Unerwähnt bleibt, dass Eulenburg damals mit einem Fischer gerudert war, der später vor Gericht zugab, mit Eulenburg Sex gehabt zu haben.) 1901 hat Eulenburg Houston Stewart Chamberlain, der Gatte von Siegfrieds Schwester Eva, Kaiser Wilhelm II vorgestellt, der tief beeindruckt war von Chamberlains rassistischem Weltbild.

Siegfried Wagner/ Zeichnung von Clement Harris/ Foto entnommen aus dem Standardwerk zu Siegfried Wagner von Peter P. Pachl: Siegfried Wagner – Genie im Schatten“, Nymphenburg 1988
Hardens Artikel »Tutte le corde: Siegfried und Isolde« in der Wochenzeitschrift Die Zukunft (27. Juni 1914) wurde durch Isoldes Vaterschaftsklage ausgelöst. Obwohl die Geburtsurkunde Hans von Bülow als ihren Vater aufweist, ist sich die Wagner-Forschung ziemlich einig, dass Richard Isolde gezeugt hat. Außerdem hatte Isolde, im Gegensatz zu Cosimas anderen Kindern, einen Sohn geboren: Franz Wilhelm Beidler (1901 – 1981). Als Isolde ihren Prozess aufgrund eines Meineids Cosimas verlor (in den Zeiten vor DNA war die Geburtsurkunde bindend), begann Harden mit seinen Ermittlungen.
Der 44-jährige Siegfried – immer noch Junggeselle – war das perfekte Opfer. Harden macht keine direkten Vorwürfe, aber er wundert sich, warum so viele Gerüchte herumschwirren, und spielt dann auf einen Heiland aus andersfarbiger Kiste an (mit Kiste ist wohl das Hinterteil der Männer gemeint und andersfarbig bezieht sich anscheinend auf den Euphemismus für Schwule als vom anderen Ufer). Als Siegfried von Isolde mit seiner Sexualität konfrontiert wurde, antwortete er: »Dem größten Könige aller Zeiten, Friedrich dem Großen, wurde auch Übles nachgesagt, und Preußen wurde groß und stark durch ihn! Also sorgt nicht! Ich entweihe das Festspielhaus nicht!« Jetzt gab es nur noch einen Ausweg: Eheschließung.
Bei den Bayreuther Festspielen im Jahr 1914 wurde die 17-jährige Winifred Klindworth Siegfried vorgestellt. Nach der Hochzeit 1915 kamen vier Kinder auf die Welt: Wieland (1917 – 1966), Friedelind (1918 – 1991), Wolfgang (1919 – 2010) und Verena (1920). Mit zwei Söhnen und zwei Töchtern in schönem Jahresabstand hatte Siegfried wohl seine Schuldigkeit getan. Als Winifred sich in den Schriftsteller Hugh Walpole verliebte, war Siegfried wenig beunruhigt, denn Hughs sexuelle Wünsche stimmten mit seinen eigenen überein.

Die große Liebe? Clement Harris/ Foto entnommen aus dem Standardwerk zu Siegfried Wagner von Peter P. Pachl: Siegfried Wagner – Genie im Schatten“, Nymphenburg 1988
Siegfried starb am 4. August 1930. Winifred übernahm die Leitung der Festspiele bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Schon 1923 hatte sie Adolf Hitler getroffen, als er Villa Wahnfried besucht hatte. Als Hitler für seine Beteiligung am Münchner Putsch im Gefängnis saß, schickte Winifred ihm – so will es auf jeden Fall die Legende – Papier, worauf er dann Mein Kampf verfasst hat. Nach der Machtergreifung gab es sogar Gerüchte über eine bevorstehende Heirat zwischen den beiden. Hitler war oft zu Gast bei der Familie Wagner und unterstützte finanziell die Festspiele. Winifreds Rolle im Dritten Reich bleibt kontrovers. Siegfried fand den radikalen Antisemitismus seiner Frau abstoßend und Friedelind erinnerte sich an ihren Vater als einen »Verfechter für Toleranz und Mitgefühl.« Allerdings muss man zugeben, dass Winifred für einige von Siegfrieds schwulen Freunden eingetreten ist und sie vor dem Konzentrationslager gerettet hat. Die Zeugenaussagen von zwei Sängern, Max Lorenz und Herbert Janssen, wirkten sich in Winifreds Entnazifizierungsverfahren nach dem Krieg strafmindernd aus. Später kümmerte sie sich um den verarmten früheren Intendanten des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, Hans Severus Ziegler, was ihr den Spitznamen Gluckhenne aller Schwulen einbrachte. Sie starb 1980 im Alter von 82 Jahren.
Siegfried wurde von einer Anzahl von dominanten Frauen aufgezogen: seine Mutter, seine Halbschwestern Daniela und Blandine, und seine Schwestern Isolde und Eva. Als Student in Frankfurt verkleidete er sich manchmal als prima ballerina. Selbst 1926 (als Siegfried fast sechzig war) machte der 28-jährige Joseph Goebbels, Hitlers späterer Propagandaminister, folgende Eintragung in sein Tagebuch: »Siegfried ist so schlapp. Pfui! Soll sich vor dem Meister schämen … Feminin. Gutmütig. Etwas dekadent. So etwas wie ein feiger Künstler.«

Mehr als nur gute Freunde? Siggi & Henry: Siegfried Wagner und Freund Henry Thode/ Foto entnommen aus dem Standardwerk zu Siegfried Wagner von Peter P. Pachl: Siegfried Wagner – Genie im Schatten“, Nymphenburg 1988
In Siegfrieds zwanziger Jahren war Clement Harris (1871 – 1897) sein engster Freund. Unter anderem hat Harris den jungen Siegfried im Portrait gemalt und war ein literarischer Jünger von Oscar Wilde (Harris unterhielt und belehrte Wilde, indem er ihm Wagner auf dem Klavier vorspielte). Als sie via London zu einer Weltreise aufbrachen, wurde Siegfried Wilde vorgestellt. Siegfried nahm zur Kenntnis, dass Wilde zwar sehr berühmt sei und mit seinen Paradoxien alle zum Lachen bringe, aber obwohl er sich in Vielem gut auskenne, sei er doch eher ein Poseur. Trotzdem lud Siegfried bei dieser Gelegenheit Wilde und Pierre Louÿs nach Bayreuth ein, doch aus diesem Vorhaben wurde nichts. (Zufällig kam dann Siegfried 1895 nach London zurück, als Tage zuvor der letzte Wilde Prozess zu Ende ging und Wilde wegen »gross indecency« für zwei Jahre ins Gefängnis musste.)
In seiner Autobiographie (1923) erinnert sich Siegfried gerne an sein »Clementchen« und gibt sogar einige Aufschlüsse über die Tiefe ihrer Beziehung. Zum Beispiel teilten sie sich ein Bett wie Orestes und Pylades, ein gleichgeschlechtliches Liebespaar aus der griechischen Mythologie. In Singapur fanden sie ein Stück Paradies, aber eben nur für Männer, denn sie fühlten sich wie zwei Adame und badeten dort nackt. In einer Stelle in dem privat gedruckten Reisetagebuch, die in der offiziellen Fassung gestrichen wurde, beschreibt Siegfried ihren Abschied: »äußerlich möglichst englisch … innerlich aber so herzlich und innig, wie wir uns jetzt lieben gelernt haben!« Tragischerweise starb Harris ganz jung einen byronischen Tod, als er für die Unabhängigkeit Griechenlands kämpfte. Als Andenken an die Liebe seines Lebens stellte Siegfried bis an sein Lebensende ein Portrait von Harris auf seinem Schreibtisch auf.

Szenen einer Ehe: Winifred und Siegfried Wagner/ Foto aus Peter P. Pachls Buch „Siegfried Wagner“/ Nymphenburger Verlag 1988
Es sind noch weitere Liebschaften zu berichten. Zu Cosimas großem Unbehagen, verliebte sich der jugendliche Siegfried auf den ersten Blick in den älteren famosen Bariton Theodor Reichmann (1849 – 1903), der Amfortas bei der Welt-Uraufführung von »Parsifal« sang. Als Student hatte Siegfried eine Affäre mit einem Graf von Goetzen (sonst ist fast nichts von ihm bekannt), was einige Querelen mit Harris zur Folge hatte. Außerdem widmet Siegfried in seinen Memoiren noch einem anderen Homosexuellen einen wichtigen Platz: Paul von Joukowsky (auch Zhukovski geschrieben, 1845 – 1912), Maler und spezieller Freund von Schriftsteller Henry James, der eine »besonders zarte Liebschaft« für ihn hegte und weiterhin sagte: »Er ist ganz nach meinem Geschmack und wir haben uns ewige Freundschaft geschworen.«
In reiferen Jahren entstand eine enge Freundschaft mit dem gleichaltrigen Jugendstilmaler Franz Stassen (1869 – 1949), der Siegfried als Trauzeuge diente und dem Siegfried eine Oper widmete. Stassen ist bekannt für seine Illustrationen von Richard Wagners Werken, hat aber auch homoerotische Skizzen im Stil von Paul Cadmus‘ What I Believe veröffentlicht. Stassen, der wie Siegfried verheiratet war, bekannte sich 1941 zu seiner Sexualität.

Eng befreundet: Franz Stassen, Bühnenbildner, Maler, Künstler/ Foto Wiki
Schließlich bittet Siegfried in seinen Opern um Verständnis für verbotene Liebe und prangert die Justiz an, die Hexen am Scheiterhaufen verbrennt, die Selbstmördern das Begräbnis verweigert oder die Ausgestoßene verschmäht. Außerdem verbergen viele seiner Figuren schreckliche Geheimnisse, fürchten sich vor Aufdeckung und schließen einen Bund mit dem Teufel. Hier kann man dann noch ein interessantes Detail hinzufügen. Bei seiner allerletzten Inszenierung, dem »Tannhäuser« seines Vaters, lehnte Siegfried sich an eine Idee von Aubrey Beardsleys homoerotisch geprägten Die Geschichte von Venus und Tannhäuser (1895) an; wenn nach seiner Pilgerreise nach Rom Tannhäuser zum Venusberg zurückkehrt, strecken auch halbnackte Jünglinge in suggestivem Rotlicht ihre Arme nach dem Ritter aus. Jonathan Carr betont die Schwierigkeit, Siegfrieds Charakter einzuschätzen: »Auf deutsch sind ein paar Biographien von ihm erschienen, aber seine Memoiren sind dünn, seine Briefe immer noch nicht vollständig veröffentlicht und seine wahren Gefühle oft von Ironie und Jovialität maskiert.« Warum blieb Siegfrieds Sexualität so lange ein Geheimnis? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es doch eine relativ aufgeklärte Einstellung zur Homosexualität, besonders in einem recht liberalen Land wie Deutschland, wo schon 1897 Magnus Hirschfeld das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee gegründet hat. Wie dem auch sei, selbst wenn Siegfrieds Sexualität zu seiner Lebenszeit verheimlicht wurde, warum hat dann später fast niemand das Rätsel gelöst?

Siegfried Wagners Travestieren als Ballerina ist leider nicht dokumentiert; hier doubelt Thomas Hailer in Edmund Gleedes 1986 uraufgeführtem Musiktheater „Cosima Notte oder Notre Dame de Bayreuth“/ Foto entnommen aus dem Standardwerk zu Siegfried Wagner von Peter P. Pachl: „Siegfried Wagner – Genie im Schatten“, Nymphenburg 1988
Das erste Problem ist Zugang zu und Einsicht in die relevanten Dokumente. Siegfrieds Privatpapiere befinden sich im Gegensatz zu seinen Partituren nicht im Bayreuther Archiv. Als 1973 die Familienunterlagen der Richard-Wagner-Stiftung vermacht wurden, hielt Winifred Wagner Siegfrieds Privatkorrespondenz zurück. Nach ihrem Tod kamen die Manuskripte in den Besitz von Verena Lafferentz-Wagners ältester Tochter Amélie. Strikteste Geheimhaltung (Peter Pachl nennt es »Fafnerisierung«) wurde vereinbart! Das ist kaum verwunderlich, denn die Familie ist ja bekannt für ihre Geheimniskrämerei und Hinhaltungstaktiken.
Die nächste Schwierigkeit ergibt sich aus akademischer Feigheit, sogar in der deutschen Forschung, die ansonsten recht aufgeschlossen gegenüber der Homosexualität ist. Zdenko von Krafts Biographie Der Sohn (1969), ein Werk von besonders unkritischer Hagiographie, verliert kein Wort über Siegfrieds sexuelle Männerfreundschaften. Auch das überrascht wenig, denn schließlich hat Winifred das Vorwort verfasst, und wer im Index nach Maximilian Harden sucht, tut dies vergeblich.
Und dann gibt es noch eine hochbrisante Kontroverse. Anscheinend hatte Siegfried mit der Gattin eines Bayreuther Pfarrers eine Affäre, woraus ein Sohn, Walter Aign (1901 – 1977), geboren wurde. Walter, der bei seinem Vater als musikalischer Assistent arbeitete, blieb unverheiratet und war wohl selbst schwul. Trotz außerehelicher Geburt (Siegfried selbst wurde ja so geboren, wie auch Cosima und vielleicht sogar Richard) war Walter der erstgeborene Wagner Erbe (geboren am 9. Juni), noch vor Franz Wilhelm Beidler (geboren am 16. Oktober). Aber für den Scheinapostel Cosima war ein außerehelicher Sohn als Wagnererbe (ebenso wie ein Sohn von einer ihrer Töchter) natürlich völlig inakzeptabel. Siegfrieds Vaterschaft ist in der Wagner Forschung heftig umstritten, aber Fotografien zeigen eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen Walter und Siegfried.

In schwuler Gesellschaft: Viscount Drumlanrig and Lord Alfred Douglas, lover of Oscar Wilde/ Foto Wiki
Glücklicherweise hat sich in den letzten Jahren das Dunkel etwas gelichtet. Peter Pachls Siegfried Wagner: Genie im Schatten (1988) scheut nicht davor zurück, Siegfrieds Sexualität zu erwähnen; seine erstaunliche Widmung – »Wolfgang Wagner, der mich durch seine ablehnende Haltung erst auf den rechten Weg brachte« – beschreibt unverblümt und trefflich die Resistenz der Familie. Edmund Gleedes Musical Cosima Notte oder Notre Dame de Bayreuth (1986) zeigt Siegfried in Frauenkleidern. Ein Puppenspiel von Uwe Hoppe (2006) nimmt König Ludwigs Vernarrtheit in Richard Wagner zum Anlass, Siegfrieds Liebesleben zu rechtfertigen. Jonathan Carrs The Wagner Clan (2007) bietet die erste Möglichkeit für englische Leser, sich über Siegfrieds Bisexualität zu informieren, aber wegen der Fülle des Materials muss das Kapitel über Siegfried kurz bleiben. Zu guter Letzt widmet sich die Internationale Siegfried Wagner Gesellschaft dem Erbe des Sohns von Richard Wagner (Foto oben ein Ausschnitt aus dem auch für die Ausstellung des Schwulen Museums Berlin verwendeten Fotos von Siegfried Wagner und Henry Thode/ ISWG mit Dank).. Nikolai Endres

Der Autor Nikolai Endres/ OBA
Dazu eine kurze Biographie von der Seite der Western Kentucky University, an der Nikolai Endres als Professor lehrt. Nikolai Endres received his Ph.D. in Comparative Literature from the University of North Carolina-Chapel Hill in 2000. As professor at Western Kentucky University, he teaches Great Books, British literature, classics, mythology, critical theory, film, and gay and lesbian studies. He has published on Plato, Ovid, Petronius, Gustave Flaubert, Walter Pater, Oscar Wilde, E. M. Forster, F. Scott Fitzgerald, Mary Renault, Gore Vidal, and others. He is currently on sabbatical and writing a literary biography of American novelist Patricia Nell Warren, author of the famous gay novel The Front Runner. His next projects are pornographic representations of canonical gay texts and a queer reading of the myth and music of Richard Wagner. (Foto oben: Siegfried Wagner/ aus Peter P. Pachl „Siegfried Wagner“/ Nymphenburg 1988)

Kein Wunder bei der starken Mutter: Cosima Wagner und Siegfried Wagner/ Foto aus Peter P. Pachls „Siegfried Wagner“/ Nymphenburger Verlag 1988
Bibliographie: Bock, Claus Victor. Pente Pigadia und die Tagebücher des Clement Harris. Amsterdam: Castrum Peregrini, 1962./ Carr, Jonathan. Der Wagner-Clan: Geschichte einer deutschen Familie. Übersetzer Hermann Kusterer. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2008./ Endres, Nikolai. The Eulenburg Affair Scandalizes Germany’s Leadership. Great Events from History: Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender Events. Herausgeber Lillian Faderman et al. Pasadena, CA and Hackensack, NJ: Salem Press, 2007. 2 Bände: 52-55./ Hamann, Brigitte. Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth. München: Piper, 2002./ Karbaum, Michael. Studien zur Geschichte der Bayreuther Festspiele (1876 – 1976). Regensburg: Gustav Bosse, 1976./ Kraft, Zdenko von. Der Sohn: Siegfried Wagners Leben und Umwelt. Graz und Stuttgart: Stocker, 1969./ Merk, Anton. Franz Stassen, 1869 – 1949. Maler, Zeichner, Illustrator: Leben und Werk. Hanau: Museum Hanau Schloß Philippsruhe, 1999./ Pachl, Peter P. Siegfried Wagner: Genie im Schatten, mit Opernführer, Werkverzeichnis, Diskographie und 154 Abbildungen. München: Nymphenburger, 1988./ Pachl, Peter P. (Herausgeber). Siegfried Wagner-Kompendium 1: Bericht über das erste internationale Symposion Siegfried Wagner, Köln 2001. Herbolzheim: Centaurus, 2003./ Söhnlein, Kurt. Erinnerungen an Siegfried Wagner und Bayreuth. Mit einem Anhang: Siegfried Wagners Briefe an Kurt Söhnlein. Herausgeber Peter P. Pachl. Bayreuth: Internationale Siegfried Wagner Gesellschaft, 1980./ Speyer, Edward. My Life and Friends. London: Cobden-Sanderson, [1937]. / Spotts, Frederic. Bayreuth: A History of the Wagner Festival. New Haven: Yale University Press, 1994./ Stassen, Franz. Erinnerungen an Siegfried Wagner. Bayreuth und Detmold: Bayreuther Bund, 1940./ Wagner, Friedelind. Siegfried Wagner: A Daughter Remembers Her Father. Opera Quarterly 7.1 (Spring 1990): 43-51./ Wagner, Siegfried. Erinnerungen. Herausgeber Bernd Zegowitz. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005./ Wessling, Berndt W. Wieland Wagner, der Enkel: Eine Biographie. Köln-Rodenkirchen: P. J. Tonger, 1997. Nikolai Endres





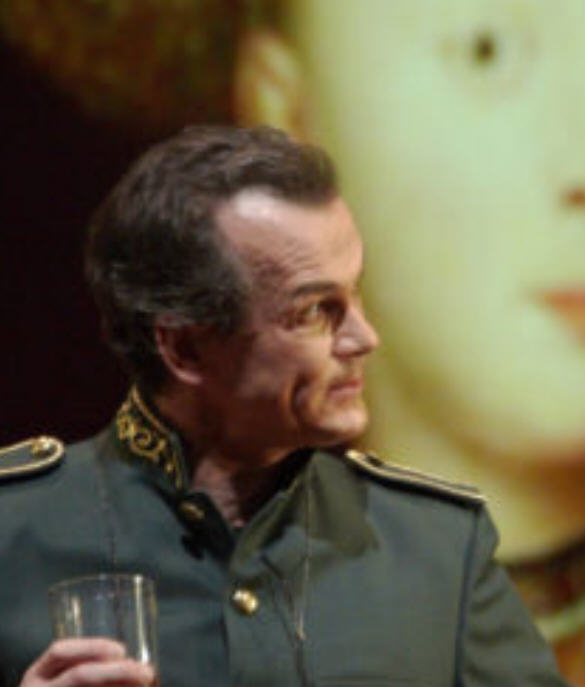







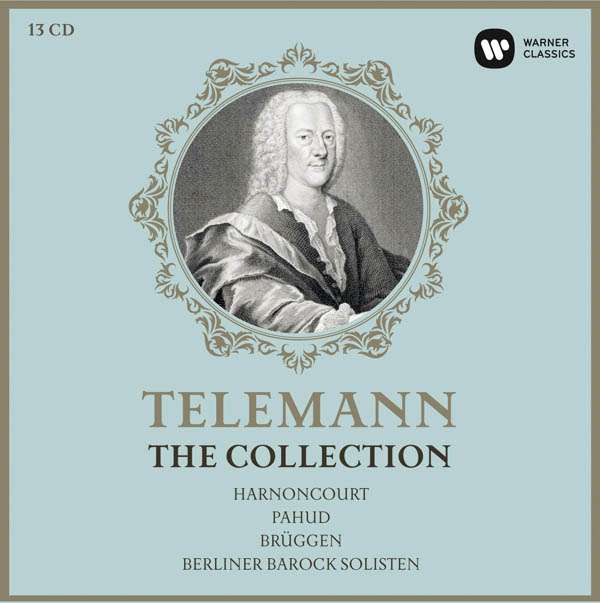
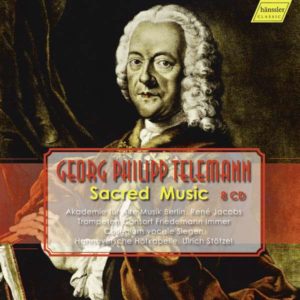 Leider ohne jede Produktions-Jahre-Angaben und in der Auswahl doch recht willkührlich gibt es bei
Leider ohne jede Produktions-Jahre-Angaben und in der Auswahl doch recht willkührlich gibt es bei 
 Etwas völlig Unbekanntes kommt aus Stockholm. Der Mitschnitt einer am Neujahrstag 1965 an der Kungliga Operan uraufgeführten Oper, vor der ich nie hörte. Auch nicht von dem Komponisten:
Etwas völlig Unbekanntes kommt aus Stockholm. Der Mitschnitt einer am Neujahrstag 1965 an der Kungliga Operan uraufgeführten Oper, vor der ich nie hörte. Auch nicht von dem Komponisten:  So oft werde ich die
So oft werde ich die 
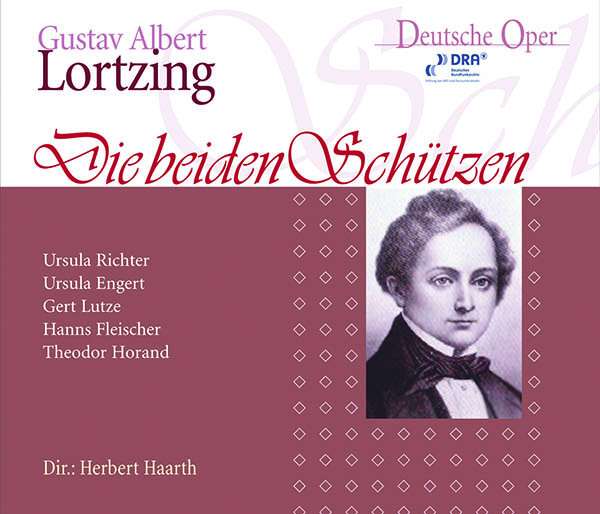



 Eine wahre Kostümorgie (
Eine wahre Kostümorgie (
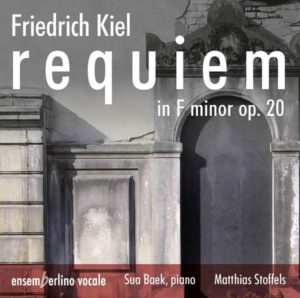 Der Komponist
Der Komponist 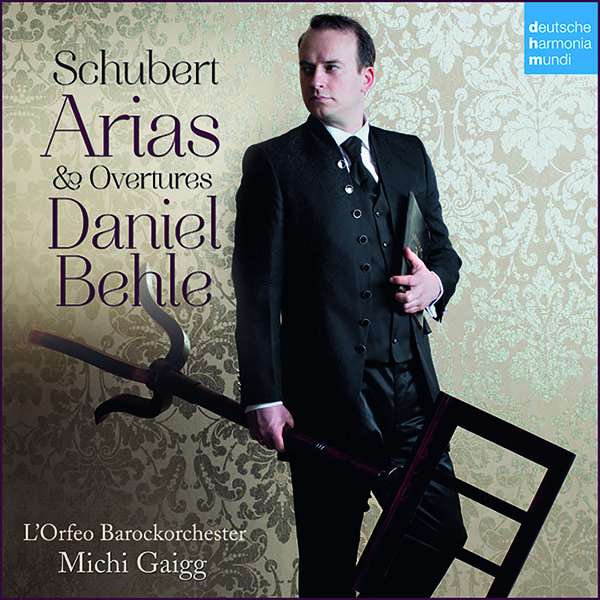


 Von Anfang an scheint kein guter Stern über der Produktion gestanden zu haben. Im Booklet wird die Geschichte von
Von Anfang an scheint kein guter Stern über der Produktion gestanden zu haben. Im Booklet wird die Geschichte von




















 Ihre erste Begegnung mit Meyerbeer hatte
Ihre erste Begegnung mit Meyerbeer hatte 

