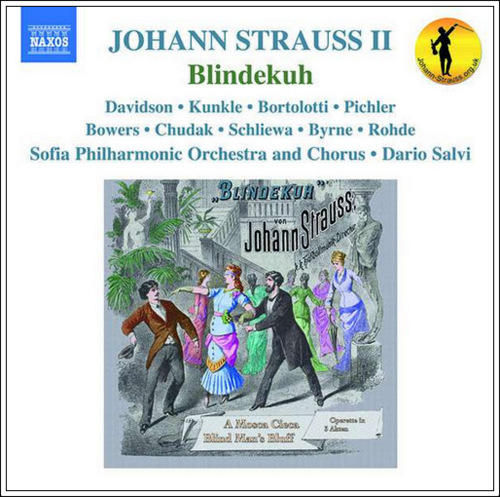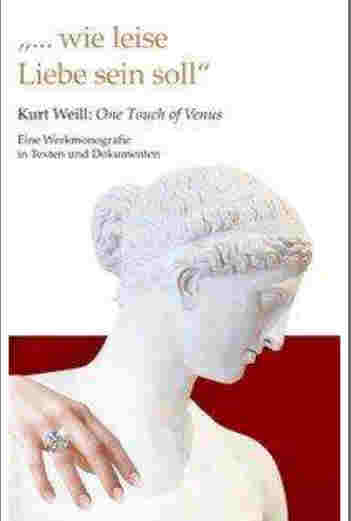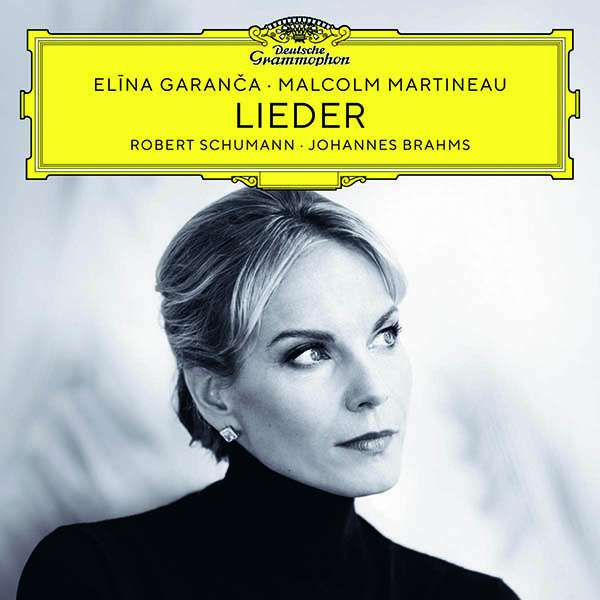Die letzten Neuveröffentlichungen von Opera Rara (beispielsweise Rossinis Semiramide) waren nicht unbedingt Novitäten im Katalog, aber jetzt bringt die rührige britische Firma mit Donizettis Melodramma Il Paria eine veritable Rarität heraus (ORC60, 2 CDs, mit immerhin deutscher Inhaltsangabe). Die Aufnahme – bei deren Titel dem Opernfan die gleichnamige von Moniuszko einfällt – entstand im Juni 2019 in London in Verbindung mit einer konzertanten Aufführung des Werkes im Barbican Centre.
Das zweiaktige Werk ist in die Frühphase von Donizettis Schaffen einzuordnen und wurde 1829 im Teatro San Carlo von Neapel uraufgeführt. Es spielt in Indien, wo der Heerführer Idamore und dessen Vater Zarete der verpönten Kaste der Parias angehören. Die Priesterin des Sonnenkults Neala, Tochter des Hohepriesters der Brahamen Akebare, hat sich in Idamore verliebt, der am Ende – wie sein Vater – wegen seiner niederen Herkunft zum Tode verurteilt wird.
Eine illustre Besetzung war zur Uraufführung angetreten mit Adelaide Tosi als Neala, Giovanni Battista Rubini als Idamore und Luigi Lablache als Zarete. Dennoch fand das Werk keine enthusiastische Zustimmung und wurde nach nur sechs Aufführungen abgesetzt. Der Komponist nutzte Teile der Oper wie einen Steinburch und wie in seiner Zeit durchaus üblich für andere Werke (beispielsweise Il diluvio universale und Anna Bolena, später sogar in Paris für seine grand opéra Il Duc d’Albe).
Die Fähigkeiten des legendären Tenors Rubini hatten den Komponisten befähigt, mit dem Idamore eine der anspruchsvollsten Tenorpartien des gesamten Belcanto-Repertoires zu schaffen. In der Neuaufnahme wurde sie dem Tenor René Barbera anvertraut, der sich mit furchtloser Attacke der enormen Herausforderung stellt. Dass es mitunter grelle und gequält klingende Passagen zu hören gibt, ist bei dieser extremen Tessitura nicht verwunderlich. Allein diese überhaupt zu erreichen und zu bewältigen, macht die Leistung und Bedeutung dieser Interpretation aus. Seine schwärmerische Auftrittskavatine „Là dove al ciel“ zeigt auch die lyrischen Qualitäten des Sängers, aber schon hier werden ihm schwierigste Aufstiege in die Extremhöhe abverlangt, die in der Cabaletta „Fin dove sorgono“ noch unbequemer notiert sind. Seine große Szene mit dem Sopran „Da sì caro e dilce istanto“ im 2. Akt erfordert bellinische Süße und rossinisches accelerando, kombiniert mit der Verve eines donizettischen Finales.
Die russische Sopranistin Albina Shagimuratova, Titelheldin in der Semiramide von Opera Rara, versucht, mit der Neala einen weiteren Belcanto-Gipfel zu erklimmen. Ihr Auftritt mit einer lyrischen Cavatina schildert einen nächtlichen Albtraum und erweitert sich zu einem großen Ensemble. Die Stimme ist von weicher Textur und hellem Ton, prägt sich aber nicht durch ein besonderes Timbre ein. Die Cabaletta am Schluss der Szene weist sie als versierte Interpretin des vokalen Zierwerks aus. Das ausgedehnte Duett mit Idamore im 2. Akt, in welchem er ihr seine wahre Herkunft offenbart („La mano tua/Sarai tu sempre“), verlangt ihr und dem Tenor elegische Kantilenen, sieghafte Spitzentöne und vehementen stretta-Aplomb ab.
Der georgische Bariton Misha Kiria als Zarete nimmt die Lablache-Partie zuverlässig wahr, trumpft vor allem im Duett mit dem Tenor am Ende des 1. Aktes („Lascerò colei che adoro?“) imponierend auf. Sein Solo im 2. Akt, „Notte, ch’eterna a me parevi“, beweist zudem seine Fähigkeit zur Gestaltung arioser Passagen. In der Besetzung findet sich auch Marko Mimica als Akebare. Der kroatische Bassbariton, vor allem den Besuchern der Deutschen Oper Berlin ein Begriff, lässt eine resolute Stimme von autoritärem Ausdruck hören.
Am Pult der Britten Sinfonia steht Mark Elder, der schon das kurze Preludio atmosphärisch ausmalt und später immer wieder spannende Akzente setzt. Auch der Opera Rara Chorus (Stephen Harris) sorgt in den Gesängen der Bramani und Sacerdoti sowie den Ensembles für grandiose Effekte. Die machtvolle Hymne im 2. Akt, „Brama, autor dell’universo“, ist ein Höhepunkt des Werkes und der Einspielung.
Das Booklet mit einem Einführungstext in Englisch, der Handlungsangabe in vier Sprachen sowie dem Libretto in Italienisch und Englisch ist in bewährter Opera-Rara-Tradition mit historischen Abbildungen der Uraufführungsinterpreten ausgestattet, wie sie früher auch die Cover der Ausgaben geschmückt hatten. Da finden sich seit einiger Zeit leider nüchterne grafische Embleme. Aber dieser Einwand soll den Wert der Veröffentlichung nicht schmälern. Bernd Hoppe
Und für alle, die nicht bis zum offiziellen Veröffentlichungstermin Anfang Januar warten wollen: hier ist die website von opera rara, wo man die aufnahme kaufen kann: https://opera-rara.com/shopcatalogue/donizetti-il-paria